When in the 1970s, her poems were remembered, Jarosław Iwaszkiewicz asked:
The mysterious Elin, of which nothing is left, whom nobody remembers nor ever speaks of – is not this the most beautiful, and in any case, saddest tale in our poetry?
Lange vor der deutschen Sibylla gab es bedeutende petrarkistische Dichterinnen in anderen Ländern, wie hier in Italien. Die Übersetzung kommt mir nicht sehr getreu vor, aber ich fand keine andere.
Vittoria Colonna
(* 1492 in der Burg von Marino bei Rom; † 25. Februar 1547 in Rom)

EIN neuer Frühling jauchzt mit tausend Klängen,
Begeistert jubelt die befreite Brust,
Die Blumen färben sich vor Glück und Lust,
Und Vöglein feiern auf begrünten Hängen.
Es glänzt und leuchtet. Auf besonnten Gängen
Enteilt mein Fuß. – Ich hab es nie gewußt,
Und weiß es heut: Gewinn ward mein Verlust!
Wie süß des Trostes Freuden mich umdrängen.
Geliebter du, ja du bist meine Sonne,
Die mir des Frühlings blühend Wunder beut!
Des Geistes Balsam du, des Herzens Wonne,
Die strahlend jede Finsternis zerstreut!
Du, den ich ewig mir versprochen weiß,
Du, meiner Hoffnung immergrünes Reis!
Aus: Italienische Sonette aus vier Jahrhunderten. Auswahl u. Übertragung Maria und Leo Lanckoroński . Krefeld: Scherpe, 1947, S. 85
SONETTO LI.
Nel fido petto un’altra primavera,
Di vaghi fiori e verdi frondi adorna,
Produce quel gran sol che sempre aggiorna
Dentro ‚l mio cor dalla sua quarta spera.
È la sua luce d’ogni tempo intera:
Non s’asconde la notte o il dì ritorna;
Ma in questo e in quello albergo ognor soggiorna
Qui co‘ be‘ rai, là con la forma vera.
Sono i soavi fior gli alti pensieri,
Ch’odoran sempre per quell’alma luce
Che li crea, li nodrisce, apre e sostiene.
Le frondi verdi fa la dolce spene
Ch’egli dal ciel mi manda, e vuol ch’io speri
D’esser con lui beata ov’ei riluce.
Sibylla Schwarz
(24. Februar 1621 Greifswald – 10. August 1638 Greifswald)
Chor der Schäfer und Hirten
[aus Trawer=Spiel / Wegen einäscherung jhres Freudenorts Fretow]
UNsren alten Schäfer Stab
Legen wir mit Schmertzen ab ;
Ach der gar zu grossen Noht !
Unser Vieh ist meist schon todt.
Ach der schönen Schaffe Schar !
Ach jhr warm und weiches Haar !
Aber doch das höchste Weh
Macht uns unser Galateh.
Ach das schönste Schäffer Kindt !
Ach das schönste / das man findt !
Das / und unser altes Landt
Jst nunmehr in fremder Handt
Was wir haben ausgestreut /
Wird von andern abgemeyt .
Unsre Kelber sprungen woll ;
Unsre Scheunen wahren voll ;
Unsre Fercklein nahmen zu ;
Mager war nicht eine Kuh ;
Unsre hüner legten sehr ;
Ach der nun zu Fretow wehr ?
Elend gehts hier in der Stadt /
Wird man doch fast kein mal satt !
Was bey uns war guht und recht /
Das ist hier zu plump und schlecht !
Hier ist Treu und Redligkeit
Hier ist Lieb und Glauben weit !
Hier ist Trug und arge List /
Die bey uns gar frembd noch ist !
Nein / uns ist viel baß zu Muht /
Wenn wir sind auf unsrem Guht.
Hier ist alles stoltz und groß /
Hasen / Wildbrät gilt hier blos.
Da hergegen loben wir
Einen Kohl / ein gut warm Bier /
Einen Knapkäs und ein Ey
Jst bey uns der beste Brey
Käs und Butter / Milch und Fisch /
Fetter Speck auff unserm Tisch
Deucht uns besser als Confect /
Der in Städten lieblich schmeckt.
Für den Wein und Malvasier
Loben wir Covent und Bier.
Wir verachten die Pocal /
Und die Gläser allzumahl ;
Eine feine Hültzern Kan
Steht uns noch viel besser an ;
Ach wie weit ist doch der Tag /
Daß man dich umbfangen mag !
Fretow allerliebster Ort
Fretow / brent nun fort und fort !
Fretow / da der Schäfer Schar
Altzeit wol gelitten war !
Ach das wol bebaute Landt
Jst nunmehr in frembder Handt.
Nirgends war so schön Getreid /
Nirgends war so schöne Weyd /
Nirgens war das liebe Vieh
So vergnügt als eben hie /
Da der schöne Quell entspringt /
Da so mancher Vogel singt /
Da die schöne Nachtigahl
Lieblich ruft durch Berg und Thal /
Da wir auch auff unsrer Fleüt
Spielen pflegten vor der Zeit /
Da die Echo ruffen pflegt /
Da man reiffes Obst abschlegt /
Da man alles finden pflag /
Was ein Schäfer wündschen mag !
Nun ist alle Lust gethan /
Nichts ist das erfrewen kan /
Darumb müssen wir in Leidt
Schliessen unsre junge Zeit. ¶
John Keats
(* 31. Oktober 1795 in London; † 23. Februar 1821 in Rom)
Last Sonnet BRIGHT Star, would I were steadfast as thou art— Not in lone splendour hung aloft the night, And watching, with eternal lids apart, Like Nature's patient sleepless Eremite, The moving waters at their priest-like task Of pure ablution round earth's human shores, Or gazing on the new soft-fallen mask Of snow upon the mountains and the moors— No—yet still steadfast, still unchangeable, Pillow'd upon my fair love's ripening breast, To feel for ever its soft fall and swell, Awake for ever in a sweet unrest, Still, still to hear her tender-taken breath, And so live ever—or else swoon to death.
Standhafter Stern! O wäre ich wie Du,
der hell und hoch und doch nicht einsam brennt.
Du wachst. Du schließt die Lider niemals zu,
des Alls geduldiger Mönch, der Schlaf nicht kennt.
Du folgst den Strömen, die in heiliger Fülle
und reiner Flut das Erdenrund umfangen.
Blickst auf die sanfte, frisch gefallene Hülle
des Schnees, mit dem sich Berg und Tal behängen.
Und dennoch standhaft, willst Du Dich nicht rühren,
nur auf der Liebsten reife Brüste betten
Oh, ewig so dies Auf und Ab zu spüren,
für immer wach, in süßer Unrast Ketten,
fort, fort die Atemzüge hören, sehn,
so ewig leben — oder untergehn.
Nachdichtung von Arthur Zanker. Aus: Die Lyra des Orpheus. Lyrik der Völker in deutscher Nachdichtung. Hrsg. Felix Braun. München: Heyne, 1978, S. 659
Du weißer Stern! Wäre ich stet wie du,
Ich blickte nicht so abendeinsam nieder,
Ein Mönch, der seine ewig offnen Lider
Schlaflos zur Erde wendet, hinstarrt zu
Der Wasser wogend Spiel, die priesterlich
Des Erdballs Küsten reinigend umspülen,
Staunte hinab nicht, wie der Schnee mit kühlen
Gewanden sanft der Berge Bausch umflicht, —
Nein — wenn schon festgebannt, wollt’ unbewegt
Ich der Geliebten weicher Brust verkettet,
Mit süßer Unrast nur dem Auf und Nieder
Des Atems horchen und so sanft erregt
Dies Lauschcn rastlos leben, immer wieder,
Sonst nur den Traum, der mich zum Tode bettet.
Deutsch von Stefan Zweig. Aus: Lyrik des Auslandes in neuerer Zeit. Hrsg. Hans Bethge. 6.-10. Tsd, Leipzig: Max Hesse, o.J. (1. Tsd. 1907), S. 113
Paul van Ostaijen
(* 22. Februar 1896 in Antwerpen; † 18. März 1928 in Miavoye-Anthée)
Metaphysischer Jazz Stuckenberg gewidmet Bruch Geigen Tanz musik von Brettern ge brochene Geigen wie Tänzer incognito en avant The Lord is my Life immerfort mit Banjos The Lord is my Life Autohupen Trommeln Pferdeglocken Bois de Boulogne Tiergarten Made in Germany Ghettogeläute The Lord is my Life galizische Judenjazzband auf daß die Tore Zions fallen Rose von Jericho The Lord is my Life Banjos Whisky Jazz
Deutsch von Helmut Heißenbüttel, aus: Museum der modernen Poesie. Frankfurt/Main: Suhrkamp, 1980, 2. Band, S. 263
Für den italienischen Futuristen F.T. Marinetti war der Krieg „Hygiene der Welt“. Die russischen Zukünftler („budetljanin“) buhten ihn aus, als er in Moskau für seine Doktrin werben wollte. Alexej Krutschonych setzte dagegen:
Die Hygiene des Halses*
Mein Backenknochen zittert völlig anders
der Säbel der Atlas klatz –
wenn ich ausschreie:
хыр дыр чулы [xɨr dɨr tʃʲulɨ]
ich dämpfe die Bewegung der Stühle
und die schmatzende
etwa zwanzigmal
unter dem Kuss Matratze!…
* Statt F.T. Marinettis „Krieg als Hygiene der Welt“
Sie erfanden eine neue Sprache: Sa-um (vom Russischen „Jenseits des Verstandes“. Alexej Krutschonych schrieb eine Programmschrift dafür, die 2011 beim Leipziger Verlag Reinecke & Voß erschien. Ein paar Auszüge:
Sa-Uh – der erste Schritt zur universalen Sprache.
Sa-Uh – die Kunst der Zukunft!
Wir sind über die Welt hinausgewachsen, die Sa-Uh/ Sprache ist über uns hinausgewachsen!
Selbst das Kleid, das wird gewechselt und gereinigt, aber eine und dieselbe Sprache haben wir seit 100 Jahren in Gebrauch!
Man muss eine radikale Reinigung der Sprache durchführen!
Man muss sie durch Wortneuheiten und Sa-um verjüngen: Saum ist die Hygiene der Sprache!
Wirklich nur Spinnerei von Avantgardekünstlern? Krutschonych geht in seiner Schrift auf die Sprachbehandlung im Theater ein – und auf den Film. Man muss sich klarmachen, dass der Film zumindest vor Erfindung des Tonfilms eine Art internationale Kunst war. Krutschonych;
Der Film ist international, die Sa-Uh/ Sprache ist ihm ähnlich in ihrer Schnelligkeit und – in den meisten Fällen – in der emotional-internationalen Bedeutung. Hier Auszüge aus einem Dra** von I. Sdanewitsch, die für die russische und die ausländische Filmkunst verwendbar sind. Zum Beispiel die in den Bart brummende Rede, die an Schafsblöken erinnert. (…)
Die sa-umnische Sprache kann einer Handlung mit beliebiger Schnelligkeit folgen! Sie ist natürlich eine kinematographische Sprache. Ein großer Stummer wird nur in der großen Stummensprache sprechen! (Sa-Uh) Der Film siegt!… Er führt ein: Aeroplan, Zug, allmögliche technische Erfindungen und Tricks als handelnde Hauptpersonen. Und wenn der große Stumme spricht, dann wird seine Rede: Lärm der Maschinen, Kreischen und Quietschen des Eisens – natürlich eine sa-umnische sein!
Nicht heute, sondern morgen verlassen die „Leutchen“ die Szenen der Theater, ihren Platz nehmen Dynamo, Tunnels, magnetische Kanäle ein.
** Von Igor Sdanewitsch erfundenes sa-umnisches Drama
Nun das sa-umnische Gedicht des Tages, angewandte „Hygiene des Halses“: man muss es sich natürlich gesprochen vorstellen, oder besser gleich hören – deshalb steht darunter eine Version in phonetischer Umschrift):
Alexej Krutschonych
(Алексе́й Елисе́евич Кручёных; wiss. Transliteration Aleksej Eliseevič Kručënych; * 9. Februar jul./ 21. Februar 1886 greg. in Olywske, Gouvernement Cherson, in der Ukraine; † 17. Juni 1968 in Moskau)
Горло
рахам
мах – раха
мойла хар
рахам мхе
матоха
трухан – лум
мул
хал
[gɔrlɔ
raxam
max raxa
mɔjla xar
raxam mxʲɛ
matɔxa
truxan lum
mul
xal]
Das Buch erschien 1925 in 2. Auflage. Noch gab es in Sowjetrussland Spielraum für Experimente.
Das Beispiel zeigt auch, dass Sa-um bei aller angestrebten Internationalität (die Kehllaute des Gedichts sind auch für deutsche Hörer wenigstens teilweise hörbar/verständlich) doch im Russischen verankert war. Ein paar teils subjektive Anmerkungen zum Originaltext.
Gorlo russ. Kehle, Gurgel, Hals
rach natürlich dt. Rachen (rachit: russ. Rachitis). Das saumnische Wort scheint im Russischen keine Bedeutung zu haben, man „versteht“ aber teilweise Deklinationsformen eines unbekannten Wortes: racham Dativ Plural, racha Genitiv Singular
mach russ. Schlag, Schwung, Umdrehung, mach racha wäre demnach: „Umdrehung des rach“ (für deutsche Hörer dreht es buchstäblich den Hals um)
mojla: ähnelt dem Wort für Waschen (mojka)
char: Anfang des Wortes charkatj, Spucken, Speien
Es geht nicht um „Entschlüsselung“, sondern um Mithören von Assoziationen. Der Autor selber gibt ja seinen Sa-um-Gedichten als Stütze eine russische Überschrift bzw. Anfangszeile. Auf jeden Fall bilden das russische Wort gorlo und für deutsche Hörer das Wort Rachen einen semantischen Rahmen für das kleine Rachenfest.
Texte aus: Alexej Krutschonych, Phonetik des Theaters. Hrsg. Valeri Scherstjanoi. Leipzig: Reinecke & Voß, 2011
Johann Heinrich Voß
(* 20. Februar 1751 in Sommerstorf, Mecklenburg-Schwerin; † 29. März 1826 in Heidelberg)
Schwergereimte Ode
Statt der Vorrede.
An Voß.[An mich selbst]
Januar 1776.
Was stehst du Spötter da, und pausbackst
Schwerreimende Lehroden her?
Gieb acht, daß man dich nicht hinausbaxt,
Für dein satyrisches Geplärr.
Nur selten liebt den losen Jokus
Apolls erhabner Tubaist;
Noch minder hält von Hokuspokus
Des ernsten Wodans Urhornist.
Verlaß den stachelvollen Jambos,
Womit du’s Dichterchor bestreitst,
Und leg was bessers auf den Ambos,
Das keines Barden Galle reizt!
Denn mehr als je herrscht jetzt das Faustrecht,
Mit Sense, Mistfork, Axt und Spieß
Auf dem Parnaß; besonders braust recht
Die Knotenkeule der Genies.
Auf! weihe dich dem Dienst der Cypris,
Und preise mit galantem Ton,
Was seit der Schöpfung der und die pries,
Das Tändelspiel mit ihrem Sohn.
Und male deines Liedes Hirtin
Mit bloßer Brust und hochgeschürzt,
Und fein von Welt, wodurch Frau Wirtin
Oft ungewürzte Suppen würzt;
Schön, wie die Leserin von Tischbein:
Doch merk! ein Möpschen statt des Buchs!
Ihr Haar ein Mehltalgturm! mit Fischbein
Umpanzert ihr Insektentwuchs!
Sing, wie ihr Hirn von Punsch und Witz dampft,
Wie sie im Rausch des Horngetöns
Den Taumeltanz bacchantisch mit stampft,
Und dann noch endlich dies und jens.
Von solchem Singsang, fein und sinnreich,
Druck‘ in den Almanach was rechts!
Er macht ihn zehnmal mehr gewinnreich,
Als all dein Ächzen und Gekrächz.
Von Nova Zembla bis Gibraltar,
Von Jura bis nach Astrakan,
Singt man daraus an Venus‘ Altar,
Und subskribiert nach Klopstocks Plan.
Ihn kauft Murx, Hasenfuß und Grützkopf,
Strohjunker, Schranz‘ und Bürgerochs,
Sogar der Seelenkäufer Spitzkopf;
Kurz, Ketzer, Jud‘ und Orthodox.
Ihn kleidet der verlaffte Fähndrich
Für seine Dam‘ in Gold und Mohr,
Und packert, wie ein geiler Entrich
Ihr deine süßen Zoten vor.
Sanft hinterm Fächer grinzt das Fräulein,
Errötet – nicht, und schnüffelt schnipp’sch:
»Herr Voß traktiert uns zwar wie Säulein,
Doch wie er’s thut, die Art ist hübsch.«
Der Herold der Journalenfama
Posaunt das Werklein deines Geists;
Selbst des Katheders Dalailama,
Des Kot die Purschen fressen, preist’s.
Hast du von diesen Leuten Kundschaft?
Am Pindus stand, lorbeerumgrünt,
Vordem ein Stall für Phöbus‘ Hundschaft,
Die ihm als Hirten einst gedient.
Klang vom Gebirg der Musen Paian,
Gleich Händels oder Bachs Musik;
So ging im Stall ein Zeterschrei an
Von grimmigbellender Kritik.
Wenn unter Marsyas‘ Anführung
Ein Faunenchor dann aufpfiff; hu!
Wie laut heult‘ ihm, voll tiefer Rührung,
Die Kuppel ihren Beifall zu!
Oft brannte schon der Zorn Apollos;
Er nahm die bleigefüllte Knut‘,
Und schlug aufs Rabenaas für toll los;
Der ganze Hundsstall schwamm in Blut.
Doch alles schien ihm zu gelind‘, und
Verwandelt ward das Rabenaas.
Professormäßig stellt‘ ein Windhund
Sich auf die Hinterbein‘, und las:
»Sehr wertgeschätzte Herrn! Das wichtigst‘
Und erste Prolegomenon
Ist nun wohl die baldmöglichstrichtigst-
e … hauf! … Pränumeration.«
Dann thut er wie Apolls Prophet dick,
Paukt auf sein Pult, und zeiget, bauz!
»Des Dichters Leitstern sei Ästhetik!«
Und bespaßvogelts und besauts.
Ein alter hagrer Mops voll Griesgram
Bleibt noch von Kopf und Pfot‘ ein Mops,
Bleibt noch den Werken des Genies gram;
Und wird Ausrufer Schimpfs und Lobs.
Schimpf bellt er beim Gesang des Orpheus;
Wer sein bierschenkenhaft Gelei’r,
Fix, wie der Musikant im Dorf, weiß,
Dem lobheult Mops wie all der Gei’r!
Die Gänsespul‘ in rascher Hundspfot‘,
Krizkrazt im Hui er sein Journal.
Daher kriegt‘ er den Namen Hundsfott;
Jetzt braucht man noch das Beiwort, kahl.
Quelle:
Deutsche Nationalliteratur, Band 49, Stuttgart [o.J.], S. 329-333.
Permalink:
http://www.zeno.org/nid/20005852358
Mila Elin (auch Elinówna) gehört zu den vergessenen Autorinnen der polnischen Literatur. Sie war die einzige Frau im Umkreis der Krakauer Avantgarde. Sie wurde um 1907 geboren – der Dichter Tadeusz Peiper erwähnt eine 16jährige Elin zum Zeitpunkt des Erscheinens der ersten Nummer der Zeitschrift Zwrotnica. Zwischen 1927 und 1932 veröffentlichte sie 16 Gedichte in Avantgardezeitschriften. Sie soll im Warschauer Ghetto gestorben sein.
Unter dem Gedicht, das Alexandra Bernhardt freundlicherweise aus dem Polnischen übersetzt hat, folgen ein paar Auszüge aus einem Aufsatz über „Polens vergessene Autorinnen“.
Mila Elin
Erinnerung
Weinend sangen die Frauen beim Nachbarn
und hoben zum Himmel die Hände schmal und lang,
und lang fiel das Haar ihnen zu Boden
wogend wie streifiges Wasser.
Ich höre auf das Weinen, das die graue Stunde sättigt
und singt mit den Tropfen des Regens auf meinem Fenster.
… Wieder zurück kommst du in lautlosen Blitzen,
ein Raubfisch aus der Tiefsee.
(Übersetzung: Alexandra Bernhardt)
Wspomnienie
Płacząc śpiewały kobiety u sąsiada
i podnosiły do nieba ręce wąskie i długie,
i włos długi ku ziemi im opadał
falując jak wody smugi.
Słucham płaczu, który szarą godzinę nasyca
i kroplami deszczu śpiewa na szybach.
… Znów powracasz w cichych błyskawicach,
głębinowa drapieżna ryba.
Aus: Linja. czasopismo awangardy literackiel. #4. Krakow 1932, S. 93 https://monoskop.org/images/6/61/Linja_4_1932.pdf
Aus dem Aufsatz „Poland’s Forgotten Women Poets“ von Agnieszka Warnke:
Statistics state that during the Interwar period, every 10th Polish poet was a woman. When looking through biographical notes on women writers of the time, each is listed as the wife, sister, daughter, friend or acquaintance of a male writer. Men often exist independently (in encyclopaedias – but not, of course, in reality).
Therefore, in order to break the patriarchal model of the poetry groups of that period, a woman poet had to be at the very least talented, as it was assumed that even if she learned the rules of the craft, she would never transcend them.
(…)

It was customary to call women poets ‘only children’ (girls, of course). This is how the Kraków Avant-Garde group, with its exhaustive poetic programme, regarded Mila Elin. The more malicious probably referred to her as Tadeusz Peiper’s ‘bastard’, considering the fact that he was the only one who valued her at that time.
Mila Elin was the only woman associated with the Kraków Avant-Garde group. All you could really say for certain is ‘she existed’, as her biography leaves many questions.
When exactly was she alive? She must have been born around 1907, since Tadeusz Peiper mentioned a 16-year-old Elin who began to correspond with him shortly after the first issue of Zwrotnica (Points), a magazine issued by the Kraków Avant-Garde, appeared. Anecdotal evidence suggests that Elin died in the Warsaw Ghetto, although the Jewish Historical Institute is not able to confirm these hypotheses.
We know a few details from Marian Piechal, the co-founder of the Meteor poets’ group. For example, we can determine that she lived in Warsaw – first on Leszno Street, then on Elektoralna – and that she was the daughter of a watchmaker.
(…)
The period of flirtation between Elin and all that literature encompassed for her spans just six years. Beginning in March 1927, it ends in October 1932 in Kraków, taking place between the pages of the magazines Zwrotnica and Linia (Line). In the meantime, Elin became involved with the Łódź Meteor, a magazine devoted to verse which was issued in Warsaw in three editions under the same title.
(…)
Elin was always faithful to Peiper, with whom she had an intellectual affair. Its fruit is her poetry – a woman’s intimate response to an exceedingly masculine worldview, or, as Andrzej Waśkiewicz would have it, a negative of the works of Peiper, this ‘pope’ of the avant-garde.
(…)
When in the 1970s, her poems were remembered, Jarosław Iwaszkiewicz asked:
The mysterious Elin, of which nothing is left, whom nobody remembers nor ever speaks of – is not this the most beautiful, and in any case, saddest tale in our poetry?
Bis heute gibt es auch in der polnischen Wikipedia keinen Artikel über Mila Elin, nur zwei Erwähnungen.
In diesem Buch stehen die Gedichte links, rechts daneben Zeilenkommentare der Autorin – Ermunterung für Leser.
Elke Erb
(* 18. Februar 1938 in Scherbach)
Eine Krähe flog am Fenster vorbei,
die heiße Luft wurde blauer.
Unabweislich schienen die Flügel zu – segnen,
verhuscht, aber doch.
Unten, beim See, der Acker,
so unten wie Aufblick, wie Nehmen in aller Breite.
Säen von Hand war. Gemessenen Schritts.
Perpetuum mobile bis an ein Ende.
12.11.03
die heiße Luft wurde blauer: von ihrem Flug
Unabweislich schienen: während ich hinsah, d.h. ich habe den Eindruck geprüft, es ließ sich nicht von der Hand weisen, verneinen
verhuscht: (zwar) verhuscht: verwischt. Von huschen: rasche, undeutliche Bewegung
so unten wie Aufblick: ein Aufblick muß unten sein; als ob der Acker aufblicke, ich sehe ihn ja von oben.
wie Nehmen in aller Breite: zweite Definition des Ackers, er wird besät, er nimmt. Ihn abernten wäre: er gibt.
Säen von Hand war: Ich imaginiere zum Acker das Säen von früher.
Gemessenen Schritts: jetzt wird der Sämann gesehen. Das Säen kommt noch einmal vor in »Ein Begriff unter anderen« (9.3.07, jetzt S. 88).
Perpetuum mobile bis an ein Ende: Der Arbeitende ist ein Perpetuum mobile. Es hat einmal ein Ende. Die Formel verallgemeinert.
Aus: Elke Erb, Gedichte und Kommentare. Leipzig: poetenladen, 2016 (Reihe Neue Lyrik, Band 10), S. 8f
B. K. Tragelehn
(* 12. April 1936 in Dresden)
Tragelehn macht Kunst
Erwirbt keine Gunst
Leer ist der Magen
Seit mehreren Tagen.
Da kaufte Karl Mickel
Für etliche Nickel
Einen Schinkenroll.
Der Magen wurd voll.
Vom Hunger gerettet
In sich gebettet
Den Rollschinken fett
Lag Tragelehn im Bett
Und schickte zum Himmel
Ohn jed Gebimmel
Ganz still ein Gebet
Für Mickel. Und seht:
Ein Engel schwebt nieder
Bekränzt Mickels Glieder
Mit Flieder
Und schwindet wieder.
Aus: Das letzte Mahl mit der Geliebten. Gedichte. Hrsg. Rainer Kirsch u. Manfred Wolter. Berlin: Eulenspiegel, 1975, S. 80
Wann ist ein Dichter groß? Es ergibt sich nicht von selbst, es muss laut ausgesprochen werden. Entweder von ihm selber, siehe Horaz: Ich habe mir ein Denkmal errichtet dauerhafter als Erz; oder Paul Fleming: Mein Schall flog überweit, man wird mich nennen hören – oder von den Kollegen. Hier Johann Rist über Johann Klaj.
Johann Rist
(* 8. März 1607 in Ottensen bei Hamburg; † 31. August 1667 in Wedel (Holstein))
Johann Klaj
(* 1616 in Meißen; † 16. Februar 1656 in Kitzingen)
1.
Ein grosser Dichter ist Herr Klaj ohne zweifel/
denn seine Lieder sehn nicht nur auff solche lust/
die Schäfern/ Helden und Liebhabern sind bewust/
Nein; Er besinget Gott und spottet auch den Teufel.
Er preiset Michael/ der mit dem Drachen kriegt/
und Ihn der Christenheit zu Nutz und Schutz besiegt.
2.
Ein grosser Dichter ist Herr Klaj meine Freude/
Er gibt die starcke Schlacht so prächtig an den Tag/
daß niemand seine Kunst mit Warheit tadeln mag/
In dem Er recht beschreibt die Kämpffer alle beyde/
den grossen Michael der seine Waffen trägt
vom Himmel und damit den alten Drachen schlägt.
3.
Ein grosser Dichter ist Herr Klai unser Singer/
Er bringet Fried vnd Trost der werthen Christenheit/
die nun errettet ist von aller Grausamkeit
Deß Satans und der Welt durch unsern Drachen-zwinger/
der uns durch diesen Sieg das frölich Himmels-hauß
eröffnet/ und das Thier geworffen hat hinauß.[328]
4.
Ein grosser Dichter ist Herr Klai bey den Teutschen/
Er bringet artig vor/ wie Michael der Held
Durch seinen Vatter sey von Ewigkeit bestellt
Das alte Schlangen Thier durch seinen Tod zu pejeschen/
zu schützen seine Kirch/ und Sie durch diesen Streit
zu führen auff den Thron der süssen Ewigkeit.
5.
Ein grosser Dichter ist Herr Klai der gekröhnter/
Er wird geliebet und geneidet trefflich sehr/
der reinen Engel Chor erzeigt Ihm Preiß und Ehr/
Es hasset ihn der Drach und zwar als ein verhöhnter.
O wie so selig lebt der Mensch zur jeden frist/
dem Gott sein Schöpffer hold/ der Satan neidig ist.
Seinem vielgeehrten Herrn und treuverbundenen Freunde/ übersendet dieses von Wedel auß Holstein.
Johannes Rist Prediger daselbst/ und
von der Röm. Käis. Majest. Hofe
auß Gekrönter Poet.
Quelle:
Johann Klaj: Redeoratorien und »Lobrede der Teutschen Poeterey«. Tübingen 1965, S. 328-329.
Permalink:
http://www.zeno.org/nid/20005163838
 Herzlich willkommen im neuen L&Poe-Format. Das Gedicht des Tages wird es weiterhin geben, aber von Zeit zu Zeit kommt das Journal dazu als kompakte Ladung von Text, Betrachtung, Kritik & was anfällt, Texte von mir und Gästen.
Herzlich willkommen im neuen L&Poe-Format. Das Gedicht des Tages wird es weiterhin geben, aber von Zeit zu Zeit kommt das Journal dazu als kompakte Ladung von Text, Betrachtung, Kritik & was anfällt, Texte von mir und Gästen.
Ich freue mich ganz besonders, dass als Startnummer dieses Fest für Christian Morgenstern erscheinen kann, eine Initiative von Konstantin Ames zu Morgensterns 150. Geburtstag am 6. Mai.
Was Sie hier finden:
| Konstantin Ames | Editor’s Aal | |
| Elisabeth Wandeler-Deck | Christian Morgenstern? Das Knie? | |
| Crauss. | wie vieles muss zugrunde gehen, damit ein weniges gedeiht! | |
| Norbert Gutenberg &
Konstantin Ames |
Re: morgenstern. Die Nachtseite der Rezitation von Morgensternpoesie | |
| Zé do Rock | Morgenpük und Volastern | |
| Armin Steigenberger | Das Bajuwarische bei Morgenstern | |
| Kerstin Preiwuß | Galgenleider | |
| Michael Gratz | Morgenstern in der DDR | |
| Markus R. Weber | Bemerkungen zu Morgensterns Extremitäten | |
| Kristin Bischof | Palmström, ein symbolistischer Sonderling | |
| W. M. Fues | Bella Luna | |
| Diverse | Stimmen zu Morgenstern | |
| Christian Morgenstern | Ein Strauß Epigramme | |
| Christian Morgenstern | Aus einer Literaturgeschichte neuerer deutscher Lyrik | |
| Christian Morgenstern | Von neuer Lyrik | |
| Christian Morgenstern | Ecce Civis | |
| Viten |

Von Konstantin Ames
Mit diebischem Vergnügen denke ich zurück an die verschreckten Gesichter im Kursaal von Meran. Erwartet wurde, dass ich als Preisträger (Hauptschuldiger) etwas vortrage, mit dem etwas zu gewinnen war. Ich habe getan, was Ort und Situation geboten: Demjenigen zu danken, dem ich alles verdanke; und der – 102 Jahre zuvor – nur einen Schwalbenflug entfernt in Untermais verstorben ist. Für den Fall der Fälle hatte ich mir die speckige Cassirer-Ausgabe von 1932 eingepackt. Schon die Ankündigung, etwas von Christian Morgenstern lesen zu werden, ließ alles Feierlich-Weihevolle aus dem Saal entweichen. Morgenstern gilt als Kleinkünstler, als Spaßmacher, als Endorphingarant. Über einen Frontbesuch der Rezitatorin Resi Langer im Ersten Weltkrieg lesen wir in den Erinnerungen von Huelsenbeck: „Sie fuhr ins Feld, […] um dort in der Etappe den Truppen Morgenstern und Busch vorzutragen. […] Mit Morgenstern, dachte sich die Oberste Heeresleitung, geht es besser, und es ging in der Tat. R.L. erzählte […] wie dankbar Soldaten ihr, Trude Hesterberg und Claire Waldorf [!] für die Vorträge waren.“ (zit. nach: R. Tgahrt, Dichter lesen, Bd. 3, Marbach 1995, S. 127). Der Siegener Dichter Crauss fügt, ausgehend vom Fakt, dass Morgensterns Verse auch unter den fliegenden Killern des Kaisers populär waren, diese Männerphantasien zu einem Cento zusammen; Galgenhumor hat auch diese freiwillig düstere Seite. Der schnoddrige Stil der herangezogenen Kampfbeschreibungen von Hans Reimann (Mein blaues Wunder, München 1959) und Max Immelmann (Meine Kampfflüge, posthum, Berlin 1916) ähnelt sich frappant, wobei Immelmann, im Gegensatz zu Reimann, gewiss kein Morgensternleser war — und doch ist kaum ein Flugmanöver denkbar, das so morgensternesk wäre wie der „Immelmann“; Morgenstern wiederum wäre — und vielleicht ist das kein Avantgardeulk — das erste Fliegerass unter den Dichtern.

In der amtierenden Morgenstern-Biografie (2013) merkt Jochen Schimmang an, dass Christian Morgenstern durchaus ein Objekt des Interesses sein könne für Germanistikstudierende mit einem Faible für experimentelle Literatur. Das trifft zu; warum Schimmang aber „statt einer Wirkungsgeschichte“ (S. 253- 255) Laudatoren aneinanderreiht, die außer der Tatsache, dass sie auch prominente Lyriker sind (Grünbein, Gernhardt, Tucholsky) wenig mehr mit dem experimentellen Impetus zu schaffen haben als, sagen wir, die Stolterfohtʼsche Autohitparade mit irgendeinem hergebrachten konsumbürgerlichen Ranking, das wird ein Biografenrätsel bleiben.
Ich habe mit Blick auf den bevorstehenden Jubeltag am 6. Mai 2021 um Auseinandersetzung mit Morgensterns notorischen Gedichtsammlungen Galgenlieder und Palmström gebeten; gefragt habe ich solche Kolleginnen und Kollegen, deren Schreiben tatsächlich eine Ähnlichkeit mit den Verfahrensweisen der Galgenlieder aufweist bzw. die als Forschende mit der Epoche vertraut sind. Bis anheute darf ernsthaft bezweifelt werden, dass es eine Menge von Menschen gibt, auf die eine Zuschreibung wie Morgensternianer, in dogmatischer Fügung: Morgensternisten, sinnvollerweise angewendet werden könnte. Nicht jedes verwundete Knie ist eine Kriegsverletzung oder ein Vergleich. Unsinn ist nicht per se morgensternesk. Allein die sorgfältige Auswahl der Namen, auf die uns Kerstin Preiwuß aufmerksam macht, hat nichts mit Unsinn zu tun – Nonsense bräuchte keine Namen; Nonsense ist eine Zuschreibung.
Die skeptische Frage des geschätzten Kollegen Markus Weber, ob Morgenstern denn mehr als ein Vorläufer gewesen sei, vielleicht viel zu wenig originell („valentinesk“) war, gehört zur Sprache gebracht; und sei es als grantiger Zwischenruf. Meine Frage an Weber war, ob es sich bei Morgenstern um einen Extremisten handelt. Diese Fragestellung scheint mir allzu oft zu einem Infragestellen des (um Werkherrschaft herzlich unbekümmerten) morgenstern’sche Werks abzugleiten; diese Schieflage (mit dem Passepartout der Nonsense-Floskel) flankiert jegliche Interpretation dieser Poesie seit ihrer Erstpublikation. Selbst Lob wirkt dann vergiftet. Über einen Abend „bei den Neopathetikern“, um ein Beispiel herauszugreifen, schreibt r. am 19.01.1911 im Berliner Lokalanzeiger: „Dann las ein Jüngling Gedichte, die Christian Morgenstern viel besser gemacht hat. Den löste ein Studentlein ab“ (zit. nach Tgahrt, a.a.O., S. 45), und auch gegen Ende des 20. Jahrhunderts war es mit dem Meme von der Vorläuferschaft dieses Dichters nicht vorbei; angesichts der Vorzüge der Windhühner befand Volker Neuhaus: „Grass hat in morgensternscher Weise aus dem ›Windei‹ ein dazu passendes ›Windhuhn‹ erschlossen, das als ›Huhn aus Wind‹ zu verstehen sei …“ (in: Gunter E. Grimm, Metamorphosen des Dichters. Das Rollenverständnis deutscher Schriftsteller vom Barock bis zur Gegenwart, Frankfurt/M. 1992, S. 277). Hier wird ganz offensichtlich etwas verwechselt, nämlich Nutznießertum mit ästhetischer Anverwandlung, die doch immer das Weiterführen einer avancierten Schreibe beinhaltet, mit der Morgenstern sehr wohl, Grass u.v.a.m. (v.a. Frankfurt II) nur sehr bedingt in Verbindung zu bringen sind. Anhand eines Streitgesprächs mit Franz Mon u.a. aus dem Jahre 1960 („Lyrik heute“, in: F. Mon, Sprache lebenslänglich – Gesammelte Essays, hg. v. M. Lentz, Frankfurt/M. 2016, S. 231-253) lässt sich bereits eine bornierte Abwehrhaltung gegenüber experimentierfreudigen Verfahren seitens Grass und den surrealistischen Epigonen erkennen, etwa wenn Mons Gedicht „entwicklung einer frage“ mit indolentem Populismus („schlicht kunstgewerblich“) abgetan wird.
Auch in unserem Jahrhundert wurde im Feuilleton der Süddeutschen Zeitung (Nr. 75 vom 31. März 2014, S.12) die Frage in den Raum gestellt, ob der große Sohn Münchens als „Proto-Loriot“ zu apostrophieren sei; dessen „lautmalerische Poesie“ lebe jedenfalls „ganz aus der Sprache“. Aus welcher Sprache eigentlich? In der vorliegenden Auswahl hat der Münchner Dichter Armin Steigenberger Erhellendes zu dialektalen Wendungen und zu Morgensterns Bayerntum zusammengetragen. Ein wenig davon klang schon in Walter Fabian Schmids cool-dialektalen Sprechfassungen (ohne bräsige Huberei) von „Das Hemmed“ und „Neue Bildungen …“ in der Reihe Täglich ein Galgenlied an.
Humor ist in Deutschland ein geringer ausgeprägtes Bedürfnis als das Deutschlandbedürfnis, das sich auch aufs Gedicht erstreckt. Morgenstern ist jedoch keine national-narzisstische Spitzenleistung oder ein regionaler kulturwirtschaftlicher Standortfaktor. Morgensterns Wappentier wäre m.E. der Zitteraal. Die Potenziale dieser Gedichte im Vortrag, ihre Darbietungspflichtigkeit, gilt es näher zu beleuchten. Das Sprechen dieser Poesie, über das sich der franko-saarländische Sprechwissenschaftler und Gedichtsprecher Norbert Gutenberg mit mir ausgetauscht hat, ist keine bloße Zutat; im Zuge unserer Korrespondenz kam gar eine Sprechfassung (Schallfassungen gab es bereits), von „Fisches Nachtgesang“ zustande. Wir sind mit unserer Diskussion nicht fertig geworden; wie auch?
Sollte Walter Serner wirklich die letzte Lockerung geglückt sein, dann ist die erste dieser Lockerungen Christian Morgensterns Verdienst. Zé do Rock demonstriert in seinem Beitrag „Morgenpük und Volastern“ schriftpolyphon, wie sich ein alternative take des „Großen Lalula” anhört und anfühlt. Mir fällt partout keine Papierzeitschrift ein, die gewesen bereit wäre, dieses wilde Schreiben ungekürzt abzudrucken. Zés exorbitanter Beitrag soll auch zu Ohren und Augen gehen.
Aus dem Fundus an morgensterntypischen Motiven wurden zwei ausgewählt. Es haben sich Wolfram Malte Fues, Literatur- und Medienwissenschaftler nicht weniger als Dichter, und die Rilkeforscherin Kristin Bischof bereitgefunden, über das Mondmotiv bzw. über den Sonderling Palmström (im Vergleich zu Rilkes Brigge) Einsichten zu gewinnen. Erst seit dem antiwilhelminischen Galgenlied „Der Mond“ gilt es als vollidiotisch, den Mond zu besingen, das mag manchem einstweiligen „Superstar der Lyrik“ (Dt. Landfunk) entgangen sein. Fues dekonstruiert das Mondklischee mit einem frappanten Schlussakkord. An den Beginn habe ich den Beitrag von Elisabeth Wandeler-Deck gesetzt, der mich durch seine Mischung aus tastendem Duktus und zupackendem Narrativ tief beeindruckt hat. Ausgangspunkt ist ihre Lektüre meines Lieblingsgedichts.
Zu einer teils humorvollen, beklemmenden und sehr persönlichen Reise nimmt uns Michael Gratz, der Kenner deutschsprachiger und internationaler Poesie, mit. Anhand seines Memos, das allemal als Vorlage für eine Lecture Performance taugt, lassen sich die Gefahren ermessen, die von erzwungenen Wünschbarkeiten für eine freie Lebensweise ausgehen. Das Antidot, das der libertäre Schmugglerwitz Morgenstern bereithält, ist sicher nicht reserviert für die kleine Schar von Germanistikstudierenden mit Sonderinteressen. Poesie, die dem Aurabedarf der „wirklich praktischen Leute“ zuarbeitet, geht tief unter jede Anstandsuntergrenze.
Selbstverständlich ist es nichts weiter als der eitle Traum alteuropäischer Editoren, dass die Leserschaft die eigene Zusammenstellung brav von hinten bis vorn durchackert. Reihenfolgen sind einfach dumm, weil unvermeidlich. Gewünscht waren eher kurze Beiträge. Diesem Wunsch ist die eine Hälfte der Beitragenden nachgekommen, die andere hat darauf gepfiffen. Ich finde, dass beide Herangehensweisen ihren Reiz haben. Grundgut an einem Onlineformat wie diesem ist schließlich nicht nur die Baumfreundlichkeit, sondern auch die angenehm abwesende Platznot. Ob nun Essay, Lektüredurchführung, ob Brief, Biss, oder Dialog: Jeder Beitrag funkelt; geflunkert wurde nicht.

Auf musealisierende Staffage wurde weitestgehend verzichtet. Galgenbruder Palmströms Schöpfer wurde einzig und allein dort erblickt, wo ein Dichter sinnvoller Weise gefunden werden kann. Dass sich Comedians, Entertainende, Satiredienstleistende, Kabarettende, Hobbyanarchos und sonstige Vertretende der darstellenden und illustrierenden Zunft auf die rhetorisch-technische Seite der Galgenpoesie gestürzt haben, kann die bis dato desolate Rezeptionssituation mit-erklären: Christian Morgenstern ist in die Popkultur eingewandert wie kein zweiter. In Janoschs ubiquitärem Kinderbuch Die Maus hat rote Strümpfe an findet sich der „Km 21“ und „Fisches Nachtgesang“ wird in Bruno Bozettos Kinderserie Die Ferien des Herrn Rossi ohrenbetäubend umgesetzt; auch das „auf seinen Nasen einher“ reitende Nasobem wurde in den läppisch reitenden „Nasenmann“ zurückverwandelt; zu sehen im genialen Klamaukfilm Texas. Doc Snyder hält die Welt in Atem (1993). Diese weidlich ausgenutzte Nutzerfreundlichkeit wäre eigentlich erfreulich, drohte der Jubilar dabei nicht aus dem Blick zu geraten – und mit ihm seine bleibende Glanzleistung, die nicht zuletzt in der genuinen Verbindung von Unterhaltsamkeit und ästhetischer Neugier gründet. Morgensternpoesie hat so viele Leserinnen und Leser wie die gesamte deutschsprachige Gegenwartslyrik seit 2000 zusammen. Wohlgemerkt: Ich rede von Leserinnen und Lesern, nicht von Leuten, die irgendwas kaufen, um es in die Tasche zu stecken oder anderweitig einstauben lassen. Wer Morgenstern versucht in die Tasche zu stecken, wird sowieso selbst zum Steinochs, der sich dann nur noch von „menschlicher Gehirne Heu“ ernähren kann. Und noch etwas anderes wäre an Morgenstern zu entdecken, nämlich der bedeutsame Unterschied von Coolness als Eigenschaft und als Attitüde. Marcel Beyer hat diese spannungsvolle Differenz einmal an Klings Gedicht „Mann aus Rheydt“ (Text+Kritik, Heft 147, 70-77) nachvollzogen. An einem Gedicht wie „Der Schaukelstuhl auf der verlassenen Terrasse“, dem es dort „kuhl“ ist, wäre das genauso gut möglich gewesen.
Mein Wunsch ist nach wie vor, dass dem Robert-Gernhardt-Preis und dem „Großen Dingdang – Preis für komische Lyrik“ auch ein Preis für diejenige Art von Poesie an die Seite gestellt wird, die die (schier unmögliche) Balance zwischen Kunstvorwärts und Weltanliegen hält, die Morgensterns Verse so besonders macht. Sonst wird er doch noch als minderdichterischer Ulkvogel missverstanden; oder zum nützlichen Vorläufer degradiert. Sein Meisterwerk, die Galgenpoesie, hat Morgenstern beiseite getan, um einen esoterisch-autoritativen Pfad zu betreten, auf dem ich ihm nicht folgen kann. Die posthum edierte Epigrammatik ist größtenteils unerträglich plan; selbst für einen Saarländer, der sich durch die Kenntnis des Œuvres von H.A. Astel gestählt wähnte. Damit diese Ausgabe wirklich nicht als Heroisierung missverstanden wird, haben Michael Gratz und ich uns dazu entschieden, einige Proben dieses garstigen (selten treffsicheren) Spotts zu geben. Durch den Einblick in die historische Bedingtheit kommen Morgensterns Stärken indes erst richtig hervor! Den auch von einer eher unbekannten Seite, nämlich als Dramatiker und Literaturkritiker, anzugucken sich lohnte. Eine der beiden ausgewählten Kritiken ist übrigens frei erfunden, welche wird nicht verraten.
Mein herzlicher Dank gilt pom.lit für die Übernahme eines Teils der Honorare, den beitragenden Kolleginnen und Kollegen und Michael Gratz, dessen neues Magazinformat wir die Ehre haben, mit diesem Geburtstagsdossier eröffnen zu dürfen. — Jetzt zum Fest! Für den Mutmacher Den Sonderlingssympathisanten Den Mondflüchtigen Den Sprachplaner Den Bayernverdreher Den Lebensreformer (nein, für den nicht!) Den Reim-Vertikutierer Den Ichthyohymniker Den Vielgelesenen Den Nicht-Zu-Fassenden Den Superlativgegner Den Überaal
Grau b. Berlin, Mitte Zebra 2021
[✺]

Von Elisabeth Wandeler-Deck
Ob mein Opa Christian Morgenstern begegnet ist, ich kann es nicht fragen. Ihre Wege, hätten sie sich in Morgensterns Wald kreuzen können? Grossvater ging gerne laufen, wie er sagte, er ging, nach dem Mittagsschlaf, ein, wie man da sagte, ein alter Mann, jünger aber, als ich jetzt bin, in den Wald. Sah er das Knie? War er ein einsames Knie? Ein zählendes Perlhuhn?
Opa zählte. Er zählte, was er aufzählte, ich daneben, ging „oh cet echo“.
Sei nie Knie allein nie, nie.
Im Wald. Zählte Sichtbares, was er sah, was er ablas. Die Eule, die Ringeltaubenlaute. Schrittfolgen, Buchstaben hin und her, diese Buchstaben, die sich zu Vor- und Rückwärtssätzen fügten, mit Wörtern drin, die heute ungebräuchlich, verpönt „sei mein nie fies sei fein nie mies“ schon dazumal, heute aus dem Wortschatz entfernt ihre Spuren nicht gelöscht haben. Opa weiss das, nicht, wusste, wusste, wissen, sagte, sagte anderes, manches, beim Spazieren im Wald, beim Händewaschen am Brünnchen, von dem, er lachte, dem Kind beigebracht wurde das Nichtsagen, das Verbot, in einem Sagen, gleichzeitig, zugleich, so, wenn er wiederholte und wiederholte: „ein neger mit gazelle zagt im regen nie“ oder: „… freibier freibier freibier f …“
Im Wald. Morgensterns Wald. Opas Wald. Mein Wald.
Morgensterns Wald. Das Knie im Wald.
Das Knie
Ein Knie geht einsam durch die Welt
Es ist ein Knie, sonst nichts
Es ist kein Baum! Es ist kein Zelt!
Es ist ein Knie, sonst nichts.
Im Kriege ward einmal ein Mann
erschossen um und um.
Das Knie allein blieb unverletzt –
als wärs ein Heiligtum.
Seitdem geht’s einsam durch die Welt.
Es ist ein Knie, sonst nichts
Es ist kein Baum! Es ist kein Zelt!
Es ist ein Knie, sonst nichts.
Im Wald. Überstürze mich von da her in eine Verwirrung, und hineinstürze mich als mich, als ein damaliges Ich, in einen Wald, den ich so nicht kannte, oder war es in Morgensterns Waldgebiet hinein, ins Gestrüpp, ins Unterholz, das ja im Gedicht nicht genannt wird, von welchem Morgenstern nicht schreibt, den es so ja gar nicht gibt, o je, ich sah ja damals und noch jetzt sehe ich das so, ich kann mich und will mich vom Bild nicht trennen, das Knie, das kein Baum war, und kein Zelt, irren im Wald in der Irrnis des Waldes, des zusammengeschossenen Waldes. Den ich erst, viele Jahre später erschreckt sah, in welchem ich stand und nach dem Knie Ausschau hielt. Am Rand von Finnland der Wald, schon beinah in Russland, der so Jahre, zweiundzwanzig Jahre, bevor ich da im Wald, dort am Waldrand ging, war im Winterkrieg zusammengeschossen worden, man meinte, meine finnischen Verwandten dachten, das Knie vorbeiirren zu sehen, den Mamawimmer zu hören, der zusammengeschossenen Menschen, Mannmenschen. Welchen später dann in den jeweiligen Sprachen, in den jeweiligen Strassenbahnen Sitzplätze reserviert waren, soweit sie als Kriegsversehrte davon Gebrauch machen konnten. Ich stelle mir vor, Morgenstern, als kleiner Bub, konnte dem Anblick Versehrter aus dem Deutsch-Französischen Krieg möglicherweise nicht ausweichen und lernte das Hinblicken kennen, nicht hinstarren, das tut man nicht. Und lernte zählen.
 Und zählte. Zählte die Versehrungen, die Glanzpunkte, erblickte, wo denn, das Perlhuhn, dessen Kolleginnen längst auf dem Dachfirst sich die Seele aus dem Leib schrien, den Abend herbeiriefen, was auch immer.
Und zählte. Zählte die Versehrungen, die Glanzpunkte, erblickte, wo denn, das Perlhuhn, dessen Kolleginnen längst auf dem Dachfirst sich die Seele aus dem Leib schrien, den Abend herbeiriefen, was auch immer.
Ob jemand erzählte, die Dinge, die erblickten, sah, herauslöste im Sehen als ein einsames Ding, ein einsam gemachtes Ding, im Blick einsam gewordenes, als einsam erkanntes Ding, zum Beispiel einen Schaukelstuhl, ein betrachtetes, vom Blick gestreicheltes, gestreiftes, erfasstes, einsam gemachtes, parzelliertes Ding, alles, was sonst noch wackeln mag, im Winde, im Winde, im Winde. Ein vom Blick herausgelöstes, ausgelöstes Ding (Francis Ponge, Georges Perec). Ein im Wort, das es benannte, getötetes, im Gedicht ungefährlich gemachtes, zum Verschwinden gebrachtes, aufgehobenes Ding (Maurice Blanchot)? Davon andernorts später vielleicht mehr. Dazu wäre vieles zu sagen, gerade anhand von Morgensterns Gedichten.
Das Perlhuhn
Das Perlhuhn zählt: Eins, zwei, drei, vier …
Was zählt es wohl, das gute Tier,
dort unter den dunklen Erlen?
Es zählt, von Wissensdrang gejückt,
(die es sowohl wie uns entzückt:)
die Anzahl seiner Perlen.
Vielleicht.Ein Seufzer. … und er sank – und ward nimmermehr gesehen.Vielleicht.
Das Butterbrotpapier
Ein Butterbrotpapier im Wald,
da es beschneit wird, fühlt sich kalt.
Frag. Frag doch. Frag. Fragnichtlang.
aus Angst, so sagte ich, fing an,
zu denken, fing, hob an, begann.
[✺]
Die Nachtseite der Rezitation. Eine unstumme Korrespondenz von Norbert Gutenberg und Konstantin Ames
Die fassung der ichthyohymne auf der signaturenseite geht jedenfalls nur halb: die senkungen kann man vielleicht ploppen, die hebungen kann man aber – als fisch zumindest – nicht pusten. Lutz Görner spricht texte immer noch so wie kinder malbücher kolorieren. lg n
Das ist der Taucher, der pustet. Wenn er den Hai auf sich zu schwimmen sieht. Plopp kommt vom Putzerfisch. Das ist natürlich ahistorisch. Damals gab es ja keine Tauchgeräte, die solche Geräusche ermöglicht hätten. Herr Fische hätte im Skaphander gesteckt. Meine Idee ist, dass der Stummfilm im wahren Wortsinn bildspendend ist. Die Behauptung, dies sei das „tiefste deutsche Gedicht“ würde dem welschen Zivilisationsmedium deutschen Tiefsinn — entgegenploppen. Kintopps kamen in dieser Zeit auch in der Reichshauptsstadt in Mode. Morgenstern wird sie gekannt haben. Die Welt ist alles was der Fall ist, mag sein; ist ein Gedicht alles, was gesprochen wird? Naiv, vorerst, ist auch mein Hinweis auf eine Szene aus der Trickfilmreihe Die Ferien des Herrn Rossi: Der sprechende Hund Gastone und sein Herrchen kommen zu einer Insel der singenden Fische (ab 5:48).
Nach einer Sprechfassung habe ich nie gefragt. Sinnvoll krude erschienen mir Plopp- und Schnappgeräusche. In einem Galgenlied taucht ein „Walfafisch“ (sic) auf, der alles andere auffrisst. Was schwebt Dir vor, ich meine: welche Sprechfassung?
ploppen und pusten, das ist ja nun keine sprechfassung, nur eine schallfassung. Die fische sind bekanntlich stumm, aber sie schweigen in ganz verschiedenen sprachen, weiß altmeister Brecht. Ich habe deshalb erst einmal eine übersetzung angefertigt, eine lateinische transliteration, die zudem kongenial ist zur Morgensternschen poetologie. Die kann man nun sprechen.
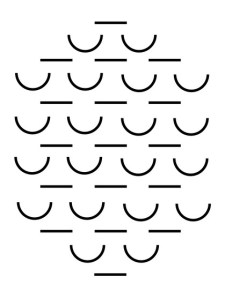 |
Dak- |
„Fisches Nachtgesang“ in das System der Metrik einzuordnen hat mich zunächst befremdet. Etwas, das der Verfasser als „Das tiefste deutsche Gedicht“ bezeichnet, ist aber nur vermeintlich eingeigelt. Du hast es übersetzt in einer Weise wie Morgenstern „Das Mondschaf“ übersetzt hat. Parodistisch. Gespielt überheblich. Morgenstern stellt Verbotschilder auf, in der sicheren Annahme, eine Trotzreaktion auszulösen. Etwas sehr Kindliches steckt darin. Das Nietzsche-Motto verweist darauf. Ich fand es immer schade, das CM das Motto nicht fingiert, und dann Nietzsche, untergeschoben hat. Warum nur Männer tillen können sollen, das hat sich mir allerdings nie erschlossen. Es stimmt einfach nicht. Wohl auch so ein Gebot, gegen das angerannt werden soll.. Was Obrigkeitsstaatlichkeit ist, erfahren wir dieser Tage ja wieder hautnah, diese Gewalt hat Morgenstern ins Gedicht aufgenommen, die Ironie der Büronie anheimgestellt. Ich erinnere mich noch sehr genau der ersten Begegnung mit diesem Gedicht. Ich fand alles um mich herum ziemlich dumm, banal, kleinlich. Emotionalität ist natürlich etwas, womit eine Philologie schwer umzugehen weiß. Darf ich erfahren, warum Dir eine Sprechfassung so wichtig war? Ist der Term „visuelle Poesie“ Dir etwa nicht geheuer?
Ich habe keine Angst vor visueller Poesie. Ich sehe Gesichter in Fisches Nachtgesang, wenn ich zwei Zeilen zusammenfasse. Und ich liebe die 2 Trichter – Ich komme gleich darauf zurück. Christian Morgenstern ist ein Dichter, der klingt, er hat eine fast Rilke’sche Sprachmusikalität. Auch in den Nicht-Dada-Avant-La-Lettre-Gedichten, diejenigen, die so offenkundig von unserem Hymnendrescher Friedrich Zarathustra inspiriert sind. Christian Morgensterns Klang merkt man sogar noch im Görner–Getöse. Deswegen frage ich mich immer, ob man aus dem Visuellen auch ein Auditives machen kann. Bei Fisches Nachtgesang schien mir die Metrik ein Weg, angeregt auch durch Christian Morgensterns germanistische Kommentare zu den Gedichten, geschrieben, damit nicht die Berufsgermanisten denselben Blödsinn später ernst meinen können. Man könnte, gut fischsuppig, das Gedicht auch schlürfen und schmatzen:
–– schlürf ⏝⏝⏝ schmatz
Aber was ich bis jetzt habe, fällt unter ‚Gesang‘. Für ‚Nacht‘ habe ich noch nichts. Nun die Trichter: auch das ein Gedicht, bei dem man das Visuelle sprechen kann (was bei vielen Apollinaire-Sachen nicht geht, die NUR visuell sind). Deine eigene Sprechfassung realisiert einen Teil davon, weil du sehr klar die Zeilen sprichst. Man hört also gut, dass die Zeilen mit immer weniger Silben gefüllt sind. Aber es geht noch mehr. Ernst Pöppel hat herausgefunden, dass Verse (Untersuchungen in 17 verschiedenen Sprachen) 3 sec. dauern. Das ist reine Schalldauer. Mit Auftakt-Einatmung und Fermate am Schluss macht das knapp 5 sec. Bei Zeilen mit vielen Silben ist die Artikulationsgeschwindigkeit hoch; je weniger Silben, umso langsamer artikulieren wir, weil in der Tendenz jede Zeile 3 sec. dauert. Auch bei Dir hat sich die Artikulation verlangsamt. Die Silbenzahlen im Text sind: 8, 8, 5, 4, 3, 2, und nun entweder 2, 2, wenn wir ‚und so‘ / ‚weiter‘ sagen, oder 1, wenn wir ‚us‘ sagen, und <1, wenn wir nur ‚w‘ sagen. Wenn wir jetzt die Artikulationsgeschwindigkeit der beiden achtsilbigen Zeilen beibehalten bei 5,4, 3, 2, 1, <1, dann wird der Trichter, sein Engerwerden noch hörbarer. Und was hätten Görner und Fröbe gemacht? Zumindest Görner hätte die Wangen nach innen gesaugt, die Lippen nach vorne gestülpt und dabei artikuliert, um auszusehen und zu klingen wie ein Trichter. Und demnächst denke ich nach über die vier Zeilen voller Striche, die 4. Strophe von ‚Des Galgenbruders Gebet und Erhörung‘.
Lieber Norbert, danke für Dein closest reading der mute-Fische und des Trichters. Mein Trichter, das muss ich hier endlich mal gestehen, ist vorgetragen mit ständigem Blick auf den Nürnberger Trichter. Kein Scherz. Sonst hätte ich das nicht durchhalten können ohne Lacher. „Die Trichter“ ist ein Warngedicht. Von deutschem Boden darf nie wieder ein Barock ausgehen! (having Neuss in mind). Ein Wort über das wir uns Klarheit verschaffen sollten: Dichter. RM Rilke ist zweifellos einer. Morgenstern aber auch. Morgenstern ist es jedoch nicht um Musik zu tun, auch nicht ums Material. Beide sind Dichter, mein Vorschlag, weil ihre Persönlichkeit nichts anderes zulässt. Rilke ist Lyriker, Morgenstern Poet. Musikalität, meinetwegen Sprachmusikalität, ist kein Paradigma moderner Dichtung. Zu der beide gehören, und die beide mit-ermöglicht haben. Im Mittelpunkt steht nicht ein Verfahren, sondern ein Jemand, der mit seinem ganzen Wesen einsteht, für das, was er da tut: Da ein Sonderling und dort ein Narziss. Beides waren unerwünschte Abweichungen von der Normalität im damaligen Kaiserreich. Devianztoleranz ist ja auch keine Stärke unserer neonormalen Zeit. Wenn Du die Sprachmusikalität Rilkes lobst (geht immer, passt immer, wie frisches Obst, ich mag Konserven auch nicht), frage ich mich, ob es diese Rangordnung wirklich braucht. Will dieser ´Gesang´ Musik sein? Eher nicht. Das ist ein Schritt unter die nietzscheanische Wasseroberfläche der Synästhesie. Und wohl auch eine Vereimerung des Hymnisch-Dithyrambischen. Ich meine nicht irgendeinen Dithyrambus des klügsten Rotzbremsenträgers vor 1900, sondern das schöne Skizzchen, das den Weg in KSA, Bd. 6, S. 290f. gefunden hat, aber leider auch, mit unsichtbarem Riss aus dem Zusammenhang, in hochmögende Anthologien. Nietzsche schreibt über den Venedig-Komplex der Deutschen in einer Form des synästhetischen Realismus, die der deutlich empfundenen (und auch so artikulierten) kulturellen Minderwertigkeit das einzige entgegenzusetzen im Stande ist, was ein philosophierender Schriftsteller aufzubieten vermag: Stil. Nietzsche ist nie Dichter gewesen, auch kein Dichterphilosoph, sondern der geschickteste Arrangeur von allem, was er in die Finger gekriegt hat. Poetische Einbildungskraft: Null. Gefühl: taub. Impulsgeber müssen aber so sein. Nietzsche ist Typ Ausbilder. Von Schülern stets zu überflügeln. Nunja. Und Schriftsteller stehen nur im dt. Kulturraum unter Dichtern. Wie Rilke und Morgenstern welche sind. Die beide nicht die kulturkritische Wucht entfalten konnten wie Friedrich Wilhelm von Naumburg, Denker. (Ranking is m.E. für die Fisch. Bringt nur Nietzscheanern was. Warum es Nietzscheanerinnen gibt, habe ich nie verstanden. Mit Nietzsche ist ja kein Staat zu machen, der nicht gileadistisch wäre. Das aber nur am Rande.) Wichtig sind für mich — als ausübenden Dichter (i.e. Nichtphilosoph) — Anknüpfungspunkte, saubere Knoten für ein sauberes Netz von Verweisen. Das zu fertigen vermochte Morgenstern, Rilke auch. Angewendet auf den Motivkreis ´Nacht´, der titelgebend ist für Fisches Gesang, könnte das bedeuten: Es handelt sich um eine performative Variante von Nietzsche Venedig-Skizze. Ein Gedicht kann niemals tiefsinnig sein. Dichtung und Philosophie sind zweierlei. Eben das zeigt (!) uns Morgenstern, das sich selbst daraus „An der Brücke stand/ jüngst ich in brauner Nacht./ Fernher kam Gesang:“ etwas machen lässt, das deutsch ist, ohne bieder zu sein. Vielleicht der einzige Sieg der Poesie über das Leben und seine Weisheitswäscherei.
Fisches Nachgesang ist eine gutgemeinte, v.a. obendrein gutgemachte Rettung dieses völlig überschätzten Dialektgedichts von Nietzsche. Wie sehr er gesächselt haben muss, lässt sich aus o.g. Zeilen erahnen … Mensch schreibt sich aber nunmal nicht mit ´Ü´. Schreib mir bitte noch etwas zum Unterschied zwischen Fröbe und Görner. Beide sind doch Schauspieler … warum kann der eine rezitieren, der andere nicht? Aus einer der Wohnungen hier in der Düttmannsiedlung blubbert selbstübte Hammondorgelmusik, gar nicht übel, es ist Sonntag, sonst wäre ich schon längst fertig, verzeih. Herzlich grüßt Konstantin

Der Unterschied zwischen Görner und Fröbe ist nicht, dass der eine rezitheatert und der andere rezitiert. Nein, beide mimen. Nur ist Fröbe der um Klassen bessere Schauspieler. Die ‚Schnecken‘-Performance ist keine Rezitation, sie ist ein Mini-Mimo-dram, aber Fröbe ist nicht hohl wie Görner, der nur ‚tönt‘, er hat einen sympathischen Humor, aber er spricht nicht den Text, er mimt die Schnecke. Ich sagte ja, über den Gesang des Fisches wissen wir nun einiges, aber nichts über die Nacht dieses Gesangs. Mit Nietzsches ‚brauner Nacht‘ hat es nichts zu tun (ich wusste es doch, Nietzsches Nacht war auch schon braun!), des Fisches Gesang kommt nicht ‚‘fernher‘, sondern von unten: ‚das tiefste deutsche Gedicht‘, mindestens bodenseetief, und vielleicht muss man es auf 60 Hertz sprechen, beim großen D. Ja, aber nun weiß ich immer noch nichts über ‚Fisches Nacht‘! Aber vielleicht kommen wir der Sache, der Anmerkung zum Gedicht „Das Hemmed“ folgend, über den „Galgen“ näher. Aber nicht jetzt! Des Galgenbruders Gebet und Erhörung Zunächst muss man entscheiden, wie das ‚laute Grübeln‘ der Unke, der Kröte klingt, die ja im Röhricht ‚singt‘. Ein Bastard aus Singen und Grübeln macht einen Schall, den man als Quarren bezeichnen kann, ein Bastard aus Quaken und Knarren, in der ersten Zeile der zweiten Strophe in 4 Spondeen gruppiert. Die 4. Strophe nun zeigt den Versuch der abgemahnten Unke, der Kröte, das Quarren zu unterdrücken, ein Quarren con sordino, ihr Breitmaul geschlossen, Luft und Schall durch die Nase entweichend, ein abgedumpftes nasales Grunzen, keine Spondeen mehr, aber ilf Unterdrückungsversuche pro Zeile, geradezu alexandrinisch, aber nutzlos, weil immer noch hörbar. Und so erscheint er dann doch, der Silbergaul, im Trab, nicht im Schritt, nicht im Galopp, nein, ein Traber – etwas, was Lutz Görner sicher versuchen würde mit Kokosnussschalen hörbar zu machen. (Dabei trabt er doch im Röhricht, man sieht ihn, man ihn hört nicht.) lg n
Lyrisches Ich (ick), lieber Norbert, hat einen beamtenmäßigen Tonfall zu verantworten, den möchte ich (k) gern etwas rausbeamen aus dem preuß’schen Knick. Was ich Dir begefügt schicke, ist ein von mir sogenanntes Elegiemaschinchen, das ich kurzerhand umgewidmet habe. Es soll(te) Teil des kommenden Poesiebuchs werden.  Das wäre komplett uneinschlägig, wenn es nicht in unmittelbarem Zusammenhang einer wiederholten Galgenliederlektüre (auch laut und sehr laut) entstanden wäre. Es funktioniert wie ein Emblem, bloß ohne Überschrift, es ist ein beschädigte Emblem. In einem sehr fundamentalen Sinn pariere ich derart den Privatismusvorwurf gegen die deutschdidaktischen Werfer. Es wäre auch ein Weitertreiben des Morgensternismus, wenn es sowas gäbe … Das ist ein 3-D-Gedicht, eigentlich 4-D-Gedicht, denn der Faktor Zeit spielt ja auch eine Rolle. Trivia: Die Aufnahme ist im ehem. Elternhaus entstanden. Lässt sich lesen, also lässt es sich auch vorlesen, demnach auch rezitieren. Muss eine Rezitation auswendig erfolgen, oder gar vom Blatt? Jetzt schnappe ich wieder nach den Fischen.
Das wäre komplett uneinschlägig, wenn es nicht in unmittelbarem Zusammenhang einer wiederholten Galgenliederlektüre (auch laut und sehr laut) entstanden wäre. Es funktioniert wie ein Emblem, bloß ohne Überschrift, es ist ein beschädigte Emblem. In einem sehr fundamentalen Sinn pariere ich derart den Privatismusvorwurf gegen die deutschdidaktischen Werfer. Es wäre auch ein Weitertreiben des Morgensternismus, wenn es sowas gäbe … Das ist ein 3-D-Gedicht, eigentlich 4-D-Gedicht, denn der Faktor Zeit spielt ja auch eine Rolle. Trivia: Die Aufnahme ist im ehem. Elternhaus entstanden. Lässt sich lesen, also lässt es sich auch vorlesen, demnach auch rezitieren. Muss eine Rezitation auswendig erfolgen, oder gar vom Blatt? Jetzt schnappe ich wieder nach den Fischen.
So manches „Hemmed“ führt uns in die Irre, so auch dieses. Die Anmerkung dazu ist eine einzige Lüge. Ich habe alle Galgen inspiziert, nirgendwo hing ein Fisch. Jeremias Müller ist auch der Meinung, „Fisches Nachtgesang“ sei unhörbar: der siebte der acht jungen Männer, die sich zu sonderbaren Kulten die Hand reichten, ist „Stummer Hannes“ – „der sang Fisches Nachtgesang“ – also nicht! Wie kommt also die Nacht in des Fisches Gesang? Wir brauchen dazu eine akustische „Tagnachtlampe“. Wir finden sie im „Fest des Wüstlings“ – „(zu flüstern)“ heißt es dort. Hier haben wir die Frage: “was flüstert sacht?“ und auch die Antwort: „Fisches Nachtgesang“.
Wer „Wochenchronik“ auf „Honig“ reimt, schert sich nicht um Standards. Irgendwelcher Art. Und der Stumme Hannes singt natürlich (s. unten) nicht, und der Fische Gesang ist sicher ein Gesank. Hier glaubt jemand, der sich frecherweise zu einem Hausgott gemausert hat, die Behauptung aufzustellen, einen nicht-unterschreitbaren Kalauer zusammengestellt zu haben. Das unterschlägt die Tatsache einer stets drohenden Rezensionsrezession. Dem vorzubeugen ist die Müllerjeremiade da. Das Epigramm „Die zwei Esel“ ist, da bin ich sicher, eine grimmige Satire auf die damals dümmsten anzunehmenden Kritikaster. Fisches Nachtgesang ist eines der künstlichen Paradiese. Sei es durch Erziehung, sei es durch wasauchimmer, litt Christian Morgenstern am Morbus Tiefstapel („Bierulk“, „Studentenscherz“ sind rhetorisierende Beigaben zu den „Galgenliedern“ und zum „Horatius Travestitus“); er litt aber umso mehr daran, dass viele Zunftgenossen nachgerade am genauen Gegenteil … wahrscheinlich nicht – litten. Als Nietzschezitierender (Nachtrag zu Deinem Vorschlaghammer: In Venedigs Gassen waren die Nächste lange vor 1922 schon braun) hätte es der Galgenpoet doch wissen müssen, dass wer sich selbst erniedrigt erhöht werden möchte. Falsche Bescheidenheit ist doch die schlimmste Form der Arroganz; Nietzschi hin, Nietzschi her. Zum Glück wird in den Galgenliedern auch mächtig aufgetrumpft, im Bundeslied der Hangmen-Connection von 1905 heißt es: „O greul, o greul, o ganz abscheul,/ hörst du den Huf der Silbergäul?/ Es der Kauz: pardauz! Pardauz!/ Nu halt die Schnauz, nu halt die Schnauz!“ – Nach langer Zeit übrigens wieder Henri Bergsons Abhandlung übers Lachen vors Gehirn gelegt. Wir lachen, so Bergson, wenn ein Automatismus auf etwas Quirliges trifft. Wir tun das als Kinder ganz natürlicher Weise, vergessen aber mehr und mehr, das darüber, über diese Karambolage von Planifikation und wucherndem Chaos, zu lachen sei. Und sterben dann daran. Wir lachen, wenn wir es denn noch vermögen, bei der Lektüre der „Galgenlieder“ über Christian Morgensterns Todesartenprojekt. Fisches Nachtgesang ist eine Nänie auf sich, zu Lebzeiten, ein Abschiedsgedicht, ein Gruselgedicht: ein, vielleicht waren da Piranhas, skelettiertes Gedicht. Na, wenn das nicht mal sympathisch-unbescheiden ist! Er ist ganz bei den Fischen. Demnach sprichwörtlich tot. Ein anderes dieser höchstpersönlichen, d.h. lyrischesichlosen Texte, d.h. „Poesien“ (Jerry Müller verwendet diese mögliche, aber recht ungewöhnliche Pluralbildung) ist „Die Luft“ („war einst dem Sterben nah“); Morgenstern war Santoriumstourist, Lungenleidender. Die Grau(ens)stufen des Lebendigtotseins zu betrachten, auch zu ertragen, das macht für mich den kruden Spaß aus; ich habe nie verstanden, wie man sich entblöden kann, diese Dämmerstunden des Verstandes allen Ernstes als Unsinnspoesie zu klassifizieren. Um eine Klammer zu versuchen: „Fisches Nachtgesang“ kann auf alle möglichen Weisen zelebriert werden, so man sich der Tatsache bewusst ist, ein sehr totes Gedicht vor sich liegen zu haben, also etwas unhintergehbares, ein abgefucktes Unikat, an dem ruhig weiter geknabbert werden kann. Aber zynisch ist das schon … Das hat ein Dichter nun von der vielbeschworenen Authentizität, die allein uns von den Neunaturalisten und den übrigen bigotten Neoisten (innen) trennt.
Lieber Konstantin Wie wärs, wenn wir uns als nächstes mit dem 12/11 befassen? lg n
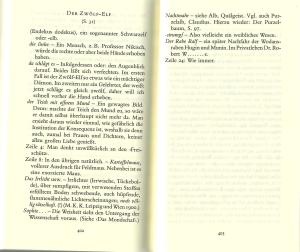 Lieber Norbert, in den abweisenden Anweisungen (zit. Nach: C.M., Sämtliche Galgenlieder, Manesse 1985, S. 402f.) wird ein „Professor Nikisch“ erwähnt, es ist eine nächtliche Predigt, die Nachtseite der Rhetorik. Von der M. Keine hohe Meinung hat. Die Selbstexegese der kühnen Metapher Teich-mit-geöffnetem-Mund wird explizit auf die dispositio („Institution der Konsequenz“) bezogen, der ein obskur bleibendes weibliches Prinzip („die Frauen“) und namentlich „die Dichter“ entgegensetzt werden; beides, so die Behauptung, seien Antagonismen. Die Poesie wird damit personifiziert, und analog zur Dame Rhetorik aufgeboten.
Lieber Norbert, in den abweisenden Anweisungen (zit. Nach: C.M., Sämtliche Galgenlieder, Manesse 1985, S. 402f.) wird ein „Professor Nikisch“ erwähnt, es ist eine nächtliche Predigt, die Nachtseite der Rhetorik. Von der M. Keine hohe Meinung hat. Die Selbstexegese der kühnen Metapher Teich-mit-geöffnetem-Mund wird explizit auf die dispositio („Institution der Konsequenz“) bezogen, der ein obskur bleibendes weibliches Prinzip („die Frauen“) und namentlich „die Dichter“ entgegensetzt werden; beides, so die Behauptung, seien Antagonismen. Die Poesie wird damit personifiziert, und analog zur Dame Rhetorik aufgeboten. Das Formzitat ist die Elegie; der Ton ist nicht threnetisch; es ist vielmehr, die Form, die mystifiziert und wird, die als beständige Metamorphose beschrieben. Zum Begriff des Wanderstrumpfs findet sich der Eintrag „Also vielleicht ein weibliches Wesen“, gemeint ist, soweit ich sehe, der „Schwarzelf oder -elb“. Morgenstern hat in hellsichtiger Weise die Vereinnahmungsversuche einer mystifizierenden Pseudo-Germanistik vorausgeahnt, und dieses Dunkelmännertum als das gebrandtmarkt, was es im Grunde ist: neckisch, und der bildungsphiliströse Kritikaster, der neckisch redet, hört auf den Namen Nikisch. Ist harmlos gegenüber jeder Kunst, die nicht Erbauung zum Ziel hat, also nicht Religion ist, oder eine Tarnform davon: Kunstreligion. Der Zwölf-Elf Er verspottet die Mystifizierer und Priester. Besonders reizvoll ist der Zwölf-Elf für mich aufgrund der Thematisierung des wirkungsvollen Vortrags von Dichtung, das Ganze folgt der These: Poesie ist nicht Rhetorik. Und es gibt keine Fortschritte, keine Beschulungsmöglichkeiten für Dichter, nur Zyklen und Glück bzw. Schicksal. Ein anderer Sohn Münchens und eines NS-Rasseforschers hat das auf die nicht weiter zu versimpelnde Allerweltsformel gebracht: „Dichten lässt sich nicht unterrichten!“ – Klar, wer holt sich auch die Konkurrenz ins eigene Haus … Du kennst „Texas – Doc Snyder hält die Welt in Atem“? Vom Zwölf-Elf sind da gerade noch übrig die „drei lustigen Zwei“ … Helge Schneider tut derzeit übrigens das einzig Schräge: Er tritt nicht mehr auf, weder live noch vermittelt, bis die Maßnahmen eingestellt werden, die eine erhöhte Regierbarkeit der Schutzbefohlenen herbeiführen sollen. Die Staatsdichter*innen tun ja gerade alles, um die Verunmöglichung von Live, und das damit verbundene Skandalon, zu vertuschen: „Und wieder schläft das ganze Land“ – es klingt wie eine Prophetie aus dem Jahre 19dunnemals aufs dichterisch planierte Heute. Mein Zwölf-Elf-Fazit: Für Dichterinnen und Dichter gilt Anwesenheits- und Auskunftspflicht. Der Rest ist Lyriktelefon. Nicht zu verwechseln mit Deinem und des Kollegen Tänzer „Poesietelefon“ … Es sind, es gibt auch Klischee-Zombies, wieder die Schauspieler, die „rezitheatern“ (Dein Term) und diesmal wird man angerufen.
Das Formzitat ist die Elegie; der Ton ist nicht threnetisch; es ist vielmehr, die Form, die mystifiziert und wird, die als beständige Metamorphose beschrieben. Zum Begriff des Wanderstrumpfs findet sich der Eintrag „Also vielleicht ein weibliches Wesen“, gemeint ist, soweit ich sehe, der „Schwarzelf oder -elb“. Morgenstern hat in hellsichtiger Weise die Vereinnahmungsversuche einer mystifizierenden Pseudo-Germanistik vorausgeahnt, und dieses Dunkelmännertum als das gebrandtmarkt, was es im Grunde ist: neckisch, und der bildungsphiliströse Kritikaster, der neckisch redet, hört auf den Namen Nikisch. Ist harmlos gegenüber jeder Kunst, die nicht Erbauung zum Ziel hat, also nicht Religion ist, oder eine Tarnform davon: Kunstreligion. Der Zwölf-Elf Er verspottet die Mystifizierer und Priester. Besonders reizvoll ist der Zwölf-Elf für mich aufgrund der Thematisierung des wirkungsvollen Vortrags von Dichtung, das Ganze folgt der These: Poesie ist nicht Rhetorik. Und es gibt keine Fortschritte, keine Beschulungsmöglichkeiten für Dichter, nur Zyklen und Glück bzw. Schicksal. Ein anderer Sohn Münchens und eines NS-Rasseforschers hat das auf die nicht weiter zu versimpelnde Allerweltsformel gebracht: „Dichten lässt sich nicht unterrichten!“ – Klar, wer holt sich auch die Konkurrenz ins eigene Haus … Du kennst „Texas – Doc Snyder hält die Welt in Atem“? Vom Zwölf-Elf sind da gerade noch übrig die „drei lustigen Zwei“ … Helge Schneider tut derzeit übrigens das einzig Schräge: Er tritt nicht mehr auf, weder live noch vermittelt, bis die Maßnahmen eingestellt werden, die eine erhöhte Regierbarkeit der Schutzbefohlenen herbeiführen sollen. Die Staatsdichter*innen tun ja gerade alles, um die Verunmöglichung von Live, und das damit verbundene Skandalon, zu vertuschen: „Und wieder schläft das ganze Land“ – es klingt wie eine Prophetie aus dem Jahre 19dunnemals aufs dichterisch planierte Heute. Mein Zwölf-Elf-Fazit: Für Dichterinnen und Dichter gilt Anwesenheits- und Auskunftspflicht. Der Rest ist Lyriktelefon. Nicht zu verwechseln mit Deinem und des Kollegen Tänzer „Poesietelefon“ … Es sind, es gibt auch Klischee-Zombies, wieder die Schauspieler, die „rezitheatern“ (Dein Term) und diesmal wird man angerufen.
Hast Du Meyer-Kalkus´ „Geschichte der literarischen Vortragskunst. Von der Antike bis heute“ zur Kenntnis genommen? Meyer-Kalkus geht auch auf den Anteil der Sprecherziehung ein, u.a. auf Weithase.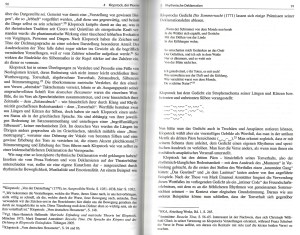 Auf unser Steckenpferdchen geschnallt, wäre die Frage: Ist Morgensterns Nachtgesang nicht tatsächlich eine derbe Persiflage auf Klopstocks Didaxe-Pedanterie? Etwas in diese Richtung ging ja Deine „Auflösung“. Und Klopstock war Säulenheiliger von Dichterking George, und d e n hatte Morgenstern ganz sicher im Visier …
Auf unser Steckenpferdchen geschnallt, wäre die Frage: Ist Morgensterns Nachtgesang nicht tatsächlich eine derbe Persiflage auf Klopstocks Didaxe-Pedanterie? Etwas in diese Richtung ging ja Deine „Auflösung“. Und Klopstock war Säulenheiliger von Dichterking George, und d e n hatte Morgenstern ganz sicher im Visier …
Hier meine nächste Anmerkung. Dein Hinweis auf Klopstock ist nicht nur für den ‚Nachtgesang‘ ein weiterer Aufschluss. Er ist auch für 12/11 interessant. Ich kenne Meyer-Kalkus’ Buch und schätze es auch. Aber bei einem Satz wie: „Wie mag eine so konzipierte rhythmische Deklamation wohl geklungen haben?“ weiß ich: er hat keine Ahnung! Ich könnte sie ihm vorsprechen. Aber er glaubt, das konnte nur Klopstock. Der 12/11 – Morgensterns graeco-latinische Übersetzung ist allerdings verkehrt rum: der 11/12 – hat etwas hymnisches, etwas odisches, etwas klopstockisches. Da ist ein absoluter Gleichschritt von v – v – v – v – in allen Zeilen, vierhebige Jamben, ein beschnittener Blankvers. Nicht ganz regelmäßig wechseln die Strophen: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 12 haben Zeilen, die Sätze sind, davon ist nur in 4 die zweite Zeile ein Satzäquivalent; in 5, 8, 9, 10 sind die Zeilen jeweils ein Syntagma, die Strophe bildet einen Satz. Als Sinnschritte kann man alle Zeilen sprechen, bei den Syntagmen-Zeilen spricht man schwebende Kadenz, bei den Satzzeilen fallende. Jede Strophe ist ein Ausspruch. Wegen der immer gleichen Silbenzahl ist das Tempo immer gleich. Die Betonungsstruktur ist interessant. Ich gebe Dir in der nächsten Mail eine Sprechpartitur. Und denke über Klangfarben, Lautstärken und Lautung nach, und über ‚Kra‘! lg n
Hier also die Sprechpartitur. Die fettgedruckten Silben sind die Sinnakzente. Wir können über jeden einzelnen Akzent diskutieren, wenn sie nicht evident sind. Ich habe Gründe! Heine lässt im ‘Wintermärchen’ die Göttin Hammonia über Klopstock sagen:
… in früherer Zeit war mir am meisten teuer der Sänger, der den Messias besang auf seiner frommen Leier.
Dort auf der Kommode steht noch jetzt die Büste von meinem Klopstock jedoch seit Jahren dient sie mir nur noch als Haubenkopfstock.
Das temporale Gleichmaß des 12/11 hat schon etwas liturgisches. Es ist eine Parodie auf alle frommen Leiern, ob die von Klopstock oder die von Zarathustra. Und so dürfte auch die Lautstärke nur wenig variieren, in der Tendenz eher leise bleiben; der Klang aber muss hohl sein, denn ein Haubenkopfstock ist niemals massiv. Man darf beim Mitternachtsschlag an ‘Bim, Bam, Bum’ denken (nehmen wir uns den als nächstes vor?). Die Reflexion über ‘Kra’ kommt später. Ich konnte mich noch nicht überwinden mir das 12/11-Rezitheater anzutun!
Neueste Kommentare