Lyrikzeitung & Poetry News
Das Archiv der Lyriknachrichten | Seit 2001 | News that stays news
He, Dichterlesungspublikum
Jack Kerouac
(* 12. März 1922 in Lowell, Massachusetts; † 21. Oktober 1969 in Saint Petersburg, Florida)
He, hör mal her, du Dichterlesungspublikum Wenn du nicht das Maul hältst Und der Posie zuhörst, Verstehste... werden wir einen Kerl am Eingang postieren, Der alle Posiehasser aussperrt Für alle Zeiten Und außerdem, falls du das Thema nicht magst Von dem Gedicht, das der Poiet Gerade liest, Jessas, warum Versuchst du’s nicht mit Marlon Brando, Der dir die Augen öffnen wird Mit seinem Schrei James Dean ist tot? -– – Sind wir’s nicht alle? Wer is denn nicht tot – – John Barrymore ist tot Nee San Francisco ist tot – San Francisco ist lammblök Vom Nebel (Und die Zäune sind kalt) 1956?
Deutsch von Horst Spandler, aus: Jack Kerouac: Verstreute Gedichte. (Heartbeat No. 9). Berlin: Stadtlichter Presse, 2004, S. 125
Hey listen you poetry audiences If you dont shut up And listen to the potry, See... we’ll set a guy at the gate To bar all potry haters Forevermore Then, if you dont like the subject Of the poem that the poit Is readin, geen, why dont You try Marlon Brando Who’ll open your eyes With his cry James Dean is dead? -– – Aint we all? Who aint dead – – John Barrymore is dead Naw San Francisco is dead – San Francisco is bleat With the fog (And the fences are cold)
Die neue amerikanische Dichtung, wie sie durch die SF Renaissance verkörpert wird (das heißt wohl durch Ginsberg, mich, Rexroth, Ferlinghetti, McClure, Corso, Gary Snyder, Philip Lamantia, Philip Whalen), ist eine Art neue alte Zen-Verrücktheitsdichtung, bei der du einfach alles, was dir gerade in den Kopf kommt, so wie es kommt, niederschreibst, Dichtung, die zu ihren Ursprüngen zurückgekehrt ist, zum bardischen Kind, die wirklich ORAL ist, wie Ferling sagte, im Gegensatz zur Wortklauberei von Akademikern mit grauen Gesichtern. Poesie & Prosa waren über lange Zeit in die falschen Hände der falschen Leute geraten. Die neuen, reinen Dichter bekennen aus purer Freude am Bekennen. Sie sind KINDER. Sie sind auch kindhafte graubärtige Homere, die auf der Straße singen. Sie SINGEN, sie SWINGEN.
Ebd. S. 7
Jugend. Sonett
(* 20. Oktober 1854 in Charleville; † 10. November1891 in Marseille)
Jeunesse II Sonnet Homme de constitution ordinaire, la chair n’était-elle pas un fruit pendu dans le verger, — ô journées enfantes ! — le corps un trésor à prodiguer ; — ô aimer, le péril ou la force de Psyché ? La terre avait des versants fertiles en princes et en artistes, et la descendance et la race vous poussaient aux crimes et aux deuils : le monde votre fortune et votre péril. Mais à présent, ce labeur comblé, toi, tes calculs, — toi, tes impatiences — ne sont plus que votre danse et votre voix, non fixées et point forcées, quoique d’un double événement d’invention et de succès une raison, — en l’humanité fraternelle et discrète par l’univers sans images ; — la force et le droit réfléchissent la danse et la voix à présent seulement appréciées.
JUGEND Sonett War mir als Mann von besonderer Körperbeschaffenheit das Fleisch nicht wie eine im Obstgarten hängende Frucht; — o kindliche Tage! — der Leib ein Schatz, um ihn zu verschwenden; — o lieben, die Gefahr oder die Stärke der Psyche? Die Erde barg Hänge, fruchtbar an Fürsten und Künstlern, und Herkunft und Rasse trieben dich zu Verbrechen und tiefer Trauer: Die Welt, dein Glück und deine Gefahr. Aber nun, wo diese Arbeit vollendet, sind du, deine Berechnungen, du, deine Sehnsüchte, nichts weiter als dein Tanz und deine Stimme, nicht gefestigt und nicht gesteigert, obwohl Ursprung eines zwiefachen Ereignisses von Erfindung und von Erfolg — innerhalb der brüderlichen und bescheidenen Menschheit in der bilderlosen Welt; – Gewalt und Recht strahlen den Tanz und die Stimme zurück; sie allein werden heute geschätzt.Aus: Arthur Rimbaud: Illuminationen. Übertragen von Gerhart Haug. Mit einem Vorwort von Paul Verlaine. Hamburg: Ellermann, 1947 (Das Gedicht. Blätter für die Dichtung 12-1947), S. 20
Jugend II Sonett War für mich, einen Mann von ganz gewöhnlicher Beschaffenheit, das Fleisch nicht eine im Obstgarten hängende Frucht; o Tage der Kindheit! – der Leib ein Schatz, verschwendet zu werden; – o Lieben, die Gefahr oder die Kraft der Psyche? Die Erde besaß Abhänge, fruchtbar an Fürsten und Künstlern, und Abstammung und Rasse trieben dich zu den Verbrechen und Traurigkeiten. Aber jetzt, da diese Aufgabe vollbracht ist, sind du, deine Pläne – du, deine ungeduldigen Wünsche – nichts weiter als dein Tanz und deine Stimme, nicht festgenagelt und nicht vergewaltigt, obwohl Ursache eines Doppelereignisses von Erfindung und Erfolg – in der brüderlichen und verschwiegenen Menschheit überall in der Welt ohne Bilder; – die Macht und das Recht spiegeln den Tanz und die Stimme wider, die jetzt erst gewürdigt werden.Aus: Flammende Morgenröte / Arthur Rimbaud. Gabrielle Ménardeau u. Justus Franz Wittkop schrieben d. Einl. u. besorgten d. Ausw. aus d. Werk d. Dichters nach d. Übers. aus d. Franz. von Walther Küchler. Genehmigte, ungekürzte Taschenbuchausg. München : Heyne, 1979, S. 108
Jugend II SONETT O einfacher Mensch, war nicht das Fleisch eine Frucht im Garten der Welt – o kindliche Tage, der Leib ein Schatz zu verschenken – o lieben, das Wagnis oder die Kraft einer Göttin? Dichter und Prinzen bedeckten die Erde, doch Herkunft und Rasse stießen uns in Verbrechen und tödliche Trauer: Welt wurde Schatz und Gefahr. Nun aber, da dieses Werk getan und vollendet, sind deine sehnlichste Erwartung, du, dein Kalkül, nicht weniger und mehr als dein Tanz und deine Stimme, nicht starr, nicht gehetzt, obgleich zwiefach gezeugt aus Erfolg und Erfindung: eine Vernunft in verbrüderter Menschheit, in deren bescheidenem, bildlosem All. Die Kraft und die Gerechtigkeit spiegeln den Tanz und die Stimme, heute von uns nur geträumt und geahnt.Deutsch von Dieter Tauchmann. Aus: Arthur Rimbaud, Sämtliche Werke. Frz. u. dt. Leipzig: Insel, 1976, S. 297.
Ich sage, dass man sehend sein muss, sich sehend machen. – Der Dichter macht sich sehend durch eine lange, immense und überlegte Zügellosigkeit aller Sinne. Alle Formen der Liebe, des Leidens, des Wahns; er forscht selbst, er schöpft in sich alle Gifte aus, um nur die Quintessenzen zu bewahren. Unsägliche Qual, wo er alles an Glauben braucht, alles an Menschen übersteigender Kraft, wo er unter allen der große Kranke, der große Verbrecher, der große Verfemte wird — und der allwissende Gelehrte! – Denn er gelangt zum Unbekannten!
Deutsch von Tim Trzaskalik, aus: Arthur Rimbaud: Prosa über die Zukunft der Dichtung. Berlin: Matthes und Seitz, 2010, S. 27
Martin Luther
Giambattista Marino
(Giovan Battista Marino, Marini; * 18. Oktober 1569 in Neapel; † 25. März 1625 ebenda)
Germanistikstudenten könnten seinen Namen gehört haben, Texte gelesen aber vielleicht nicht. Vor allem in älteren Lexika und Literaturgeschichten gilt er als Verantwortlicher für Schwulst-Exzesse zum Beispiel in der deutschen (Marinismus), spanischen (Góngorismus) oder englischen Literatur (Euphuismus). Sein Geburtstag wird in verschiedenen Wikiartikeln als 14. Oktober angegeben, in gedruckten Quellen als 18. Heute also zu einem möglichen Geburtstag ein Gedicht über einen deutschen Mönch. Er wird darin wenig freundlich als Hyäne, Spinne, Frosch oder Python apostrophiert. (Die englischen Königin Elizabeth nennt er gar Gottesschänderin.) Er war also katholisch.
Vor einigen Jahren erschien im Leipziger Verlag Reinecke & Voß: Episteln und Pistolen : eine barocke Dichterfehde / Giambattista Marino & Gaspare Mùrtola. Ausgew. und erstmals aus dem Ital. übertr. von Jürgen Buchmann. Leipzig : Reinecke & Voß, 2013, 1. Aufl.
Martin Luther Fuchs bösen Willens, der die Blumenerde Von Christi Weinberg laut zerwühlt und leise. Gemeiner Wolf, der trügerischerweise Verriet und biß die treue Lämmerherde, Entflohn der Arche, Rabe von Gebärde, Dem Dreck und Abfall Nahrung, Lust und Speise; Hyäne, niederträchtig Stimm' und Weise Menschlich nachahmend, daß sie Lüge werde, Als Spinne stellst du auf zum Fliegenfangen Das Netz der Ketzerei; du Frosch geschwätzig Willst aus dem Sumpfe Seligkeit erlangen. Du Python ! Weltersticker, Hydra, kretzig Mit tausend Köpfen: wagst du sonder Bangen Harmlos zu scheinen, doch im Fraß entsetzlich?
Deutsch von Edward Jaime, aus: Beispiele manieristischer Lyrik. Hrsg. Gerd Henniger. München: dtv, 1970, S. 53f
MARTINO LUTERO
Volpe malvagia, che ’l terren fiorito
de la vigna di Cristo incavi e rodi;
lupo fellon, che con furtive frodi
il fido ovile hai lacero e tradito;
immondo corvo, che, de l’arca uscito,
di putrid’ésca ti nutrisci e godi;
perfida iena, che ’n sagaci modi
formi d’umana voce un suon mentito;
iniqua aragna, che a le mosche ordisci
reti vane d’error; rana loquace,
che, sommersa nel fango, al ciel garrisci;
Piton, che ’l mondo ammorbi; idra ferace
di mille avide teste, ahi! come ardisci
sotto aspetto vezzoso esser vorace?
Die Kassiopeia kennst du
Toni Schwabe
(* 31. März 1877 Blankenburg / Thüringen; † 17. Oktober 1951 Bad Blankenburg)
Die Kassiopeia kennst du Und den Himmelswagen. Mehr Bilder weißt du nicht? Ich soll dir sagen, Was all die anderen Sterne bedeuten – – – – Und einen Augenblick Schließ ich die Augen und denke der Zeiten – Seltsam ferner Zeiten denk ich zurück. Dein weißes Gesicht ist zum Himmel erhoben – Die Kassiopeia kennst du – Und den Himmelswagen –– Die andern Bilder sind – Sterne da droben. Ich werde dir nie ihre Namen sagen.
Aus: Toni Schwabe. Versensporn 25. Jena: Edition Poesie schmeckt gut, 2016, S. 8 (zuerst in: Verse. Berlin: A.R. Meyer, 1907)

Glanz und Elend der teutschen Dicht-Kunst
Die Weltliteratur und so auch die deutsche sind voll von Schmähgedichten – auf Rivalen, Feinde, Schulen oder gleich ganze Epochen. Man muss es nicht immer aussprechen, man LOBT damit zugleich die eigene Schule, Richtung oder peer group. Johann Ulrich König – Hand aufs Herz, wer hat den Namen parat? Er galt als deutscher Horaz, ach nein, nur als sächsischer. Honorige Zeitgenossen lobten ihn: loben und gelobt werden. Wie auch immer, im heutigen Gedicht tadelt er die Dichtung der vorigen Generation und lobt die eigene.
Johann Ulrich König
(* 8. Oktober 1688 in Esslingen; † 14. März 1744 in Dresden)
Uber das Kupffer-Bild vor dem Ersten Theile der Besserischen Schrifften. [siehe unten] Die teutsche Dicht-Kunst war veracht, Sie suchte sich zu bunt zu kleiden; Bey Hofe sah sie sich verlacht, Denn der kan keinen Schulschmuck leiden. Sie war nur auf den Schein bedacht, Und was den Opitz groß gemacht, Begunt’ ihr falscher Witz zu meiden. Doch der Geschmack nebst der Natur Fieng an, sie edler auszuzieren, Und sicher auf der Alten Spur Nach Hofe wieder hinzuführen; Wo sie, befreyt von Schminck und Tand, Durch Bessers Schreib-Art Beyfall fand.
Aus: Deutsche Lyrik von den Anfängen bis zur Gegenwart in 10 Bänden. Hrsg. Walther Killy. Bd. 5: 1700-1770. München: dtv, 2001, S. 120
Johann von Besser war sein Gönner und Chef. Im 18. / 19. Jahrhundert wurden dann mit den von König geschmähten Barockpoeten auch die höfischen Dichter wie Besser und König in den Orkus geworfen. Heute können wir gelassener sein und regen uns nur auf, wenn unsere eigene peer group angegriffen wird.

Stimme aus Israel
Die Anthologie „Stimmen aus Israel“ dokumentiert eine kurzlebige Literatur, entstanden im Wesentlichen in den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts von Deutschen (Deutschsprachigen), denen die Flucht aus Europa und die Einreise nach Palästina gelungen war, und inzwischen so gut wie verschwunden. Von den 26 Autoren in der Anthologie wurden 11 in Deutschland geboren, 8 in Böhmen und Mähren (vor oder nach der Entstehung der Tschechoslowakei), 2 in Rumänien (Bukowina), 4 innerhalb des heutigen Österreich und einer in Polen. Sie sind allesamt deutschsprachige und israelische Autoren.
Werner Shimon Bukofzer
(geboren 22. April 1903 in Berlin; gestorben 15. Oktober 1985 in Zichron Ja’akow), deutsch-israelischer Schauspieler und Schriftsteller. 1939 Palästina. Wien, Tel Aviv. Pseudonym: Werner Brücken.
Die Feindlichen Kämen wir ins Gespräch, vielleicht ergäbe sich dann doch ein Berührendes, daß wir die Wunden uns lecken.
Aus: Stimmen aus Israel. Eine Anthologie deutschsprachiger Literatur in Israel. Hrsg. Meir M. Faerber für den Verband deutschsprachiger Schriftsteller in israel. Stuttgart: Bleicher, 1979, S. 231
Hier an diesem Ort Hier an diesem Ort, einem Sammelbecken der Jahrtausendqual, könntest du unter der Last der Geschichte zusammenbrechen. Gewesenes lebt noch fort, nur mit veränderten Motiven, nur in veränderter Gestalt. Geblieben ist die Gewalt. Grab dich hinab zu den Steinen: du hörst die Geschichte sprechen, du hörst die Geschichte weinen zu einem Himmel, der schweigt.
Ebd. S. 232

Etcetera
Als Student in Rostock entdeckte ich in der Anglistik ganze zwei Bücher von e.e.cummings (so schrieb er sich), die mich in Bann schlugen. Ich verschlang den Romanbericht „The Enormous Room“, ich schrieb den einen Gedichtband, den sie hatten, mit der Schreibmaschine Marke Erika ab – nicht daran zu denken, ein Buch von ihm kaufen zu können* , der Staat DDR verkaufte keine Bücher von drüben – schrieb es ab und fing an zu übersetzen; hier ein Beispiel nicht aus der Abschrift, sondern aus einem Auswahlband, den mir eine amerikanische Studentin ein paar Jahre später schenkte.
*) Ein Band in der Weißen Lyrikreihe von Volk und Welt erschien dann 9 Jahre später doch noch. Dann noch mal 9 Jahre bis Ende Gelände, und in den 90ern verschaffte ich mir die 1100 Seiten starken Complete Poems.
Edward Estlin Cummings
(* 14. Oktober 1894 in Cambridge; Massachusetts; † 3. September 1962 in North Conway, New Hampshire)
meine liebe alte etcetera
tante lucy während des letzten
krieges konnte und was
mehr ist tats erzählte
dir wofür die leute
kämpften,
meine schwester
isabel schuf hundert
(aber
hundert)socken ganz zu
schweigen von hemden flohsicheren ohr-
schützern etcetera,meine
mutter hoffte dass ich
sterben würde etcetera
mannhaft natürlich mein vater pflegte
heiser zu werden wenn er davon sprach welche
ehre es sei und wenn er nur selber
könnte während mein
ich etcetera still im tiefen
schlamm lag et
cetera
(träumend,
et
cetera,von
Deinem lächeln
den augen knien und von deiner Etcetera)

my sweet old etcetera
aunt lucy during the recent
war could and what
is more did tell you just
what everybody was fighting
for,
my sister
Isabel created hundreds
(and
hundreds)of socks not to
mention fleaproof earwarmers
etcetera wristers etcetera, my
mother hoped that
i would die etcetera
bravely of course my father used
to become hoarse talking about how it was
a privilege and if only he
could meanwhile my
self etcetera lay quietly
in the deep mud et
cetera
(dreaming,
et
cetera,of
Your smile
eyes knees and of your Etcetera)

Aus: E.E. Cummings, Complete Poems 1904-1962. Revised, corrected, and expanded edition containing all the published poetry. Ed. by George J. Firmage. New York: Liveright, 1991, S. 275.
Das Gedicht erschien ursprünglich 1926 in dem Band „is 5“.
Ineluctable preoccupation with The Verb gives a poet one priceless advantage: whereas nonmakers must content themselves with the merely undeniable fact that two times two is four,he rejoices in a purele irresistable truth(to be found,in abbreviated costume,upon the title page of the present volume).
Aus dem – vom Verlag erbetenen – Vorwort des Autors zum Band „is 5“
Ach!
Wilhelm Busch
(* 15. April 1832 in Wiedensahl; † 9. Januar 1908 in Mechtshausen)
Beschränkt Halt dein Rößlein nur im Zügel, Kommst ja doch nicht allzu weit. Hinter jedem neuen Hügel Dehnt sich die Unendlichkeit. Nenne niemand dumm und säumig, Der das Nächste recht bedenkt. Ach, die Welt ist so geräumig, Und der Kopf ist so beschränkt!
Aus: Wilhelm Busch, Was beliebt ist auch erlaubt. Hrsg. Rolf Hochhuth im Bertelsmann Lesering. (Mohn & Co., Gütersloh, o.J.) S. 561
Erzählung von alten Frauen
Tadeusz Różewicz
(* 9. Oktober 1921 in Radomsko; † 24. April 2014 in Wrocław
Erzählung von alten frauen Ich liebe die alten frauen die häßlichen frauen die bösen frauen sie sind das salz dieser erde sie verabscheuen den menschlichen abfall nicht sie kennen die kehrseite der medaille der liebe des glaubens sie kommen und gehn die diktatoren verhalten sich närrisch haben schmutzige hände vom blut menschlicher wesen die alten frauen stehn morgens auf kaufen fleisch obst brot putzen kochen stehn auf der straße mit verschränkten händen schweigen die alten frauen sind unsterblich Hamlet tobt im netz Faust spielt eine schmähliche und lächerliche rolle Raskolnikow schlägt zu mit dem beil die alten frauen sind unzerstörbar sie lächeln nachsichtig gott stirbt die alten frauen stehn auf wie alle tage kaufen im morgengrauen brot wein fisch die zivilisation stirbt die alten frauen stehn morgens auf öffnen die fenster entfernen unrat ein mensch stirbt die alten frauen waschen den leichnam bergen die toten pflanzen blumen auf gräbern ich liebe die alten frauen die häßlichen frauen die bösen frauen sie glauben ans ewige leben sind salz der erde rinde des baumes demutsvolle augen der tiere die feigheit das heldentum größe und kleinmut sehen sie in der richtigen proportion nah den erfordernissen des alltags ihre söhne entdecken Amerika fallen bei Thermopylen sterben am kreuz erobern den kosmos die alten frauen gehn am morgen in die stadt kaufen milch brot fleisch kochen die suppe öffnen die fenster nur narren lachen über die alten frauen die häßlichen frauen die bösen frauen denn es sind schöne frauen gute frauen die alten frauen sind das ei geheimnis ohne geheimnis rollende kugel die alten frauen sind mumien heiliger katzen sind kleine runzlige vertrocknende quellende früchte oder fette ovalene buddhas wenn sie sterben fließt aus dem auge eine träne und vereint sich auf dem mund mit dem lächeln des jungen mädchens 1963
Aus: Tadeusz Różewicz: Niepokój. Formen der Unruhe. Übertragen von Karl Dedecius. Wrocław,: Wydawnictowo Dolnosłąskie, 1999, S. 187-191
Opowiadanie o starych kobietach Lubię stare kobiety brzydkie kobiety złe kobiety są solą ziemi nie brzydzą się ludzkimi odpadkami znają odwrotną stronę medalu miłości wiary przychodzą i odchodzą dyktatorzy błaznują mają ręce splamione krwią ludzkich istot stare kobiety wstają o świcie kupują mięso owoce chleb sprzątają gotują stoją na ulicy z założonymi rękami milczą stare kobiety są nieśmiertelne Hamlet miota się w sieci Faust gra rolę nikczemną i śmieszną Raskolnikow uderza siekierą stare kobiety są niezniszczalne uśmiechają się pobłażliwie umiera bóg stare kobiety wstają jak co dzień o świcie kupują chleb wino rybę umiera cywilizacja stare kobiety wstają o świcie otwierają okna usuwają nieczystości umiera człowiek stare kobiety myją zwłoki grzebią umarłych sadzą kwiaty na grobach lubię stare kobiety brzydkie kobiety złe kobiety wierzą w życie wieczne są solą ziemi korą drzewa są pokornymi oczami zwierząt tchórzostwo i bohaterstwo wielkość i małość widzą w wymiarach właściwych zbliżonych do wymagań dnia powszedniego ich synowie odkrywają Amerykę giną pod Termopilami umierają na krzyżach zdobywają kosmos stare kobiety wychodzą o świcie do miasta kupują mleko chleb mięso przyprawiają zupę otwierają okna tylko głupcy śmieją się ze starych kobiet brzydkich kobiet złych kobiet bo to są piękne kobiety dobre kobiety stare kobiety są jajem są tajemnicą bez tajemnicy są kulą która się toczy stare kobiety są mumiami świętych kotów są małymi pomarszczonymi wysychającymi źródłami owocami albo tłustymi owalnymi buddami kiedy umierają z oka wypływa łza i łączy się na ustach z uśmiechem młodej dziewczyny
Zanzotto 100
Gestern hatte noch ein anderer Dichter 100. Geburtstag, der Italiener Andrea Zanzotto. Sein Werk erschien Sein Werk erschien auf Deutsch in einer mehrbändigen Ausgabe bei Urs Engeler und Folio (die Gedichte zweisprachig). Hier ein Gedicht und eine poetologische Notiz.
Andrea Zanzotto
(* 10. Oktober 1921 in Pieve di Soligo; † 18. Oktober 2011 in Conegliano)
MÖGLICHE BEGINNE
BESSERUNGEN ODER SCHLÜSSE
III
In einem einheitlichen Satz verwirrt
mein bester Baustein, meine Furcht,
sich mit dem Helden. Mit dem Himmel, Himalaya.
Wer weiß welche Schätze ich zu schleppen glaubte
und mir Angst und Bang um sie erlaubte,
ich weiß nicht was mir beisteht im Gedränge
Handgemenge um dann zu sausen ins Sagen;
lohnt mich dafür ihr Dinge und ihr Undinge
dass ich Beseelung in eurem Austauschen vermute,
für so viel Lauern Lauschen,
die euch gewährte Möglichkeit zu reimen und zu klingen;
man hat euch hoch hinauf gepusht
zu Bergen aufgestapelt Lebensmittel Zaubersprüche.
Grausig fratzenhaft und brückenjenseits
(fabeljenseits mythenjenseits).
So verschlossen allen Unterschieden
bin ich wehrlos vor dem letzten Unterschied wie nie zuvor
ich wende Salz in einer Schale: ratlos:
das Granulat das Glänzen
das ich aus allem schöpfte
— und dennoch trotzdem –
— vielleicht, aber, so —
diesen Saum der Stille fabriziere
IIl
In un’omogenea tesi l’elemento
mio migliore, la paura,
si confonde all’eroe. Al cielo, a lassù.
Chissà che tesori credetti portare
e lecita per essi la più fifante fifa,
non so che mi sostenga a tanta riffa
a tanta zuffa per poi sfuggire in dire;
premiatemi cose e non cose per l’animazione
sospettata nei vostri conversari,
per tanto appostamento auscultazione,
per avervi messe in agio di ritmari e rimari;
all’altezza là vi s’induceva
vi si faceva monte proteso vivanda vaticinio.
Canagliescamente accanitamente oltreponte
(oltrefavole oltremiti).
Ora che chiuso alle distinzioni
sono più inerme che mai alla distinzione finale
rivolgo il sale nella ciotola: perplesso:
il granularne il lucore
che dedussi da tutto
— malgrado tutto nonostante —
— forse, benché, così —
produco questa quiete marginale.
Aus: Andrea Zanzotto, La Beltà / Pracht. Gedichte Italienisch Deutsch mit einem Nachwort der Übersetzer. Hrsg./Übers. Donatella Capaldi, Maria Fehringer, Ludwig Paulmichl und Peter Waterhouse. Band I. S. 47 / 65.

Es geht darum, die Oberfläche der Sprache zu ritzen, Schnitte, Kratzer zu hinterlassen, sich darin zu versenken — nicht die Sprache zu benutzen. Diese Haltung konkretisiert sich oft in der Beziehung zum sprichwörtlichen «weißen Blatt», das wie allseits bekannt auch die Rückseite einer Straßenbahnfahrkarte, der Beipackzettel einer Arznei oder irgendein Stück Papier sein kann, das man in die Finger bekommt. Bei der Dichtung hat man es mit etwas jenseits und außerhalb des Schreibens zu tun. Der echte Nullpunkt, der «unbestimmte» Punkt des Schreibens ist vielleicht der, der in der Dichtung durchscheint, der uns in Form der Dichtung Angst macht, auch wenn sie auf den ersten Blick mehr mit der Freude, mit dem Glück des Schreibens zu tun hat (das auch immer, sobald es möglich ist, die Oberhand gewinnt). Und das alles schließt das Vorhandensein eines manchmal im Überschuss vorhandenen handwerklichen Könnens nicht aus.
Andrea Zanzotto, Die Welt ist einer andere. Poetik. Engeler e Folio (Planet Beltà Bd. IV) Übersetzt von Karin Fleischanderl. S. 85
Meine Lyrik
Tadeusz Różewicz
(* 9. Oktober 1921 in Radomsko; † 24. April 2014 in Wrocław, deutsch Breslau, schlesisch Brassel)
In Polen hat man das Jahr seines 100. Geburtstages zum Tadeusz-Różewicz-Jahr erklärt. Lyrikzeitung beteiligt sich mit zwei Gedichten, heute das erste.
Ich las es zuerst in einem 1969 erschienenen Band der „Weißen Lyrikreihe“ des Verlages Volk und Welt. In dieser seit 1967 erscheinenden Reihe hatte ich begonnen, die moderne Weltlyrik zu lesen. Den Reiz der frühen Lektüre wird man nie los. Der schmale Band von Różewicz gehört zu den intensivsten Erlebnissen jener Jahre, Verse so oft gelesen, dass sie im Gedächtnis hängen blieben und bei vielen Gelegenheiten im Kopfkino aufploppen bis heute. Vielleicht daher meine Skepsis gegen Interpretationen – wofür braucht man die, wenn man die Gedichte haben kann?
Meine Lyrik übersetzt nichts erklärt nichts verzichtet auf nichts umfängt nicht das Ganze erfüllt keine Hoffnung schafft keine neuen Spielregeln nimmt an keinem Vergnügen teil sie hat einen bestimmten Platz den sie ausfüllen muß wenn sie kein Rätsel ist wenn sie keine Originalität hat wenn sie nicht Erstaunen erzeugt dann muß es so sein offenbar sie gehorcht eigner Notwendigkeit eigenen Möglichkeiten und Schranken sie unterliegt sich selbst braucht nicht den Platz einer andern und kann von keiner andern ersetzt werden offen für alle geheimnislos sie hat viele Aufgaben die sie nie erfüllt.
Deutsch von Günter Kunert
Aus: Tadeusz Różewicz, Gesichter und Masken. Gedichte. Berlin: Volk und Welt, 1969, S. 104 – Von diesem Gedicht gibt es auch eine Version von Karl Dedecius, die zuerst bei Hanser und 1979 bei Heyne erschien.
Moja poezja niczego nie tłumaczy niczego nie wyjaśnia niczego się nie wyrzeka nie ogarnia sobą całości nie spełnia nadziei nie stwarza nowych reguł gry nie bierze udziału w zabawie ma miejsce zakreślone które musi wypełnić jeśli nie jest mową ezoteryczną jeśli nie mówi oryginalnie jeśli nie zadziwia widocznie tak trzeba jest posłuszna własnej konieczności własnym możliwościom i ograniczeniom przegrywa sama ze sobą nie wchodzi na miejsce innej i nie może być przez nią zastąpiona otwarta dla wszystkich pozbawiona tajemnicy ma wiele zadań którym nigdy nie podoła Laut Zähler der Website, von der ich den polnischen Text habe, 20985 mal geklickt.
Nach dem Kriege ist über Polen ein Komet der Poesie niedergegangen. Kopf des Kometen ist Różewicz, der Rest ist Schweif.
Stanisław Grochowiak
Bimmelresonanz
Johannes Theodor Baargeld
(nannte sich Zentrodada, geboren wurde er als Alfred Ferdinand Gruenwald am 9. Oktober 1892 in Stettin; verunglückte am 18. August 1927 am Mont Blanc)
(Noch so ein pommerscher Dadaist, der sich in der Welt herumtrieb, er in Köln, Oxford usw.).
Bimmelresonnanz II
Bergamotten faltern im Petroleumhimmel
Schwademasten asten Schwanenkerzen
Teleplastisch starrt das Cherimbien Gewimmel
In die überöffneten Portierenherzen
Inhastiert die Himmelbimmel
Feldpostbrief recochettiert aus Krisenhimmel
Blinder Schläger sternbepitzt sein Queerverlangen
Juste Berling rückt noch jrad die Mutterzangen
Fummelmond und ferngefimmel
Barchenthose flaggt die Kaktusstangen
Lämmergeiger zieht die Wäscheleine
Wäschelenden losen hupf und falten
Zigarrinden sudeln auf den Alten
Wettermännchen kratzt an ihrem Beine
Bis alle Bimmeln angehalten
(1920)
Aus: Richard Huelsenbeck (Hg.): Dada. Eine literarische Dokumentation. Reinbek: Rowohlt, 1984 (12.-14. Tsd. 1987). S. 215
Der Komet
Ich bleibe bei der Astronomie. Zum heutigen Geburtstag der russischen Dichterin Marina Zwetajewa das Gedicht „Der Komet“ in der Übersetzung von Richard Pietraß.
Marina Zwetajewa
(Мари́на Ива́новна Цвета́ева, * 26. Septemberjul. / 8. Oktober 1892greg. in Moskau,; † 31. August 1941 in Jelabuga)
Der Komet Stern, geschweift, gezottelt Aus des Nirgend Grotten In ein Nirgend trottend. Schaf unter Schafen verlaufen Bestürmend den Herdenhaufen Den goldgevliesten; wie Eifersucht ungehalten – Haariger Stern der Alten! 10. Mai 1921Aus: Marina Zwetajewa, Ausgewählte Werke. Band 1: Lyrik. Hrsg. Edel Mirowa-Florin. Berlin: Volk und Welt, 1989, S. 78
Комета Косматая звезда, Спешащая в никуда Из страшного ниоткуда. Между прочих овец приблуда, В златорунные те стада Налетающая, как Ревность - Волосатая звезда древних!
Die Nebensonnen
Wilhelm Müller ist sicher zu Recht vor allem bekannt als Dichter der beiden von Schubert vertonten Zyklen und ganz besonders der Winterreise. Würden wir ihn ohne Schubert kennen? Das Wandern ist des Müllers Lust wäre wohl auch so ein Volkslied; und die Winterreise wäre zumindest ein Geheimtipp auch ohne Noten. Zum Geburtstag hier eins der harmloseren, aber auch nicht ganz ohne; ein Lied über ein astronomisches Thema und heute mal nur Text!
Wilhelm Müller
(* 7. Oktober 1794 in Dessau; † 1. Oktober 1827 ebenda)
Die Nebensonnen Drei Sonnen seh' ich am Himmel stehn, Hab' lang' und fest sie angesehn; Und sie auch standen da so stier, Als könnten sie nicht weg von mir. Ach, meine Sonnen seyd ihr nicht! Schaut Andern doch in 's Angesicht! Ja, neulich hatt' ich auch wohl drei: Nun sind hinab die besten zwei. Ging‘ nur die dritt' erst hinterdrein! Im Finstern wird mir wohler seyn. 14.3.1823 Aus: Deutsche Blätter für Poesie, Literatur, Kunst und Theater. Breslau 1823, S. 165



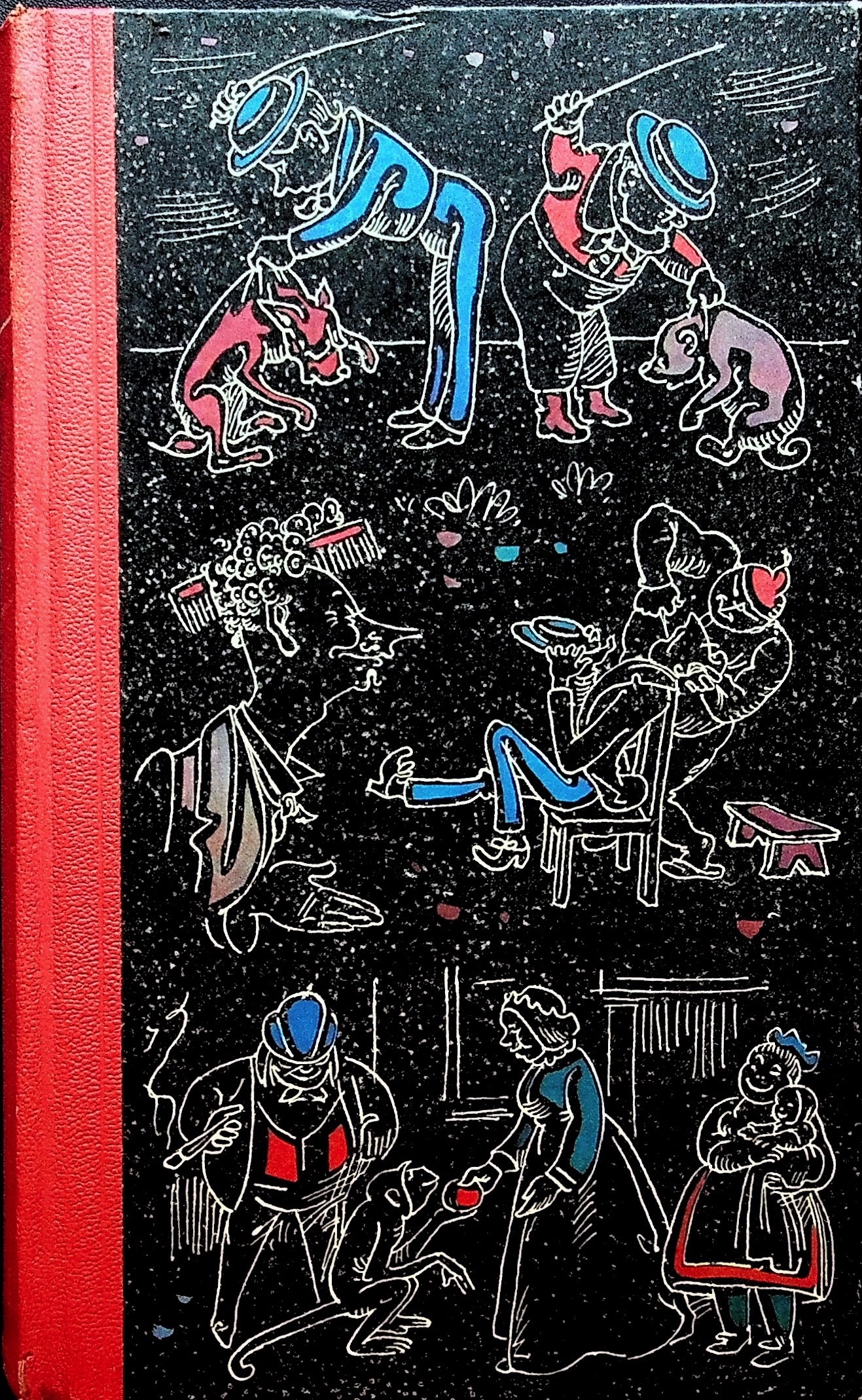
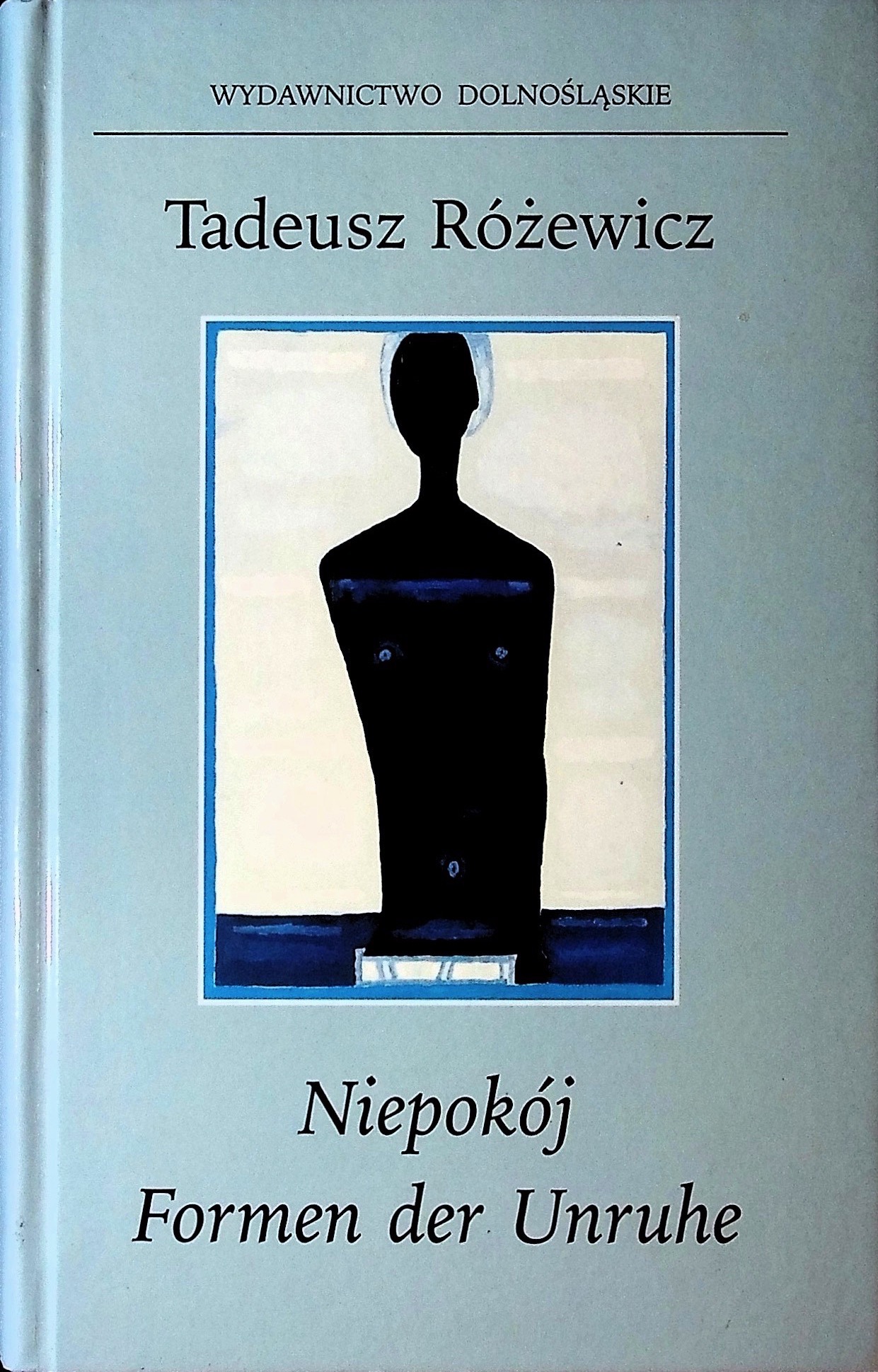
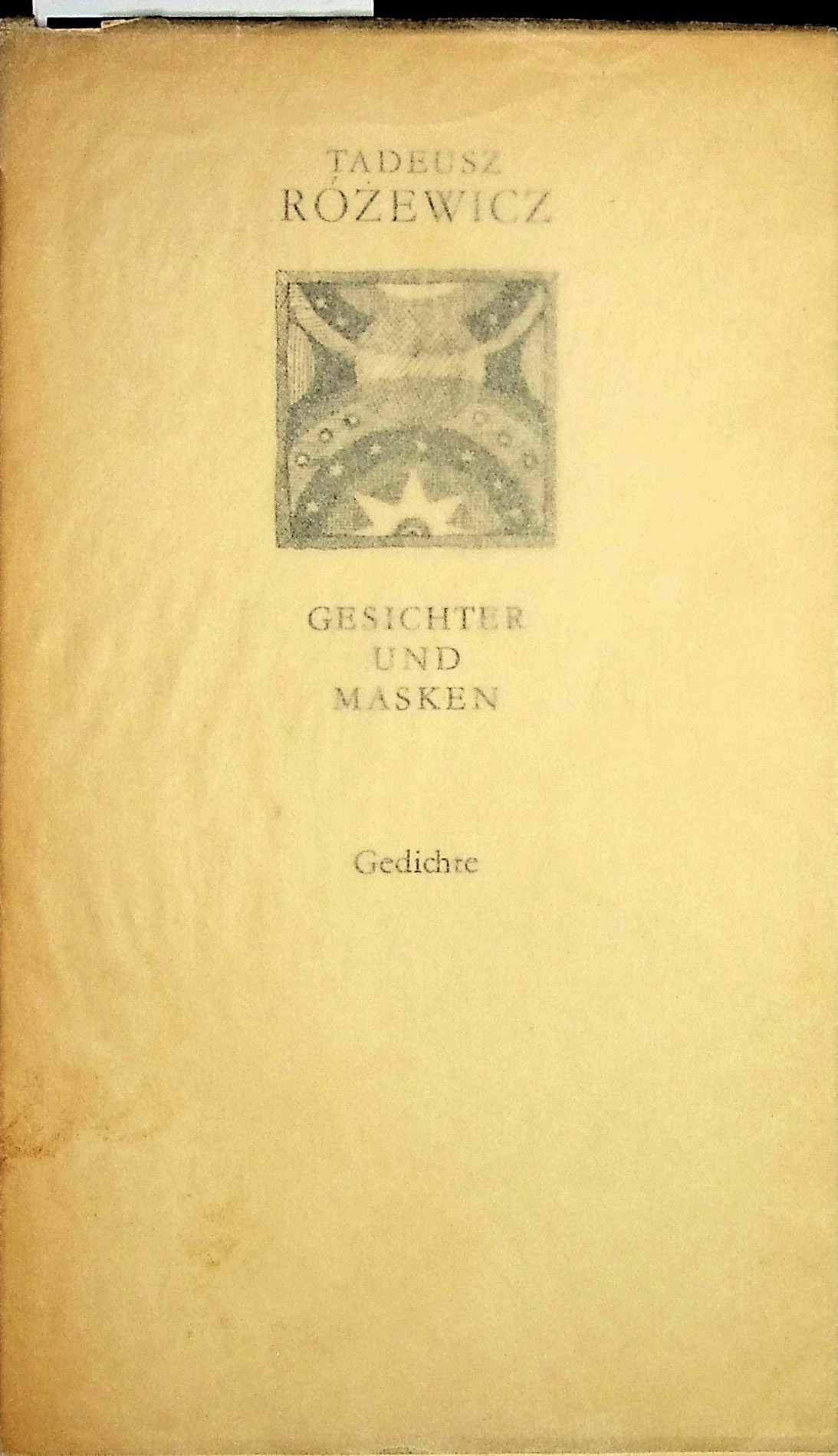


Neueste Kommentare