Wulf Kirsten
Der russische Dichter des silbernen Jahrzehnts Nikolai Aleksejevitsch Klujev [Kljujew, Клюев], Vertreter der sogenannten “neubäuerlichen” Richtung in der russischen Lyrik des XX. Jahrhunderts, ist am 10. (22) Oktober 1884 im abgelegenen nördlichen Dorf Koschtugi bei Wytegra des Olonetski Gouvernements (heutzutage Gebiet Wologda) in einer altgläubigen Bauernfamilie geboren. (…)
In den Jahren der ersten russischen Revolution (1905-1907) nahm Klujev aktiv an der revolutionären Bauernbewegung teil. Anfang 1906 wurde er wegen Agitation verhaftet, sechs Monate lang ins Gefängnis gesperrt und danach einige Zeit von der Geheimpolizei überwacht.
Vor der Oktoberrevolution erschienen weitere Gedichtbände von Klujev: „Die brüderlichen Lieder“ (1912), „Waldsagen“ (1913) und „Weltrauch“ (1916).
Nicht nur Block und Brüssov, sondern auch Gumiljow, Achmatowa, Gorodetsky, Mandelstam etc. haben diesen eigenartigen, großen Dichter bemerkt. 1915 lernte Klujev Sergej Jessenin kennen, der ihn in der Folge seinen Lehrer nannte. Um sie scharten sich Dichter der sogenannten neubäuerlichen (volkstümlichen) Richtung wie A. Belyj, S. Klychkov, Iwanow-Razumnik, P. Oreschin, A. Schirjajevez usw., die alle der Gruppe „Skythen“ angehörten.
(…)
Wegen seiner christlichen Anschauungen wurde Klujev 1920 aus der Partei der Bolschewiki ausgeschlossen. Statt Zeilen wie “Lenin hat den Wind und Sturm zum Engel gemacht”, schrieb er jetzt: “Wir glauben an vieläugige Brüder, Lenin dagegen an Eisen und den roten Geist”.
Nach dem Selbstmord von Jessenin hat Klujev das Gedicht „Ein Wehklagen über Sergej Jessenin“ (1926) verfasst, das aber kurz darauf verboten wurde.
Klujew trauert um ihn wie eine Mutter:
Du, mein Uhu klein, mein liebstes Vögelein!
Der Dichter sieht in Jessenin “ein Kind”, einen reinen Knaben vom Lande”, der als Opfer der Stadt fallen sollte, einer fremden und feindlichen Welt. Er ist sich im Klaren, dass die Machthaber die Volkspoesie nicht nötig haben: “Überall, wo der Hirt klopft – hört er nur das Bauchbrummen”.
(…)
Eine verhängnisvolle Rolle im Leben Klujevs hat der kritische Artikel von Leo Trotski gespielt, der 1922 in der Presse erschien. Jahrzehnte lang musste nun der Dichter mit dem Makel eines Kulakendichters weiterleben.
(…)
Am 5. Juni 1937 wurde Klujev in Tomsk verhaftet, angeblich – so führte die sibirische NKWD aus – wegen konterrevolutionärer Tätigkeit und Vorbereitung eines Aufstands gegen die sowjetische Macht, in dem man dem Dichter eine führende Rolle zuschrieb. Nach seinem Tod schenkte man viele Jahre der Darstellung Glauben, Klujev sei an der Station Taiga nach dem Verlust seines Koffers mit den Manuskripten an einem Herzanfall gestorben. In Wirklichkeit aber wurde der Dichter im Oktober 1937 (am 23. oder 25.) auf dem Kaschtatschberg in Tomsk erschossen.
Zwanzig Jahre lang bis zur Rehabilitierung 1957 wurde sein Name in der UdSSR nicht erwähnt, und erst 1982 erschien das erste posthume Buch. Während der Glasnostzeit wurden einige Werke von Klujev veröffentlicht, die man lange für verschollen gehalten hatte, vor allem das Poem «Pogorelschina», das der Dichter einst dem italienischen Slawisten Lo Gatto übergeben hatte. 1950 wurde es im Ausland publiziert. Ironie des Schicksals ist, dass Klujevs unvollendetes und verloren geglaubtes Hauptpoem «Das Lied von der großen Mutter» ausgerechnet in den Archiven der KGB erhalten blieb.
«Das Lied von der großen Mutter» spricht von der Herkunft des Dichters und seinen Vorfahren. Diese lebten im Lande der Vepsen, Saamen, Loparen und Karelen – finnougrische Völker des russischen Nordens.
(…)
Dem Rat von W. Kirsten folgend haben wir dem Biberacher Hartmut Löffel vorgeschlagen eine Klujev-Auswahl auf Deutsch zu präsentieren. Leider war der Übersetzter zu eifrig an die Tat gegangen. 2009 erschienen 28 von ihm übersetzte Gedichte in einer Buchform gedruckt (Kljuev N. «O Russland – das bist du!». Ausgewählte Gedichte, Russisch und Deutsch, übersetzt und herausgegeben von Hartmut Löffel. Wiesenburg-Verlag, Schweinfurt). Der Nachdichter, ein Verehrer von Heine und seiner modernen Schreibweise, hat die deutsche Tradition zu stark in die russische prosodische und äußerst individuell geprägte poetische Welt von Kljuev eingemeißelt. So dass dabei die unwiederholbare stilistische, inhaltliche und sprachliche Einzigartigkeit der Originaltexte verloren gegangen war und dem Leser ein moderner Dichter aller Völker und aller Zeiten präsentiert wurde (so der Eindruck eines deutschen Lesers). Man kann so eine Interpretation durch das Phänomen der sogenannten ästhetischen Interferenz erklären, wenn der nationale Kode einer heimischen Dichtung auf das fremdsprachige (-kulturelle) Literaturmodell übertragen wird und auf diese weise die sinntragende Integrität des fremden Stoffes verletzt wird. Leider waren wenige, doch positive Rezensionen auf dieses Buch, in erster Linie von der Wichtigkeit des unternommenen Projektes inspiriert, auf der Kühnheit des Übersetzers konzentriert, der Kopf über Hals das äußerst schwierige Material herangewagt hat, ohne über eine genügende sprachliche Kompetenz zu verfügen (Sieh. dazu: Данилевский Ю. Первый сборник стихотворений Н.А. Клюева в переводе на немецкий язык // Русская литература. № 4. 2011. С. 201–202; Rakusa I. Begnadeter russischer Sonderling // Neue Zürcher Zeitung. 18. März 2010. S. 50; Kasper K. Klopf ich beim Kerl, der Särge macht … // Neues Deutschland. 7. Juni. 2010. S. 15 // Osteuropa. N. 12. 2010. S. 143–144).
/ Auszüge aus einem Aufsatz von Tamara Kudryavtseva (Kudrjawzewa) bei Kuno
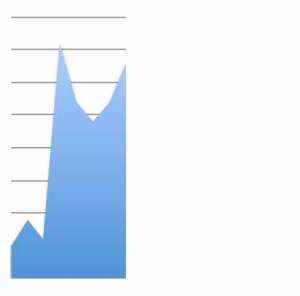


Neueste Kommentare