Lyrikzeitung & Poetry News
Das Archiv der Lyriknachrichten | Seit 2001 | News that stays news
Oktober
Rajzel Żychliński (* 27. Juli 1910 in Gąbin, damals Russisches Reich, heute Polen; † 13. Juni 2001 in Concord, Kalifornien), jiddischsprachige Dichterin.
OKTOBER
Der Hurensohn
Mojsche Drunterunddrüber
Fall tot um!
Eine alte Frau redet mit sich
und schimpft
mitten im Oktober-Blätterfall.
Die gelben Blätter fallen, fallen
von den Bäumen herab —
weil die alte Frau schimpft?
Oder weil sie müde sind?
Sie fallen, fallen gelb
vor ihre Füße.
oktober
The son of a bitch
mojsche kapojer
Drop dead!
an alte froj redt zu sich
un schilt
in mitn fun oktober-bleterfal.
di gele bleter faln, faln
fun di bejmer arop —
wajl di alte froj schilt?
zi wajl sej senen mid?
sej faln, faln gele
zu ire fiss.
Aus: Rajzel Żychliński: di lider. 1928-1991. Die Gedichte. Jiddisch und deutsch. Hrsg./Ü: Hubert Witt. Frankfurt/Main: Zweitausendeins, 2003, S. 530f
Seitdem die Welt verrohte
Else Lasker-Schüler
Mein blaues Klavier
Ich habe zu Hause ein blaues Klavier
Und kenne doch keine Note.
Es steht im Dunkel der Kellertür,
Seitdem die Welt verrohte.
Es spielten Sternenhände vier –
Die Mondfrau sang im Boote.
– Nun tanzen die Ratten im Geklirr.
Zerbrochen ist die Klaviatür.
Ich beweine die blaue Tote.
Ach liebe Engel öffnet mir
– Ich aß vom bitteren Brote –
Mir lebend schon die Himmelstür,
Auch wider dem Verbote.
Make it new
Neu machen
Rabbi Eliezer said “prayer ‘fixed’? “his supplication bears no fruit ........................... the question next came up: what is F I X E D? Rabba & Rabbi Yosef answered “whatever blocks the will “to MAKE IT NEW (Talmud)
Aus dem Babylonischen Talmud, Berachot 28b / 29b. Übersetzt von Jerome Rothenberg und Harris Lenowitz aus: Jerome Rothenberg, Harris Lenowitz (Ed.): Exiled in the Word: Poems & Other Visions of the Jews from Tribal Times to Present. With Commentaries by Jerome Rothenberg. Port Townsend, Washington: Copper Canyon Press, 1989.
Rabbi Eliezer sagte "Gebet 'festgelegt'? "dann wird sein Bitten nicht erhört ............................ als nächstes kam die Frage auf: was heißt festgelegt? Rabba & Rabbi Yosef antworteten "alles was uns hindert "es NEU ZU MACHEN (TALMUD)
Rothenberg und Lenowitz schreiben in einer Anmerkung: Vgl. Ezra Pound, Canto 53:
Tching prayed on the mountain and wrote MAKE IT NEW on his bath tub. Day by day make it new
Deutsch von Eva Hesse:
Tching betete auf dem Berge und schrieb MACH ES NEU auf seine Badewanne Tag für Tag mach es neu
Aus: Ezra Pound: Die Cantos. Hrsg. Manfred Pfister, Heinz Ickstadt. Zürich: Arche, 2012, S. 411/413
(Kaiser Tching Tang, 1766-1753 v.u.Z., schrieb „Mach es neu“ auf seine Badewanne. Er galt als guter Kaiser, der in einer Dürreperiode Geld drucken ließ, damit die Leute Getreide kaufen konnten. Aber erst nachdem der Himmel seine Gebete erhört und Regen gespendet hatte.)
Aktualisierte Version 1989/2017
Rabbi Elieser sagte wer am Wortlaut klebt dessen Wollen wird nicht erhört .............................. bleibt die Frage, was heißt am Wortlaut kleben? Rabba & Rabbi antworteten wenn wir es nicht mehr NEU MACHEN KÖNNEN
Etwas mehr originaler Kontext in einer anderen englischen Übersetzung des Talmud:
Rabbi Eliezer says: One whose prayer is fixed, his prayer is not supplication and is flawed. The Gemara will clarify the halakhic implications of this flaw.
We learned in the mishna that Rabbi Eliezer says: One whose prayer is fixed, his prayer is not supplication. The Gemara asks: What is the meaning of fixed in this context? Rabbi Ya’akov bar Idi said that Rabbi Oshaya said: It means anyone for whom his prayer is like a burden upon him, from which he seeks to be quickly unburdened. The Rabbis say: This refers to anyone who does not recite prayer in the language of supplication, but as a standardized recitation without emotion. Rabba and Rav Yosef both said: It refers to anyone unable to introduce a novel element, i.e., something personal reflecting his personal needs, to his prayer, and only recites the standard formula.
ר‘ אליעזר אומר העושה תפלתו קבע וכו‘: מאי קבע א“ר יעקב בר אידי אמר רבי אושעיא כל שתפלתו דומה עליו כמשוי ורבנן אמרי כל מי שאינו אומרה בלשון תחנונים רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו כל שאינו יכול לחדש בה דבר
schpil mir a lidele af jidisch
שפּיל מיר א לידעלע אף ײדיש
schpil sä mir a lidele af jidisch
Text: Josef Kotliar (1908-1962)
Spiel mir ein Lied in Jiddisch,
erwecken soll es Freude, nicht eine Überraschung.
Weil alle groß und klein sollen das verstehen können,
von Mund zu Mund das Lied soll gehen, oj, oj, oj
Spiel, spiel, Musikant spiel,
weißt doch was ich mein und was ich will.
Spiel, spiel, spiel ein Lied für mich,
spiel ein Lied mit Herz und mit Gefühl.
schpil sä mir a lidele af jidisch,
derwekn sol es frejd nit kejn chidesch.
as ale grojs un klejn, soln kenen dos farschtejn.
fun mojl zu mojl dos lidele sol gejn, oj, oj, oj.
schpil, schpil, klezmer, schpil,
wejst doch wos ich mejn un wos ich wil.
schpil, schpil, schpil a lidele far mir,
schpil a lidele mit harz un mit gefil.
Play me a little song in Yiddish
May it wake joy and no surprises,
So everyone, young and old, can understand it.
Let the song go from mouth to mouth!
Play, musicians, play –
You know what I have in mind and what I want.
Play a little song for me –
Play a little song with heart and feeling.
Josef Kotliar (Iosif Solomonovich Kotlyar, Иосиф Соломонович Котляр), geboren in Berditschew (Russisches Reich, heute Ukraine). Nach dem Zweiten Weltkrieg lebte er in Vilnius.
Um mein Land zu versüßen, o Walt Whitman
Jorge de Lima (1895-1953)
Demokratie
Hängematten wiegten meinen Gesang ein,
um mein Land zu versüßen, o Walt Whitman.
Jenipapo färbte meinen Körper gegen den bösen Blick,
Katechismus lehrte mich den Gast zu umarmen,
Kiefernnadeln nährten mich, als ich ein Kind war.
Negermutter erzählte mir Tiergeschichten,
Negerjunge brachte mir Schamlosigkeiten bei,
Panierfleisch, Tapioka, Puffreis, alles aß ich,
ich trank Zuckerrohrschnaps mit Cajúnüssen zur inneren Reinigung‚
bekam Wechselfieber, Frieseln und Lymphdrüsenschwellung,
Hakenwürmer, Sehnsucht, Gedichte;
ich wurde mondsüchtig, verhext und schwenkte die Negerrassel, ‚
redete Unsinn, spielte mit den halbschwarzen Mädchen,
sah Gespenster, Aberglauben, Wassermütter,
sprach mit den Verrückten, sprach mit mir allein,
schwängerte alles, was mir über den Weg lief,
umarmte die Schlange im Buschwald,
vermischte mich, versteckte mich, gab mir den Rest,
um eine gesegnete Seele zu retten
und meinen safranbemalten Leib, tätowiert mit Kreuzen, mit Herzen, mit verbundenen Händen,
mit Liebesnamen in allen Sprachen von Weißen, Mohren oder Heiden.
(1927)
Aus: Brasilianische Poesie des 20. Jahrhunderts. Hrsg./Ü Curt Meyer-Clason. München: DTV, 1975, S. 50
Gedicht mit sieben Gesichtern
CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE
(31. Oktober 1902, Itabira, Minas Gerais, Brasilien – 17. August 1987, Rio de Janeiro)
Gedicht mit sieben Gesichtern
Als ich geboren wurde, sagte ein scheeler Engel,
einer von denen, die im Dunkeln hausen,
zu mir: Los, Carlos, sei linkisch im Leben!
Die Häuser belauern die Männer,
die hinter den Frauen herlaufen.
Der Nachmittag wäre vielleicht blau,
gäbe es nicht so viele Wünsche.
Vorbeifährt die Straßenbahn, voller Beine:
weiße schwarze gelbe Beine.
Wozu so viele Beine, mein Gott, fragt mein Herz.
Aber meine Augen
fragen nichts.
Der Mann hinter dem Schnurrbart
ist ernst, schlicht und stark.
Er redet kaum.
Wenige seltene Freunde hat der Mann
hinter der Brille und dem Schnurrbart.
Mein Gott, warum hast du mich verlassen,
wenn du wußtest, daß ich nicht Gott war,
wenn du wußtest, daß ich schwach war.
Welt Welt weite Welt,
Wär mein Name Türkenfeld,
nicht Lösung wär’s, nur Reim und Scherz.
Welt Welt weite Welt,
weiter aber ist mein Herz.
Ich dürfte es dir nicht sagen:
aber dieser Mond,
dieser Cognac,
machen einen teuflisch sentimental
(1925)
Aus: Brasilianische Poesie des 20. Jahrhunderts. Hrsg./Ü Curt Meyer-Clason. München: DTV, 1975, S. 90
Ich habe die Veränderung nicht bemerkt
Cecília Benevides de Carvalho Meireles (* 7. November 1901 in Rio de Janeiro; † 9. November 1964 ebenda), brasilianische Lyrikerin
CECILIA MEIRELES
Porträt
Ich hatte nicht dieses Gesicht von heute,
so still, so traurig, so mager,
auch nicht diese leeren Augen,
nicht die bittere Lippe.
Ich hatte nicht diese kraftlosen Hände,
so reglos und kalt und tot;
ich hatte nicht dieses Herz,
das sich nicht einmal zeigt.
Ich habe die Veränderung nicht bemerkt,
die so einfach war, so genau, so leicht;
— In welchem Spiegel ging
mein Antlitz verloren?
1929
Aus: Brasilianische Poesie des 20. Jahrhunderts. Hrsg./Ü Curt Meyer-Clason. München: DTV, 1975, S.67
ein und alles
Konrad Bayer (* 17. Dezember 1932 Wien; † 10. Oktober 1964 Wien)
ein und
ein und
ein und
ein und
ein und
ein und
ein und
ein und
ein und
ein und
ein und
ein und
ein und
ein und
ein und
ein und
ein und
ein und
ein und
ein und
ein und
ein und
ein und
ein und
ein und
ein und
ein und
ein und
ein und
ein und
ein und
ein und
ein und
ein und
ein und
ein und
ein und
ein und
Konrad Bayer: Sämtliche Werke. Hrsg. Gerhard Rühm. Win:ÖBV / Klett-Cotta, 1996, S. 462
nachwort
alles kann dies und jenes heissen.
alles mag auch etwas anderes heissen.
der apfel zwischen den zähnen ist geschmack.
der stein auf meinem schädel ist ursache einer beule.
die dame vor deinen augen ist einstweilen noch ein anblick.
Ebd. S. 530
Johannes Theodor Baargeld (Zentrodada)
26 DOCH SIMPEL
26 Lautzeichen, I guess, allerdings als Handhabe errungenschaftlich simpel. Wer erwärmte sich nicht für sich, um rein dazustehen. Adonismus, jene verschämte Hilfsstellung der zwei Finger, mag hier als Infantilperversion das präejakulative Erkenntnis noch aufkitzeln. Auf jeden Fall: Was jene sozialen Fertigkeiten anbelangt, wird man sich doch wohl noch als Brennscheere denken können, und sieht sich zwangsläufig das Befriedigungsalphabet nach bestem Können zur Weltanschauung ondulieren. Es ist wesentlich, als Maßstab dort das Können tierstimmimitatorisch bauchzujodeln, wo es nur terminologisch vorhanden und als Reflexion (secretio interior impotentiae) gesellschaftswertet wird, um festzustellen, daß diesartige Reflexionen lediglich die lustreiberische Auskosung jener spärlichen Nurnochreizanläufe sind, die man sich noch für eine zeitlang mit verstohlener Koketterie zuspricht. Also von vulgärster Langeweile und bestenfalls erträglich verlogen.
(1920)
Johannes Theodor Baargeld: Texte vom Zentrodada. Hrsg. Walter Vitt. Nachwort Karl Riha. Siegen 1988 (Vergessene Autoren der Moderne XXX), S. 18
L&Poe 22 | Oktober 2017
Liebe L&Poe-Leserinnen und -Leser,
 seit Ende 2000 gibt es die Lyrikzeitung, 15 Jahre als Tageszeitung, jetzt als Magazin mit Nachrichten aus der Welt der Poesie und der Poesie der Welt. Poetry is news that stays news, sagt Pound. Aktuelles: Gomringerdebatte: Was bisher geschah. Wer liest heute Arndt? Gestorben sind Kito Lorenc, John Ashbery und viele Lyriker aus allen Weltteilen. Neue Texte von Moritz Gause, Angelika Janz, Martina Kieninger und José F.A. Oliver. Dies und mehr: Lesen! Kommen Sie jeden Tag vorbei, täglich um 6 ein nicht immer neues aber frisches Gedicht.
seit Ende 2000 gibt es die Lyrikzeitung, 15 Jahre als Tageszeitung, jetzt als Magazin mit Nachrichten aus der Welt der Poesie und der Poesie der Welt. Poetry is news that stays news, sagt Pound. Aktuelles: Gomringerdebatte: Was bisher geschah. Wer liest heute Arndt? Gestorben sind Kito Lorenc, John Ashbery und viele Lyriker aus allen Weltteilen. Neue Texte von Moritz Gause, Angelika Janz, Martina Kieninger und José F.A. Oliver. Dies und mehr: Lesen! Kommen Sie jeden Tag vorbei, täglich um 6 ein nicht immer neues aber frisches Gedicht.
Die Themen in dieser Ausgabe
- [NEUE TEXTE]
- Moritz Gause: Gedicht
- Angelika Janz: Belichtetes Papier oder Er denkt an sein Land
- Angelika Janz: Offener Brief an den Bundespräsidenten
- Martina Kieninger: Schwarze Mamba
- Martina Kieninger: Gedicht
- José F. A. Oliver Amerikanisch und Deutsch
- Àxel Sanjosé: Verstreute Übersetzungen aus dem Katalanischen, Spanischen und Französischen
- Sibylla Schwarz Deutsch und Niederländisch
- UMSCHAU UND KRITIK
- PRESSESCHAU
- NACHRICHTENSTRECKE
- Poesiefest im Düsseldorfer Literaturhaus – Poesie-Debütpreis
- Lyrikpreis München 2017
- Kurz berichtet
- Gestorben
- ZUGUTERLETZT
- Neue Zeitschriften
- Lyrikkalender
- Poetopie
- Ein paar Lesetipps zum Schluß
[✺]
NEUE TEXTE
Moritz Gause
in der ubahn reden sie wieder
über politik, über kapitalkonzentration.
so schlecht sind wohl die zeiten nicht.
meine verlobte trennt sich von mir
wegen eines alten gedichts.
es scheint kein gedicht zu geben,
um es rückgängig zu machen,
ich kaufe etwas zu essen,
das ich nicht schmecken muss.
wir hatten pläne.
es war doch alles so gut.
am alex höre ich nur
das echo der durchsagen.
ich war noch nie so bereit
für eine schlägerei, wie heute.
doch die einzigen, die mit mir sprechen
sind ein verwirrter intellektueller
und zwei geflüchtete elektroingenieure
aus dem libanon
die hasch mit mir rauchen
und mir halt geben.
Angelika Janz: Belichtetes Papier oder Er denkt an sein Land

Es galt, die dunkelsten Stellen auf dem Papier abzulichten. Gefahren warten nur auf jene, die nicht auf das Leben reagieren. Es galt, die Grenzen des Sagbaren – oder Unsagbaren – immer weiter hinauszutreiben, in Regionen, in denen ihre Sprache eine eigene Wirklichkeit schuf. Das Wissen über den Glauben war verloren gegangen, der Glaube an das Wissen überlebte. Am Ende galt es, den Glauben an das Wissen durch das Wissen selbst zu verlieren.
Das Blatt, das die Kopiermaschine ansaugte, gemäß ihrer Bestimmung, die dunkelsten Stellen auf dem Papier abzulichten, war leer. Oder nicht? Als es wieder hinaus glitt, war es ein anderes. Es war markiert. Die erwartete Kopie des Originals blieb aus. Die Maschine signalisierte einen Defekt.
Ich griff nach dem Original. Nach dem, was ich für das Original hielt. Dort gab es in der Mitte des Blattes eine dunkle Zeile, Buchstaben, die an den Rundungen unterbrochen waren, wieder ins Weiße hinein. Das Wort ließ sich lesen, es hieß Wiederholung. Das aber war nicht meine Wort.
Seit einigen Tagen kopierte ich in dem Büro am Mariannenplatz das Material für eine kleine Publikation visueller Poesie. Diesen Fragmenten ging es wie dem letzten Menschen eines ausgestorben geglaubten Stammes, den es erklärungslos in die westliche moderne Welt verschlagen hatte und der, von ein paar Sonnenstrahlen getroffen, dort erwacht. Ich hatte Monate zuvor einen Roman darüber geschrieben, ihn in eine kleine Holzkiste gepresst und diese für immer zugenagelt.
(…)
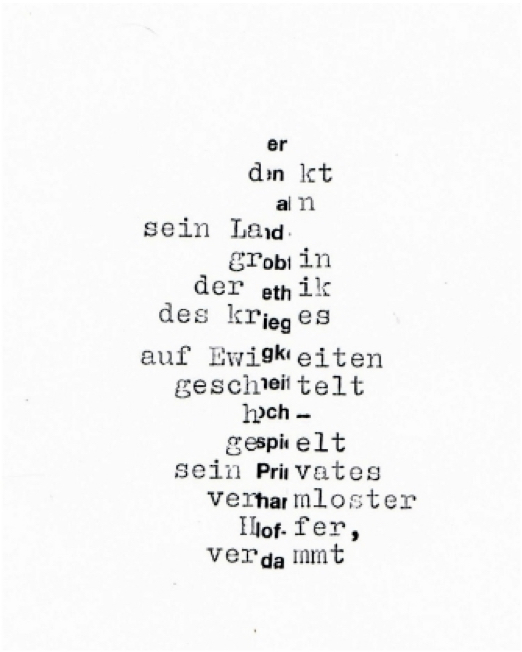 Den vollständigen Text von Angelika Janz finden Sie hier.
Den vollständigen Text von Angelika Janz finden Sie hier.
Angelika Janz: Offener Brief
Sehr geehrter Herr Bundespräsident!
Ich schreibe Ihnen, während ich die Sendung von Anne Will zur Frage ostdeutschen AfD-Wahlüberhangs per Kopfhörer verfolge.
Dieser Brief soll kein „Jammerbrief“ werden, sondern Ihnen Analysen aus der betroffenen Region schildern – er richtet sich „eigentlich“ auch an JEDEN, der an der gegenwärtigen Stimmung in der BRD interessiert ist, der viele Details über eine ziemlich vergessene Region am Rande der Republik enthält, in der ich seit 25 Jahren lebe. So bitte ich Sie als ein Kenner sozio-kultureller Verhältnisse im Land, diesen Brief wirklich zu lesen.
Ich bin Ihnen für Ihre Rede zum Tag der Deutschen Einheit dankbar, weil Sie dem Begriff der „Heimat“ einen neuen Akzent im Hinblick auf die Zukunft nachfolgender Generationen hinzugefügt haben – gegen jene Mauern, von denen Sie gesprochen haben in unserem Land. So möchte ich Ihnen hier über eine Mauer zwischen der Realpolitik und Wirtschaft und dem ländlichen „Lebenswert-Raum“ berichten.
Martina Kieninger: Schwarze Mamba
Aus dieser Wohnung, die vor einigen Jahren auch mir gehörte, die ich verlassen habe mit all ihrem Mobiliar, dem Sofa aus Kunstleder, der dunklen Kredenz, der Esszimmergarnitur – ein sehr geschontes Mobiliar, immer noch liegen die Schutzhüllen aus Plastikfolie über den rotsamtnen Sitzflächen der geschnitzten Stühle – aus unserer Wohnung zog ich zu ihr.
Es ist nicht einmal auszuschliessen, dass ich sie, meine Ex, wegen dieser Plastikhüllen über den Samtsitzen verlassen habe. Diese Hüllen: sie wirkten auf mich wie materialisierte Übervorsichtigkeit, eine Schonhaltung dem Leben gegenüber, abwaschbare Lebensangst, ein Leben wie nicht gelebt, das mich in die Zimmerfluchten des Palacio Salvo verschlug, in ein umfunktioniertes Hotelzimmer mit marmornen Mosaikböden, altmodisch hohen Zimmerdecken, schmalen Fenstern. / Weiter
[zurück]
[✺]
Martina Kieninger
aldehyd alkahest –
lege die Tiere. Das stille Getier, sie sollen nicht wieder, sie sollen nicht kehren noch wissen von Mitteln (in Klammer: Formaldehyd), so lege. Sie sollen nicht kehren – nicht wieder. Im Quaderglas liegt wie in Armen das Haiweib, Formaldehyd trägt sie gleich einem Kinde, so ruht sie im Bade (Embryonenbad) schwebend. Sich jährend wie Fisch im Formaldehyd. Molekülgleich lösen sich Flügel und Schwanz zur vielfachen Aldehydfischverbindung, es gleiten die Menschen durch Zeit wie der Fisch durch die Lösung, im Lippenloch steckt noch dem Haiweib das Lachen wie ne schnelle Zigarette, und soll nicht. Die in Mitteln sich lösen, zum Wort zerfallen, sollen nicht kehren als Tiere aus Schlammaldehyd, sie sollen in Schlieren in Blasen und Blister ungenau flocken im Quader – nur Augen im Spiel, geworfen wie Würfel im sich trübenden Glas. Wort Zahl Kopf, das fällt wie ein Tier aus dem Tierkreis, Apothekenhai –, ein Tierkreistier zur Erbauung der Menschheit im Quader gelöst zum Tierschlamm, dort punzt die Zeit. Wie ein Stiefeltritt das Tieraldehyd in den Schlamm. Wo fängt das Tier an, so fragt sich, wo flockt Schlamm und die Flügel des Hais, Kraft der Poesie – so fragt sich und sagt es das Kind. Ein tiefes Kind sagt es der Tierform des unterm Stiefeltritt, hineingepunzt ins Quaderglas – Kopf, Schwanz, ganz – es soll aus den Teilen, den nieder, vom Stiefel in Schlamm getretnen, es solle werden und kehren aus Teilen das Tier – so zieht das Kind das Lyrik-Ich des sich Lösenden, des Stiefelgetretenen aus dem Quaderglas verspricht zwei Flügel ihm, der Fischschwanz hebt sich aus dem Schlamm und fliegt davon. Wie Vögel übers Meer so fliegt er so ewig wie Licht, das von Spiegel zu Spiegel geworfen nicht wieder wird kehren.
José F.A. Oliver: Amerikanisch und Deutsch
umherstreifendes gedicht abend verglückt mit diesem flammen- werfer / schattenstreuner [EL SOL] 1 maskulines 1 dürre hälfte buchstabiert sein weibliches feuer- pendant [DIE SONNE] lockt himmelsblätter vor & lichtgeronnen 1 lunares heft / sprachluftsaiten ungebunden. 1 pastellgüte der farben : mond & feminin. Irgendwo 1 schiffsschraube 1 weither / monotones ferneisen & die erzählbaren geschichten / „hör den vorüberheiten zu” sagte großvater: „dem meer die lautschrift abringen” siempre la mar & die kielspur [Machado] : die kielspur der lautschrift
straggling poem evening de:lights with this flame- thrower / shadows estray [EL SOL] 1 masculine 1 barren half spells his feminine fire- companion [DIE SONNE] elicits leaves from on high & lightclotted 1 lunar binder / wordwindnotes unbound. 1 pastel mallowness of colors : moon and feminine. Somewhere 1 ship propeller 1 afar / monotone tramping iron & the tellable stories / “listen to what past by” said grand-father: “to wrest the sounds of letters from the sea” siempre la mar & the fading wake [Machado] : the fading wake of written sounds
Deutschsprachiges Original aus: José F.A. Oliver. finnischer wintervorrat. Gedichte. Suhrkamp. Frankfurt a.M. 2005
Übersetzung: José F.A. Oliver. sandscript. Selected Poetry 1987-2018. Translated by Marc James Mueller. White Pine Press. Buffalo / New York 2018
Àxel Sanjosé: Verstreute Übersetzungen und Kommentare
Gedichte von Joan Maragall, Màrius Torres, San Juan de la Cruz, Luis de Góngora, Ramón de Campoamor, Antonio Machado und Charles Baudelaire.
Joan Maragall (1860-1911)
Ode an Spanien
Hör, Spanien – die Stimme eines Sohnes,
der mit dir spricht – in nicht-kastillischer Sprache;
ich spreche in der Sprache – die mir
die rauhe Erde gab:
In dieser Sprache – redeten wenige mit dir,
allzu viele in der anderen.
Zu viel haben sie geredet – von den Saguntern*
und von jenen, die fürs Vaterland sterben:
dein Ruhm – und deine Erinnerungen,
Erinnerungen und Ruhm – stammen von Toten:
du lebtest traurig.
Ich will mit dir reden – auf ganz andre Art.
Warum nutzlos das Blut vergießen?
In den Adern – Leben ist das Blut,
Leben für die Heutigen – und für die Kommenden:
Vergossen, ist es tot.
Zu viel dachtest du – an deine Ehre
und zu wenig an dein Leben:
tragisch führtest du – zum Tod die Söhne,
hattest Gefallen – an Totenehrungen,
und deine Feste waren – die Begräbnisse,
trauriges Spanien!
Ich sah die Schiffe – randvoll auslaufen
mit deinen Kindern, die du – zum Sterben führtest:
sie gingen lächelnd – ins Ungewisse;
und du, du sangst – am Meeresufer
wie eine Irre.
Wo sind die Schiffe? – Wo sind die Söhne?
Frage den Westwind, die Sturmeswoge:
alles verlorst du – niemanden hast du.
Spanien, Spanien, kehr zurück zu dir,
brich aus in Mutterweinen!
Rette, oh rette dich – vor so viel Übel,
möge das Weinen dich fruchtbar machen, froh und lebendig;
denk an das Leben, das um dich ist:
hebe die Stirn,
lächle den sieben Farben zu, die in den Wolken sind.
Wo bist du, Spanien? – Ich seh dich nirgends.
Hörst du denn nicht mein lautes Rufen?
Verstehst du diese Sprache nicht – die in Gefahren zu dir spricht?
Hast du’s verlernt, deine Kinder zu verstehen?
Lebwohl, Spanien!
ODA A ESPANYA
Escolta, Espanya, – la veu d’un fill
que et parla en llengua – no castellana:
parlo en la llengua – que m’ha donat
la terra aspra:
en’questa llengua – pocs t’han parlat;
en l’altra, massa.
T’han parlat massa – dels saguntins
i dels que per la pàtria moren:
les teves glòries – i els teus records,
records i glòries – només de morts:
has viscut trista.
Jo vull parlar-te – molt altrament.
Per què vessar la sang inútil?
Dins de les venes – vida és la sang,
vida pels d’ara – i pels que vindran:
vessada és morta.
Massa pensaves – en ton honor
i massa poc en el teu viure:
tràgica duies – a morts els fills,
te satisfeies – d’honres mortals,
i eren tes festes – els funerals,
oh trista Espanya!
Jo he vist els barcos – marxar replens
dels fills que duies – a que morissin:
somrients marxaven – cap a l’atzar;
i tu cantaves – vora del mar
com una folla.
On són els barcos. – On són els fills?
Pregunta-ho al Ponent i a l’ona brava:
tot ho perderes, – no tens ningú.
Espanya, Espanya, – retorna en tu,
arrenca el plor de mare!
Salva’t, oh!, salva’t – de tant de mal;
que el plô et torni feconda, alegre i viva;
pensa en la vida que tens entorn:
aixeca el front,
somriu als set colors que hi ha en els núvols.
On ets, Espanya? – no et veig enlloc.
No sents la meva veu atronadora?
No entens aquesta llengua – que et parla entre perills?
Has desaprès d’entendre an els teus fills?
Adéu, Espanya!
*) „Nach dem im Vorfeld des Krieges zwischen Rom und Karthago geschlossenen Vertrag zur Aufteilung der Interessensphären (Ebro-Vertrag) fiel Sagunt in die karthagische Interessensphäre und die Karthager glaubten somit, das Recht zu haben, Sagunt zu erobern. Ihr monatelanger Widerstand, über den Livius berichtet, ist der eine kurze Strahl historischen Ruhms der Stadt. 218 v. Chr. eroberte Hannibal die Stadt und zog nach Italien weiter. Über den Fall von Sagunt handelnde lateinische Texte sind sehr häufig. (…) Die Stadt wurde auf Katalanisch Molvedre, auf Spanisch Morviedro genannt, beides nach dem Lateinischen muri veteres, alte Mauern. Sagunts Abstieg begann mit dem Aufstieg von Valencia. 1098 wurde sie kurz von El Cid besetzt, die endgültige Rückeroberung musste aber bis 1238 warten, bis zu König Jakob I. von Aragón.
Während der Napoleonischen Kriege auf der Iberischen Halbinsel besiegten am 25. Oktober 1811 in der Schlacht von Murviedro (Sagunto) die Franzosen unter Louis-Gabriel Suchet eine spanische Armee unter General Joaquín Blake y Joyes. Sie sollte die seit Monaten belagerte Festung entsetzen. Am Tag darauf kapitulierte Murviedro vor Suchet.“ https://de.wikipedia.org/wiki/Sagunt
Màrius Torres (1910–1942)
NIT D’AGOST Ara, la nit s’acosta tant, al fons del meu cor, que el seu somriure sembla una resposta —una resposta que digués: Estem d’acord—. Però la ment ignora a què em respon així... —Oh, calla, dolça nit enganyadora; no és cert que ara de tot em diries que sí?—
Nacht im August Jetzt kommt die Nacht meinem Herzensgrund so nah, dass ihr Lächeln eine Antwort scheint – eine Antwort die etwa lautet: Abgemacht –. Aber der Kopf weiß nicht, worauf sie Antwort gibt … – Ach schweig, süße Nacht, so trügerisch; du würdest doch jetzt zu allem ja sagen, nicht? –
Màrius Torres (30.8.1910–29.12.1942) war ein katalanischer Lyriker.
Er stammte aus einer bürgerlichen Familie in der Bezirkshauptstadt Lleida; der Vater war Abgeordneter im katalanischen Parlament. Nach seinem Schulabschluss studierte Torres Medizin in Barcelona. Er interessierte sich schon früh für Literatur und schrieb in der Schul- und Studienzeit erste Stücke.
1935 erkrankte er an Tuberkulose und kam in das Puigdolena bei Sant Quirze de Safaja (Provinz Barcelona), das er bis zu seinem Tod nicht mehr verlassen sollte. Hier vertiefte er seine Beschäftigung mit Literatur und schrieb den größten Teil seines poetischen Œuvres. Er lernte Mercè Figueres kennen, eine Mitpatientin, der er die Gedichtfolge „Cançons a Mahalta“ widmete, die zu seinen berühmtesten Werken gehören. Über sie begegnete er dem Schriftsteller Joan Sales, zu dem eine enge Freundschaft entstand; Sales besorgte posthum die erste (und lange Zeit einzige) Ausgabe seiner Gedichte.
Màrius Torres wird als Postsymbolist bezeichnet, was meiner Ansicht nach, jenseits des Etikettierungszwangs, recht treffend ist. Er ist kein Treiber der Moderne, sondern ein eher kontemplativer Betrachter des Werdens und Vergehens, der seine eigene Vergänglichkeit deutlich spürte und thematisierte. Zugleich setzte er mit seiner Lyrik einen Kontrapunkt zur trostlosen, schäbigen Wirklichkeit der Bürgerkriegszeit und des beginnenden Franquismus. Ende der 1960er Jahre wurde Màrius Torres von einer breiteren Leserschaft im katalanischsprachigen Raum entdeckt.
Aus dem Spanischen
San Juan de la Cruz
Àxel Sanjosé hat das Lied des Heiligen Johann vom Kreuz / San Juan de la Cruz (Fassung siehe hier) neu übersetzt. Er schreibt dazu:
die vorgehensweise:
so viel an semantischen und syntaktischen strukturen wie möglich erhalten
die gebundenheit (im spanischen: silbenzahl und reim) durch entsprechend natürliche mittel im deutschen andeuten: jamben und alternanz von weiblichen und männlichen kadenzen, assonanz wenn möglich (auch erweiterte assonanz, z.b. hohe vs. tiefe vokale oder vordere vs. hintere)
hier die strophenform der »lira« (drei siebensilber und zwei elfsilber in der konstellation 7-11-7-7-11) auf versfüße übertragen: 3-5-3-3-5 jamben. der reim läuft aber a-b-a-b-b, was man in der übertragung natürlich weniger merkt. entscheidend jedoch ist die kurz-lang-rhythmik.
entscheidend ist für mich, dass ein gefühl vom originären text rüberkommt.


Luis de Góngora
Die erste Strophe der „Soledades“:
Es war des Jahres Zeit der Blüten in der Europas lügenreicher Räuber – der halbe Mond die Waffen seiner Stirn, die Sonne ganz die Strahlen seiner Haare –, leuchtende Himmelsehre, auf Saphirfeldern Sterne grast, da jener, der wohl besser noch den Becher Jupiter reichen konnte als der Bursch aus Ida, schiffbrüchig, abgewiesen, in der Fremde voll Tränen Liebesklagen richtet süße ans Meer, bewegt es so, dass für die Wogen, für den Wind sein jammervolles Seufzen ein zweites wurde süßes Arion-Instrument.
Góngoras Originaltext:
Era del año la estación florida en que el mentido robador de Europa (media luna las armas de su frente, y el Sol todos los rayos de su pelo), luciente honor del cielo, 5 en campos de zafiro pace estrellas, cuando el que ministrar podía la copa a Júpiter mejor que el garzón de Ida, náufrago y desdeñado, sobre ausente, lagrimosas de amor dulces querellas 10 da al mar, que condolido, fue a las ondas, fue al viento el mísero gemido, segundo de Arïón dulce instrumento.
Ramón de Campoamor (1817-1901)
¡Ay! ¡Ay!
Más cerca de mí te siento
cuando más huyo de ti,
pues tu imagen es en mí,
es en mí,
sombra de mi pensamiento,
sombra de mi pensamiento.
¡Ay! Vuélvemelo a decir,
vuélvemelo a decir
pues embelesado ayer
te escuchaba sin oír
y te miraba sin ver,
y te miraba sin ver. ¡Ay!
Ach! Ach!
Näher fühl ich mich bei dir,
umso mehr ich von dir flieh,
denn dein Bild das ist in mir,
ist in mir,
Schatten meines eignen Denkens,
Schatten meines eignen Denkens.
Ach! Sag’s noch einmal zu mir,
sag es noch einmal zu mir,
gestern nämlich, ganz betört
lauscht ich dir, ohne zu hörn
schaut’ dich an ohne zu sehn,
schaut’ dich an ohne zu sehn. Ach!
António Machado
die ausgangslage ist klar: achtsilber (bei männlicher kadenz, hier also in den geraden zeilen: siebensilber) angeordnet in der romance-form, also: nicht-reimende zeilen abwechselnd mit assonant, also lediglich durch übereinstimmung des betonten vokals reimende zeilen, hier auf [a]: nada más / andar / atrás / mirar / en la mar. dass de facto más/atrás und ebenso andar/mirar/mar reine (konsonante) reime sind, ist eher zufällig, liegt daran, dass es im spanischen einen haufen wörter mit diesen endungen gibt.
für das deutsche habe ich mich für folgendes entschieden: die ohnehin recht lose reimstruktur gebe ich durch abwechselne weibliche und männliche kadenz wieder (was auch der spanischen prosodie entspricht), ansonsten erlaube ich den zeilen entweder vierhebig trochäisch oder dreihebig daktylisch zu sein, was in meinen ohren durchaus geht. das wars dann schon.
Caminante, son tus huellas
el camino, y nada más;
caminante, no hay camino,
se hace camino al andar.
Al andar se hace camino,
y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.
Caminante, no hay camino,
sino estelas en la mar.
Wanderer, hier deine Spuren
sind der Weg, ansonsten nichts;
Wanderer, ’s gibt keine Wege,
Wege macht man nur beim Gehn.
Nur beim Gehn macht man die Wege
und wirfst du den Blick zurück,
siehst du den Pfad, den du niemals
je wieder betreten wirst.
Wanderer, ’s gibt keine Wege,
außer Kielwasser im Meer.
ps: statt „Wanderer, ’s gibt keine Wege“ (Z. 3 u. 9) geht metrisch auch „Wand’rer, es gibt keine Wege“. wenn geschrieben, finde ich letzteres besser, gesprochen ersteres.
Aus dem Französischen
Charles Baudelaire
eine anmerkung zu den deutschsprachigen baudelaire-übersetzungen der eingangsstrophe von »les fleurs du mal« (vgl. L&Poe #21).
La sottise, l’erreur, le péché, la lésine,
Occupent nos esprits et travaillent nos corps,
Et nous alimentons nos aimables remords,
Comme les mendiants nourrissent leur vermine.
was auffällt: alle reimen den reinen reim. nur friedhelm kemp verweigert sich und übersetzt in kaum merklich rhythmisierter prosa.
beim näheren hinschauen sieht man: nur c. fischer und s. löffler bleiben sechshebig und somit dem alexandriner nah, die anderen sind fünfhebig, meist jambisch, hier und dort ein trochäus.
es scheint also einigkeit zu herrschen, dass der reim die struktur ist, die um jeden preis zu bewahren ist. besonders krass bei s. werle, der auf metrische regelmäßigkeit verzichtet, am reim aber festhält (was einen holpernden effekt hat, der dem fließenden klang des originals diametral entgegensteht). oder man muss – siehe f. kemp – auf klangliches verzichten und sich ganz auf die syntax und semantik konzentrieren.
warum nicht einmal versuchen, dieses entweder-oder zu überwinden? und vor allem die irrationale fixierung auf den reim?
ein möglicher weg scheint mir, die form des originals – den auf französisch lässig sitzenden alexandriner (weil der reim dort deutlich weniger anstrengung erfordert) – durch eine im deutschen lockerer zu bewerkstelligende form zu ersetzen. anders gesagt: gebundenheit zu bewahren, aber form nicht sklavisch zu reproduzieren. denn abgesehen davon, dass es zum scheitern verurteilt ist, weil spätestens die reimwörter andere sind (und sich z.b. die tiefe abgründigkeit von lésine/vermine schlicht nicht nachahmen lässt), ist der französische alexandriner nun einmal was anderes als der deutsche. schlicht und einfach, weil die abfolge der hebungen und senkungen dort (fast) keine rolle spielt, bei uns aber sehr wohl. bei uns stellt sie sich leichter ein, und das lässt sich nutzen.
ich versuche es mit einer (von mir verschiedentlich auch schon im zusammenhang mit katalanischen und spanischen texten vorgeschlagenen) vorgehensweise: gebundenheit im deutschen primär durch versmaß wiederzugeben (nicht unbedingt durch die gleiche silbenzahl, auch wenn es in diesem falle klappt), reimschema lediglich durch abwechseln von männlichen und weiblichen kadenzen möglichst oft anzudeuten. und wenn auch noch großzügig verstandene assonanzen mit dabei sind, umso besser. (eine spezialregelung hat sich mir mittlerweile als sinnvoll erwiesen: drei jambisch organisierte hebungen können je durch zwei daktylisch organisierte ersetzt werden).
das erhoffte ergebnis: durch die gewonnene bewegungsfreiheit mehr semantische treue im sinne kemps zu erreichen, dabei aber durch die formalen analogien trotzdem auch ein wenig mehr vom klanglichen eindruck herüberzuretten (also: etwas entspannter zu schielen).
auf die schnelle kommt bei mir heraus:
Die Dummheit, der Irrtum, die Sünde, der Geiz
besetzen unsren Geist, befallen unsren Körper;
wir füttern unsre liebenswürdigen Bedenken,
genauso wie die Bettler nähren ihr Gewürm.
Sibylla Schwarz (1621-1638)
Ins Niederländische übersetzt von Jacques Schmitz (Originaltext darunter)
Wie minnen wil / kan toch zo preuts niet zijn
Daar zit ik nu met mijn zo heet verlangen
Hier ligt mijn lief / daar ligt mijn andere ik, ‚t
Heeft mij volstrekt in het geluk verstrikt
Hier zou ‚k mijn lief het allerliefst ontvangen
Bedelven hem met kussen op z’n wangen
Oh Cupido, maak dat mijn bede wordt vervuld
En help een handje daarbij met geduld
‚k Weet niet met mijn geluk wat aan te vangen
Want Venus geeft mij wel een goed gevoel
Toch wil ik zelf niet / wat ik eigenlijk bedoel
Oh, kuisheid, wil toch verre van mij wijken
Zolang je hier bent, is ‚t mijn grootste pijn
Wie minnen wil / kan toch zo preuts niet zijn
Zo zal ‚t je nooit met liefde’s loon verrijken
HJer hab ich nun mein sehnliches Verlangen :
hier liegt mein Lieb / hier ligt mein ander ich :
hier giebt das Glück sich selbst gefangen mich :
hier mag ich nun mein Lieb vielmahl umfangen :
hier mag ich nun auch küssen seine Wangen :
Cupido hört mein Klagen inniglich /
und wil nun auch so hülffreich zeigen sich ;
Nun mag ich wohl mit meinem Glücke prangen ;
die Venus zeigt mir iezt ein guhtes Ziel /
ich wil nur selbst / nicht was ich gerne wil ;
O Blödigkeit / du must nur von mir weichen !
weil du hir bist / wärt meine grosse Pein ;
Wer lieben wil / mus nicht so blöde seyn /
sonst kan er nicht der Liebe Lohn erreichen.
UMSCHAU UND KRITIK
Wer liest heute noch Arndt?
Wir Kleingläubigen glauben ja gern, daß Lyrik heute keine Bedeutung hat, außer für den kleinen Kreis der Lyrikleser. Dabei müssen wir nur den Blick kurz aus der Blase ziehen. Aus in Greifswald gegebenem Anlaß beschäftigte ich mich mit Ernst Moritz Arndt. Hier gibt es seit über 550 Jahren eine Universität, etwa 470 davon kam sie ohne Namen aus, aber 1933 erhielt sie auf Antrag eines stramm deutschnationalen Theologieprofessors, Mitglied des Stahlhelm, des Kyffhäuserbunds und der DNVP (Deutschnationalen Volkspartei), aus den Händen Hermann Görings, damals preußischer Ministerpräsident, den Namen Ernst Moritz Arndt. 1945 wurde der Name buchstäblich durchgestrichen auf den Uni-Stempeln, aber 1954, die DDR gründete die „Nationale Volksarmee“ und brauchte „nationale“ Traditionen, wurde der Name wieder eingeführt. (Jener Professor war inzwischen Mitglied der regierenden SED). Seit 1991 wird über den Namen diskutiert, erst Anfang 2017 gab es im Senat eine Zweidrittelmehrheit für die Streichung des Namens. Und dann brach ein wahrer Volkessturm (das Volk steht auf, der Sturm bricht los!) über Greifswald aus, eine veritable Provinzposse mit Menschenkette, Luftballons, Rosen für Arndt, Demonstrationen und Dutzenden Leserbriefen, in denen beklagt wurde, daß Studenten (die ja nicht richtige Greifswalder sind, weil sie wieder weggehn, solln erst mal ordentlich arbeiten lernen!) beziehungsweise Westprofessoren (die auch nicht richtige Greifswalder sind, selbst wenn sie seit 20 Jahren in der Stadt leben) „uns unsere Identität nehmen“ wollen. / Weiter
Neue Zeitschriften
Das aktuelle Heft der Zeitschrift manuskripte (No. 217) veröffentlicht u.a. Prosa von Sophie Reyer und Anja Utler sowie unter mehreren Beiträgen zum Literaturfestival im Rahmen des 50. Steirischen Herbstes Texte von Aslı Erdoğan, Jazra Khaleed und Serhij Zhadan. Von Olga Martynova gibt es Auszüge aus einem für 2018 geplanten Essayband mit dem Titel „Über die Dummheit der Stunde“ (Frühjahr 2018 bei S. Fischer). Abgedruckt ist ein Fragment aus „Probleme der Essayistik“. Die Ähnlichkeit des Titels mit einem Vortrag Gottfried Benns ist nicht zufällig. In Anlehnung an Benns „vier diagnostische Symptome“, anhand derer man erkennen könne, ob ein Text von 1950 „identisch mit der Zeit“ sei oder nicht (1. Andichten, 2. Wie-Vergleich, 3. Farbadjektive, 4. seraphischer Ton), lädt sie den Leser zu analogem Spiel mit der Gattung Essay ein. Lyrik und Essay hätten gemeinsam, daß der Leser zu aktivem Mittun eingeladen sei. „Sie belehren nicht, sie fordern auf, allein zu denken.“ / Besprechung hier
Gomringerdebatte: Was bisher geschah
- 27.10.2011 Presseerklärung der Alice-Salomon-Hochschule (ASH): Eugen Gomringer, Preisträger des Alice Salomon Poetik Preises 2011,
überließ der ASH Berlin das Gedicht „avenidas“.“Mit einer Fläche von 15 Metern Höhe mal 14 Metern Breite zählt das Kunstwerk zu den größten Gedichten an öffentlicher Wand.In Anlehnung an die Konkrete Kunst prägte Eugen Gomringer in den 50er Jahren den Begriff Konkrete Poesie – eine Dichtkunst, die das „Sprachmaterial“ in den Vordergrund stellt. Durch besondere Anordnungen der Buchstaben und Wörter wird eine eigene künstlerische Realität erschaffen und Bedeutungsinhalte werden visualisiert. Gomringer spielt mit Wiederholungen und Wechsel der Wörter und schafft so neue Zusammenhänge zwischen ihnen. So wiederholt auch sein Werk „avenidas“ mehrmals die Schlüsselwörter „avenidas“ (Straßen), „flores“ (Blumen) und „mujeres“ (Frauen) und findet dann seinen Höhepunkt in dem plötzlich und nur einmal auftauchenden „admirador“ (Bewunderer). Die Gedichte Gomringers gehören zum Kanon der modernen Lyrik.“ - 14.4.2016 Offener Brief des AStA an das Rektorat der
Alice Salomon Hochschule:„wir als Studierende haben die vorlesungsfreie Zeit genutzt, um uns etwas genauer mit dem Gedicht an der Südfassade der Hochschule zu beschäftigen (…)Es ist ebenfalls nicht unser Anliegen, das Gesamtwerk Eugen Gomringers in Frage zu stellen.Dennoch kommen wir nicht umhin, ausgerechnet dieses Gedicht als offizielles Aushängeschild unserer Hochschule zu kritisieren: Ein Mann, der auf die Straßen schaut und Blumen und Frauen bewundert. Dieses Gedicht reproduziert nicht nur eine klassische patriarchale Kunsttradition, in der Frauen* ausschließlich die schönen Musen sind, die männliche Künstler zu kreativen Taten inspirieren, es erinnert zudem unangenehm an sexuelle Belästigung, der Frauen* alltäglich ausgesetzt sind. (…)An der Strahlkraft des Kunstwerkes zweifeln wir keinesfalls, scheint es doch thematisch nicht viel anderes in den Fokus zu stellen, als den omnipräsenten objektivierenden Blick auf Weiblichkeit. Sollten die gelobten „neuen Zusammenhänge“ (….) Gomringers nicht nur auf seine Wortkonstellationen, sondern auch auf eine gesellschaftliche Ebene bezogen sein, so sind diese uns nicht ersichtlich.Für uns fühlen sich diese Zusammenhänge eher alt und zugleich doch erschreckend aktuell an.Zwar beschreibt Gomringer in seinem Gedicht keineswegs Übergriffe oder sexualisierte Kommentare und doch erinnert es unangenehm daran, dass wir uns als Frauen* nicht in die Öffentlichkeit begeben können, ohne für unser körperliches „Frau*-Sein“ bewundert zu werden. Eine Bewunderung, die häufig unangenehm ist, die zu Angst vor Übergriffen und das konkrete Erleben solcher führt. (…)Aus diesen Gründen fordern wir folgendes:eine Stellungnahme, von wem und mit welcher Begründung dieses Gedicht für die Hochschulwand ausgewählt wurdedie Thematisierung einer Gedichts-Entfernung/-ersetzung im Akademischen Senat zum nächstmöglichen Zeitpunkt. - 10.6. 2016 Erklärung des AStA:Wir haben den offenen Brief bezüglich der Entfernung des Gedichts an der südlichen Hochschulwand geschrieben und gefordert, dass dieses Anliegen im AS (Akademischen Senat) besprochen wird. (…)Anstatt über den Sachverhalt zu diskutieren und eine Lösung zu finden, wurde unser Engagement von mehreren Seiten gelobt und damit versucht, mit einer Lobesrede uns ruhig zu halten. Als einziger Kommentar wurde noch hinzugefügt, dass ein Gedicht auf Spanisch nicht für alle Personen zugänglich ist.Doch wir lassen uns nicht verarschen.
- 7.7. 2016 Erklärung des AStA:Nach einer unbefriedigenden letzten AS-Sitzung bezüglich des Avenidas-Gedichtes (siehe hier: http://www.asta.asfh-berlin.de/de/News/gedicht-an-der-hochschulwand-akademischer-senat-sitzung-7-6-2016.html), standen nach wie vor folgende Forderungen im Raum (…)Heute, am 05.07., fand in Absprache mit der Hochschulleitung vor der AS-Sitzung eine öffentliche Diskussion zum Thema „Neugestaltung der Südfassade“ statt. In dieser haben wir erneut klar gemacht, warum uns das Avenidas-Gedicht nicht passt und unsere Forderungen wiederholt. Desweiteren haben wir ein Konzept vorgelegt, wie ein demokratisches Auswahlverfahren für eine neue Wandgestaltung aussehen könnte. Auch wenn wir uns in der folgenden Diskussion von einzelnen AS-Mitgliedern unter Anderem anhören mussten, dass der sexistische Bezug zum Avenidas-Gedicht ja nur in unserem Kopf existieren würde und eine Ersetzung des Gedichtes Zensur gleichkommen würde, waren wir soweit erfolgreich:Frau Völter hat durch das Zitieren einer Mail der damaligen Hochschulrektorin Theda Borde offiziell zu Protokoll gegeben, wie es zu diesem Gedicht an der Südfassade kam: nämlich durch eine undemokratische Alleinentscheidung Bordes. Diese erklärte das Gedicht für ein faszinierendes Werk konkreter Poesie und lobte die Verbindung von „Straßen, Frauen und Blumen“ als äußerst gelungen. Des weiteren hofft sie, dass alle Unterzeichnenden und Unterstützenden irgendwann auch in der Lage sein werden, diese poetische Raffinesse zu erkennen und zu würdigen (frei zitiert).
- 15.7. 2017 Aufruf zur Umgestaltung der Südfassade:ab sofort können alle Hochschulangehörige über die Umgestaltung der Südfassade der ASH mitreden! Unser Vorschlag, das Gedicht zu entfernen und durch ein basisdemokratisches Auswahlverfahren neuzugestalten wurde vom Akademischen Senat (AS) angenommen – bis zum 15. Oktober könnt Ihr alle Euren eigenen Vorschlag beim Rektorat einreichen.Werdet kreativ und fordert ein, was leider nicht selbstverständlich ist: diese Hochschule und die Südfassade gehört uns allen und wir wollen mit entscheiden, was damit passiert! Es wird Zeit für action!
- 31.8.2017 Harry Nutt, Berliner Zeitung: „Die Studenten dürfen den Erfolg der Kampagne ihrer nicht nachlassenden Beharrlichkeit zuschreiben, in der sie ihre Sicht der Dinge ohne Rücksicht auf mögliche künstlerische Mehrdeutigkeit durchgesetzt haben. Die Entscheidung des Akademischen Senats, den Zielen der Studenten zu entsprechen, zeugt hingegen von einer erschütternden Willfährigkeit, die Freiheit der Kunst einem fragwürdigen Schulfrieden zu opfern.“
- 4.9.2017 Nora Gomringer: Warum der Sexismusvorwurf gegen meinen Vater lächerlich istEin Gedicht ist Kampfzone und Kopfkissen, Ausdruck unendlicher Harmlosigkeit und manchmal rotes Tuch. Im folgendem, zu schilderndem Falle eines konkreten Gedichts von Eugen Gomringer aus dem Jahr 1953 ist es der Topos des Bewunderns, der große Dramatik oder einfach nur „Viel Lärm um nichts“ auslöst. Geopfert werden dabei: die Autonomie eines Kunstwerks, der Ruf eines Dichters, der droht, zum Sexisten diffamiert zu werden und eine Hauswand. Dazu ungezählte Nervenstränge verschiedener Beteiligter und – dank Social Media! – Unbeteiligter. Der AStA der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin wünscht die Entfernung des Gedichts „avenidas“ des 1925 in Bolivien geborenen Dichters und Ästhetikprofessors Eugen Gomringer, für den die Aufschrift seines Textes auf der Hauswand der Hochschule eine Zugabe zum Alice-Salomon-Preis des Jahres 2011 war. Gomringer-Texte stehen an ausgewählten Hauswänden in aller Welt, seine Texte sind längst eingegangen in den Klassikerschatz der modernen Literatur.
- 5.9.2017 Michael Lentz analysiert das Gedicht Gomringers in der FAZ
- 5.9.2017 Stellungnahme des PEN-Zentrum Deutschland für Erhalt des Gedichts „Avenidas“ des Lyrikers Eugen Gomringer an Südfassade der Alice-Salomon-Hochschule, Berlin: Wir sind zutiefst beunruhigt über eine Entwicklung, die darauf abzielt, der Kunst einen Maulkorb vorzuspannen oder sie gar zu verbieten.Die Studierenden, die sich für die Übermalung des ihrer Meinung nach anstößigen Gedichtes einsetzen, bitten wir zu überdenken, welche Konsequenzen eine solche Zensur letztlich hätte, und sich mit dem Phänomen der Bilderstürmerei in Vergangenheit und Gegenwart auseinanderzusetzen. Die Leitung der Hochschule fordern wir auf, unberechtigten und auf Missverständnissen, gar Unverständnis beruhenden Forderungen nicht opportunistisch Folge zu leisten.„Wirklich skandalös an diesem barbarischen Schwachsinn eines AStA ist: Die Alice-Salomon-Hochschule Berlin ist eine Fachhochschule mit den Schwerpunkten Erziehung und Bildung, d.h. diese Kulturstürmer werden einst den Nachwuchs ausbilden“, so der Ehrenpräsident des deutschen PEN, Christoph Hein.
- 6.9.2017 Süddeutsche Zeitung:Die Reaktionen aus Oberfranken sind wunderbar. Die Tochter des Lyrikers, die Bachmann-Preisträgerin Nora Gomringer, tritt im Netz als „Gedichte Polizei Gom Ringer“ auf, ein anarchischer Beitrag gegen allgemeine Verblödung, der jetzt schon als Klassiker gelten darf. Und wer mit ihrem Vater spricht, hört zuerst das leise Lachen eines 92-Jährigen. Bis er sagt: „Dass man mit so wenigen Worten so eine Wirkung erzielt, das war immer mein Ziel.“ Provinz? Ist woanders.
- 8.9.2017 Berliner Zeitung:Der Schweizer Schriftsteller Eugen Gomringer lehnt die Übermalung seines angeblich sexistischen Gedichts an der Fassade einer Berliner Hochschule ab. „Eigentlich neige ich im Moment nicht dazu, nachzugeben“, sagte der 92-Jährige am Freitag dem Schweizer Sender SRF 2 Kultur.„Man kann darüber sprechen, aber es sollte nicht mit kompletter Ignoranz geschehen. Die guten Leute wissen gar nicht, was sie da anzündeln“, sagte Gomringer während eines Literaturfestivals in der Ukraine dem Sender. „Ich bin ja nicht allein der Gomringer und nicht allein „avenidas“, sondern es ist eines der bedeutenden Gedichte der modernen Lyrik geworden. Das kann man nicht einfach auf die Seite schieben oder kaputtreden.“
- Ulrike Baureithel: Ein „sexistisches Gedicht“? Freitag 36/2017:In der Auseinandersetzung prallt aufeinander, was die Literaturwissenschaftlerin Silvia Bovenschen vor fast 40 Jahren über die imaginierte Weiblichkeit schrieb, um das komplizierte Verhältnis zwischen den Bildwelten des Weiblichen und dem Selbstverständnis schreibender Frauen, zu denen Studentinnen zweifelsfrei gehören, zu klären.In diesem Fall trifft eine Überhöhung des Weiblichen – und damit seine Herabsetzung – auf eine historische Situation, in der solche Bilder eigentlich überholt sein sollten. Irritierend ist nicht das Gedicht, sondern dass es an einer Schule, an der vor allem Frauen dazu ausgebildet werden, sich schreibend mit eigenem oder fremdem Leben auseinanderzusetzen, seitens der Verantwortlichen nicht mehr Gespür gibt für das problematische Bilderarsenal. Und seitens der Studierenden für die Geschichtlichkeit von Kunst. Unter anderem durch die Kritik am männlich geprägten literarischen Kanon hat sich eine ganze Generation von Frauen emanzipiert. Das Gedicht einfach zu übermalen oder, wie von der Hochschulleitung vorgeschlagen, zu ergänzen mittels eines neuen Verses, schafft diesen nicht aus der Welt. Erst ein neuer Kanon rückt ihn zurecht.
- 13.9.2017 Erklärung der Prorektorin für Forschung und Kooperationen an der Alice Salomon Hochschule Berlin, Prof. Dr. Bettina Völter:Handelt es sich bei diesem Vorgang um „Zensur“, wie in einer Pressemitteilung des PEN-Zentrums Deutschland zu lesen ist oder um gelebte Demokratie an einer Hochschule? Der Rektor der Hochschule muss den Medien Rede und Antwort stehen und einzelne, zufällig in der vorlesungsfreien Zeit angetroffene Studierende werden in Kurzinterviews befragt. Zugleich überfluten hasserfüllte, antifeministische, antidemokratische, wissenschaftsfeindliche und Tatsachen verzerrende Mails die Akteur_innen.Es ist Zeit, dass einige Sachverhalte aus der Perspektive der Hochschule mit etwas mehr Zeilen und in Ruhe klargestellt werden können. (…)Das bisher Nicht-Erwähnte: der demokratische ProzessJede Hochschule unterliegt dem Gesetz der Freiheit von Lehre und Forschung. Sie ist geradezu verpflichtet, sich reflexiv zu dem zu verhalten, was in Text, Wort und Handlung von ihr und ihren Mitgliedern ausgeht. Ihre Mitglieder haben – als der Wissenschaft verpflichtet – bisweilen auch die undankbare Aufgabe, Sachverhalte zu benennen, die neu, ungewohnt, sperrig, befremdlich und umstritten sind. (…)Im Unterschied zur „Bilderstürmerei“, die zum Vergleich ebenfalls vom PEN-Zentrum herangezogen wird, handelt es sich bei dem Vorgehen der Studierenden der ASH Berlin um ein gewaltfreies, demokratisch legitimiertes und auch ideologie-, diskriminierungs- und klischeesensibles Verfahren. (…)Die in den Medien geführte Debatte, die die kritische Auseinandersetzung der Alice Salomon Hochschule Berlin mit ihrer Fassadengestaltung ausgelöst hat, verhilft allerdings dem Gedicht und seinem Autor zu einer im Netz verewigten, generationenübergreifenden Wirkung. Und wenn es allein das wäre, was zu erreichen war, dann freuen wir uns mit unserem Preisträger Eugen Gomringer!
- 17.9. 2017 Luise F. Pusch:Aber nun kommen noch die Straßen hinzu. Was verbindet diese mit den Blumen und den Frauen? Der „admirador“ – ein Mann, der diese Straßen, Frauen und Blumen bewundert.Weshalb er sie bewundert, wird nicht verraten. Bei „Blumen und Frauen“ wird der Grund wie gewohnt ihre Schönheit sein. Und so können wir vermuten, dass auch die Straßen (oder Alleen) schön sind. Der „admirador“ wird ein Flaneur sein, der die Straßen zum Flanieren braucht, um die Objekte seiner Bewunderung (Blumen) und Begierde (Frauen) zu finden.Gomringers Gedicht aus dem Jahre 1952 stammt aus einer Zeit, da wir in den Illustrierten noch Sätze wir den folgenden lesen konnten: „Er (irgendein Playboy, Filmstar oder Prinz) liebt rassige Pferde, schnelle Autos und schöne Frauen“. Nach Jahrzehnten genervter Kritik von Feministinnen sind solche Sätze, die uns auf derselben Ebene wie Pferde und Autos ansiedeln, seltener geworden. Es sei denn, sie werden auf Hausfassaden auch noch verewigt.
- 20.9. 2017 Solidaritätserklärung von über 100 Schriftstellern und anderen Persönlichkeiten des Literaturbetriebs:Wir: Das sind verschiedene Menschen, die im weitesten Sinne im Literaturbetrieb arbeiten. Ein Feld, das strukturell weit und unübersichtlich ist und auf dessen Vielstimmigkeit wir doch nach wie vor große Hoffnung setzen. Gleichzeitig agieren einige der entscheidenden literarischen Institutionen nach wie vor zweifellos anachronistisch und zuweilen reaktionär und diskriminierend: Kurz vor der jetzigen Debatte um die Neugestaltung Eurer Fassade wurde an der Schreibschule Hildesheim eine Debatte über betriebsinternen Sexismus angestoßen, in der es bald auch um andere Formen von Ausschlüssen ging. Am immensen Redebedarf, an den so diversen Erfahrungen und Forderungen, die dabei zur Sprache kamen, wurde deutlich, wie überfällig eine solche Auseinandersetzung für dieses, unser Arbeitsumfeld ist. Und nicht zuletzt auch an den verharmlosenden bis sexistischen Reaktionen auf die Beiträge der Debatte. Das Ausmaß an reaktionärer Polemik, von diskriminierender Beleidigung bis hin zur Gewaltandrohung, das Euch nicht nur öffentlich entgegenschlägt, schockiert uns trotzdem noch einmal völlig neu. Und es macht uns wütend. (…)Wie wir – welches Wir wir dann auch immer darstellen – in dieser aggressiven Atmosphäre des Rollback am besten weiter gegen Diskriminierungen vorgehen – strategisch und gleichzeitig, ohne uns selbst auszubeuten und aufs Spiel zu setzen; darüber würden wir gerne mit Euch reden – und mit allen, die wollen.
PRESSESCHAU
Zum Tod von John Ashbery
Der amerikanische Dichter John Ashbery war kein Revoluzzer, sondern ein stiller Moderner. Die ästhetischen Freiheiten, zu denen der 1927 im Bundesstaat New York Geborene mit seiner Lyrik vorstiess, haben jüngere Generationen von Dichtern nachhaltig beeinflusst, und zwar nicht nur in Amerika, sondern auch in Europa, obwohl seine Dichtung erst spät und nur spärlich übersetzt wurde.
«Ich hatte meine Persona nie sonderlich stark empfunden», meinte Ashbery in einem Interview. Das lyrische Ich seiner Gedichte ist kein integrales Ich, sondern eher eine Hypothese, denn Ashbery zerlegt den Prozess der Wahrnehmung in ein zugleich atomisiertes und entgrenztes Sprechen. Das wilde Experimentieren seiner frühen Bände – vom Spiel mit traditionellen Versformen bis zu dadaistischen Eruptionen – hat sich in den späteren beruhigt: In der konzentrierten Beobachtung des gelenkten Zufalls hat Ashbery seine unverwechselbare Stimme gefunden. / Siglinde Geisel, Neue Zürcher Zeitung https://www.nzz.ch/feuilleton/nachruf-john-ashbery-unterkuehlte-ekstasen-des-bewusstseins-ld.1313287?mktcid=nled&mktcval=107_2017-9-3
Zum Tod von Kito Lorenc
Der sorbische Dichter Kito Lorenc ist tot. Wie der Domowina-Verlag Bautzen MDR KULTUR bestätigte, starb Lorenc am Sonntag im Alter von 79 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls.
Kito Lorenc galt als einer der bedeutendsten sorbischen Lyriker und Dramatiker der Gegenwart. Lorenc wurde 1938 in Schleife/Slepo nahe Weißwasser geboren und beschäftigte sich in seinem literarischen Werk auf Deutsch und Sorbisch immer wieder mit dem Heimatverlust durch den Braunkohleabbau. Sein Gedichtzyklus „Struga – Bilder einer Landschaft“ (1967) diente als Vorlage für einen Dokumentarfilm, der aber in der DDR nicht in die Kinos kam. (…) / MDR http://www.mdr.de/kultur/themen/kito-lorenc-gestorben-100.html
Vor ihm hat kein anderer Schriftsteller so virtuos das Deutsche und das Sorbische in einem Gedicht zusammengebracht. Die eine Sprache, meinte er, taugt für Behördengänge und philosophische Gedanken, die andere für Haus und Garten und den Nussbaum im Hof. Jede kann was, was die andere nicht kann. / Karin Großmann Sächsische Zeitung, 26.9.2017
Kito Lorenc ist ein Kind, ein Kind in umfassendem Sinn, der Landschaft an den Ostgrenzen Deutschlands, der Lausitz, Kind der Luzica, so wie seine Poesie deren Kind ist, der Bäche, Felder, Hügelwälder, Moore und Heide dort zum einen, des Aneinanderstoßen – auch das in vielerlei Sinn – dreier Länder, eines deutschen, eines polnischen, eine tschechischen zum anderen. / Peter Handke, Vorwort zu Kito Lorenc: Gedichte, Berlin 2013
Allen Ginsberg kam vorbei
Wolf Biermann: Hanns Eisler saß übrigens auch an diesem alten Tisch hier.
ZEIT: Wer saß noch auf diesen Stühlen, einst in der Chausseestraße?
Biermann: Margot Honecker. Ein einziges Mal, vor meinem Verbot 1965. Sie meinte es gut mit mir, sie wollte mich retten. Es verband unsere kommunistischen Familien die Erfahrungen vor und nach 1933. Margot wollte mich zurückreißen vom falschen Weg, sie wollte, dass ich ein DDR-Staatsdichter werde. Das misslang ihr vollkommen. Herbert Marcuse, der Philosoph, saß hier. Allen Ginsberg kam aus New York vorbei. Mein Kumpel Manfred Krug. Joan Baez, Grass, Böll, Wallraff, Huchel, Jurek Becker, Heiner Müller, Max Frisch, Uwe Johnson, Stefan Heym, Günter Kunert, die größte Dichterin der DDR Helga M. Novak, die kleine Sarah Kirsch, der rebellische Thomas Brasch, der Schweizer Franz Hohler, Maler wie Ronald Paris, Jazzer wie Baby Sommer. Es waren so viele. / Die Zeit 36, S. 40
Petition: Geben Sie der Lyrik Raum!
Offener Brief von Walther Stonet
Es ist ein Armutszeugnis, wenn wir heute in Buchhandlungen neben den Bestsellern nur noch die Klassik vorfinden: Goethe, Schiller, ein bisschen Hesse und ein wenig Rilke. Die aktuelle, die moderne Lyrik findet de facto nicht statt. Ein Buchhändler verkauft, was man bei ihm nachfragt. Nachfragen kann man nur, wenn man weiß, dass es etwas gibt. So schließt sich der Kreis.
Es war einmal gute Tradition, in jeder Ausgabe eines Feuilleton wenigstens ein Gedicht einer aktuellen Poetin oder eines jungen Poeten zu präsentieren, meist mit einem kleinen Rahmen darum und dem Verweis auf den Band, in dem das Werk erschien. Im Feuilleton selbst wurde nicht nur Belletristik und Sachbuch besprochen, es gab auch immer wenigstens einen Gedichtband. Es gibt keinen wirklichen Grund, an dieser Tradition nicht wieder anzuknüpfen.
Wir haben uns die Freiheit genommen, mit dem heutigen Tag eine Petition https://www.openpetition.de/petition/online/der-lyrik-eine-bresche-fuer-ein-gedicht-je-ausgabe-einer-zeitung an Sie zu veröffentlichen. Ab heute kann unterschrieben werden. Es würde uns freuen, wenn Sie selbst dieser Petition mit Ihrer Unterschrift Nachdruck verleihen und mit den Organen Ihres Verlagshauses vorangeben würden. Die deutschsprachige Poesie und die vielen, die sich ihr verschrieben haben, werden es Ihnen danken.
Es liegt an Ihnen und den Verlegern aus Ihrem Verband, dieser Idee den nötigen Rückenwind zu geben. Sie würden der modernen deutschen Lyrik einen großen Dienst erweisen und zeigen, dass es bei Ihren Presseobjekten um mehr geht als um Geschäftsinteressen. Kultur braucht Förderer. Die junge und die aktuelle deutschsprachige Poesie hätten Ihre Förderung verdient. / Mehr bei KuNo http://www.editiondaslabor.de/blog/?p=44583
Kurz gesagt
- In einem Interview mit dem Radiosender NPR verteidigte er (John Ashbery) sich 2005 gegen Vorwürfe, seine Gedichte seien unzugänglich: „Ich glaube, sie sind zugänglich, wenn man einen Zugang finden möchte“, betonte er. / Deutsche Welle http://www.dw.com/de/pulitzerpreisträger-und-poet-john-ashbery-ist-tot/a-40348517
- Grammatik ist zweite Natur. Robert Kelly, in: Die Mütze #16
- Ich finde, politische Dichtung leistet nicht viel; wir fühlen uns bloß ein bisschen erleichtert, konnten uns etwas Luft machen. Ich glaube, das ist nicht so schlecht, manchmal müssen wir etwas loswerden – aber wir sollten deswegen nicht glauben, dass wir etwas erreicht haben, wenn uns das Publikum applaudiert, weil wir mit seinen Überzeugungen übereinstimmen. Robert Kelly im Interview mit Urs Engeler, in: Die Mütze #16
- Die Welt verändern, indem man immer jeweils eine Person verändert. Die seltsame Tatsache eines Gedichts in einem Buch: das geschieht immer jeweils einer Person. Robert Kelly, ebd.
- “From tiny experiences we build cathedrals.” — Orhan Pamuk, The art of fiction No. 187. The Paris Review Tweet
- “There is no shortage of wonderful writers. What we lack is a dependable mass of readers.” —Kurt Vonnegut, ebd.
-
“I want a poet to break out of his or her poetic identity.” —J. H. Prynne, The Paris Review
NACHRICHTENSTRECKE
Poesiefest im Düsseldorfer Literaturhaus – Poesie-Debüt-Preis
Lyrik, die wohl anspruchvollste Herausforderung für einen Autor, steht vom 29. September bis 1. Oktober wieder im Mittelpunkt des Poesiefestes im Heine Haus in der Bolkerstraße.
In den letzten sieben Jahren trugen bekannte Schriftsteller wie Jürgen Becker, dort im Rahmen des Poesiefestes ihre Werke vor. Immer hatten die Veranstalter Rudolf Müller und Selinde Böhm von der Literaturhandlung im Heine Haus, auch den Nachwuchs im Blick und gaben Debütanten eine Bühne. Da erschien es nur folgerichtig den ersten Poesie-Debüt-Preis Düsseldorfs ins Leben zu rufen. Dieser wird zukünftig im Wechsel mit dem Heine-Preis alle zwei Jahre verliehen.
Mit 4000,- Euro ist er zudem ein sehr hoch dotierter Debütantenpreis, der damit auch die Wertschätzung der Lyrik durch die Landeshauptstadt ausdrückt, die diese Ehrung ermöglicht.
Der Poesie-Debüt-Preis geht in diesem Jahr an Maren Kames, die diese Ehrung am 1. Oktober im Heine Haus entgegen nehmen wird.
Nach zehn Jahren Engagement für das Geburtshaus des größten Düsseldorfer Dichters, entschied der städtische Kulturausschuss, das Heine Haus nun offiziell auch zum „Literaturhaus Düsseldorf“ zu ernennen und jährlich mit 60.000,- Euro zu fördern. lokalkompass.de https://www.lokalkompass.de/duesseldorf/kultur/poesiefest-im-duesseldorfer-literaturhaus-d792544.html
Lyrikpreis München 2017
Die Veranstalter melden:
Die Teilnehmenden am Finale stehen fest.
Ruxandra Chişe (Berlin), Dirk Uwe Hansen (Greifswald), Nancy Hünger (Erfurt), David Krause (Kerpen) und Saskia Warzecha (Berlin) werden am 21. Oktober um den Lyrikpreis München 2017 lesen. Und reden, denn die Besonderheit unseres Preises ist ja bekannt: Die Jury – in diesem Jahr Birgit Kreipe, Swantje Lichtenstein und José F.A. Oliver – wird mit allen Finalistinnen einzeln ein Gespräch führen über die Texte und ihre Konzeption. Das Publikum ist eingeladen, sich einzumischen.
Aus 252 anonymen Einreichungen wählte die Vorjury (Markus Hallinger, Àxel Sanjosé und Johanna Schumm) die fünf Finalistinnen aus. Außerdem auch Ulf Großmann, der leider verhindert ist. Sehr schade.
Finale des Lyrikpreises München 2017:
Samstag, 21. Oktober, 19:00 Uhr
HochX, Entenbachstraße 37, 81541 München
Lesende: Ruxandra Chişe, Dirk Uwe Hansen, Nancy Hünger, David Krause und Saskia Warzecha
Jury: Birgit Kreipe, Swantje Lichtenstein, José F.A. Oliver
Moderation: Àxel Sanjosé
Eintritt: 9 Euro, ermäßigt 6 Euro
Kurz berichtet
- Der Anwalt des TV-Satirikers Jan Böhmermann hat Angela Merkel in einem Schreiben ans Kanzleramt mit einer Klage gedroht, sollte die Bundeskanzlerin nicht ihre öffentliche Bewertung zum Schmähgedicht auf den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan zurückziehen. / Focus http://www.focus.de/politik/deutschland/streit-um-erdogan-gedicht-boehmermanns-anwalt-droht-merkel-mit-klage_id_7555563.html?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=facebook-focus-online-politik&fbc=facebook-focus-online-politik&ts=201709051355
- KÖLN Ein Asylbewerber hat mit einer Protestaktion auf der Hohenzollernbrücke in Köln mitten im Berufsverkehr für zahlreiche Zugverspätungen gesorgt. Um auf seine Situation aufmerksam zu machen, ist der Mann, desen Asylantrag abgelehnt wurde, auf einen der Stahlbogen der Brücke geklettert. Der Asylantrag des 29 Jahre alten Iraners sei zuvor abgelehnt worden, sagte die Polizei in der Nacht zum Donnerstag. Der Mann war am Nachmittag auf einen Stahlbogen der Brücke geklettert. Dort habe er mit Zetteln um sich geworfen, auf denen Gedichte in arabischer Schrift gestanden hätten. http://www.ruhrnachrichten.de/nachrichten/vermischtes/aktuelles_berichte/Mann-klettert-auf-Bruecke-Bahnverkehr-in-Koeln-gestoert;art29854,3360646
- Der marokkanische Dichter Abderrafie El Jaouahiri, früherer Präsident des Verbands der marokkanischen Schriftsteller, erhielt in den Vereinigten Arabischen Emiraten den vom Generalverband der arabischen Schriftsteller und Literaten vergebenen „Preis der Freiheiten“. Ausgezeichnet wird er auf Vorschlag des marokkanischen Verbandes für „seinen unaufhörlichen Kampf für die Freiheiten in der arabischen Welt“ in seinen Gedichten und Artikeln. medias24 https://www.medias24.com/map/map-24592-Le-poete-marocain-Abderrafie-El-Jaouahiri-recoit-le-Prix-des-libertes-aux-Emirats.html
Gestorben
- Am 1. Oktober František (Jorge) Listopad, tschechisch-portugiesischer Schriftsteller (95) https://www.publico.pt/2017/10/02/culturaipsilon/noticia/morreu-o-escritor-e-encenador-jorge-listopad-1787405
- Am 1. Oktober Pierluigi Cappello, italienischer Lyriker (50)
- Am 1. Oktober Philippe Rahmy, 52, Schweizer Schriftsteller (Schweizer Literaturpreis 2017)
- Am 30. September Hans Liebhardt, rumäniendeutscher Journalist und Schriftsteller (83)
1934 in Großpold geboren, absolvierte er das Gymnasium in Hermannstadt, die Pädagogische Mittelschule in Schäßburg und das Literaturinstitut „Mihai Eminescu“ in Bukarest. Seit 1951 war er Redakteur der Bukarester Tageszeitung „Neuer Weg“, seit 1993 „Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien“. Zwischen 1970 – 1980 war er stellvertretender Chefredakteur beim Rumänischen Fernsehen (TVR), verantwortlich für die Programme in deutscher Sprache.
Als Schriftsteller wurde er durch den Zyklus „Das wundersame Leben des Andreas Weißkircher“ (1983) bekannt, der auch Rumänisch erschienen ist. Er erhielt den Prosapreis des Rumänischen Schriftstellerverbandes 1971 und 1982, zuletzt die Eminescu-Medaille für seine deutsche Eminescu-Ausgabe (2000).
Er ist der Autor mehrerer Anthologien der rumäniendeutschen Literatur: „Worte und Wege“ 1970, „Worte unterm Regenbogen“ 1973, „So lacht man bei uns“ 1989, „Aufs Wort gebaut“ 2003. / Allgemeine Deutsche Zeitung http://www.adz.ro/artikel/artikel/unermuedlich-am-werk/
- Am 30. September Andrej W. Menschikow (Меньшиков, Андрей Викторович), sowjetischer und russischer Lyriker und Dramatiker (72)
- Am 28. September Waso Georgijewitsch Malijew (Малиев, Васо Георгиевич), ossetischer sowjetischer Schriftsteller (79)
- Am 25. September Nora Marks Dauenhauer, Tlingit-Autorin und Wissenschaftlerin aus Alaska (90)
Former Alaska writer laureate and influential Tlingit scholar Nora Keixwnéi Dauenhauer died Monday at the age of 90.
Dauenhauer, of the Haines-Yakutat Lukaaxádi (sockeye) clan, was a giant of Tlingit language scholarship and literature. (…)
“She really got people to examine the beauty of Tlingit,” Twitchell told the Empire on Monday. “She’s built the foundation (of Tlingit literature). Her and Richard. … She was an incredible poet. She was an incredible intellectual.” / Juneau Empire http://juneauempire.com/local/news/2017-09-25/native-scholar-writer-laureate-nora-dauenhauer-dies-90
https://de.wikipedia.org/wiki/Nora_Marks_Dauenhauer
https://de.wikipedia.org/wiki/Tlingit_(Sprache)
- Am 24. September Washington Benavidez, uruguayischer Schriftsteller (87)
- Am 24. September Kito Lorenc, deutsch-sorbischer Lyriker und Dramatiker 79 (siehe hier)
- Am 20. September Ene Mihkelson, estnische Schriftstellerin (72) https://de.wikipedia.org/wiki/Ene_Mihkelson
- Am 19. September Ivo Vodseďálek, tschechischer Lyriker und Künstler (86)
Ivo Vodseďálek (8. August 1931 in Prag – 19. September 2017), Dichter, Künstler und Ballonpilot.
Er war eine bedeutende Persönlichkeit des tschechischen künstlerischen, kulturellen und sozialen Underground. Samisdatveröffentlichungen mit Egon Bondy
- Am 19. September Sigurður Pálsson, isländischer Schriftsteller (69)
- Am 18. September Afzal Ahsan Randhawa, pakistanischer Schriftsteller (80)
- Am 15. September Wassili N. Protodjakonow (Протодьяконов, Василий Никитич), sowjetischer und russischer jakutischer Literaturwissenschaftler, Schriftsteller und Übersetzer (83)
- Am 11. September Xohana Torres, spanische galizischsprachige Schriftstellerin (85)
- Am 11. September Anna A. Nal (Наль, Анна Анатольевна), sowjetische und russische Lyrikerin und Übersetzerin (74)
- Am 9. September Wladimir I. Katz (Кац, Владимир Израилевич), sowjetischer und ukrainischer Lyriker und Mathematiker (67)
- Am 9. September Michael Friedman, amerikanischer Komponist und Liedermacher (41)
- Am 5. September Ma Kwang-soo, südkoreanischer Schriftsteller (66)
- Am 3. September John Ashbery, amerikanischer Dichter (90) siehe hier
- Am 2. September Shirish Atre-Pai, indische Dichterin (87), führte das Haiku in die Marathidichtung ein.
Born in 1929, Ms. Pai was the daughter of noted writer-journalist ‘Acharya’ Pralhad Keshav Atre. She started writing ‘Haiku’ in 1975. She studied Japanese ‘Haiku’, its origin and nature and published five Marathi ‘Haiku’ books.
Ms. Pai also translated some Japanese ‘Haiku’ from English to Marathi. She also worked as a journalist in the Maratha newspaper and participated in the ‘Samyukta Maharashtra’ (United Maharashtra) movement.http://www.thehindu.com/books/books-authors/marathi-poet-activist-shirish-pai-passes-away/article19609880.ece
- Am 1. September Wassili Endip (Эндип, Василий), sowjetischer tschuwaschische Lyriker (80)
- Am 31. August der Filmregisseur und Schriftsteller Egon Günther (90)
(Filme: 1968: Abschied, 1970: Junge Frau von 1914, 1971: Der Dritte, 1973: Erziehung vor Verdun (nach Arnold Zweig), 1974: Die Schlüssel, 1975: Lotte in Weimar, 1976: Die Leiden des jungen Werthers, 1978: Ursula) - Am 30. August die britische Autorin und Esperantolyrikerin Marjorie Boulton (93)
- Am 28. August der polnische Lyriker Eligiusz Pieczyński
- Am 26. August der amerikanische Dramatiker und Lyriker Bernard Pomerance (76)
- Am 23. August Alexandre Mitzalis (82)
ZUGUTERLETZT
Lyrikkalender
Geburtstage von
Todestage von
Mehr im Immerwährenden L&Poe-Lyrikkalender (ganz oben im Menü)
[zurück]
[✺]
Neu im L&Poe-Bücherregal
Poetopie
Ein paar Lesetips zum Schluß
- Max Czollek übersetzt Adi Keissar Bahia
Sehr geehrter Herr Bundespräsident!
Angelika Janz: Offener Brief
Sehr geehrter Herr Bundespräsident!
Ich schreibe Ihnen, während ich die Sendung von Anne Will zur Frage ostdeutschen AfD-Wahlüberhangs per Kopfhörer verfolge.
Dieser Brief soll kein „Jammerbrief“ werden, sondern Ihnen Analysen aus der betroffenen Region schildern – er richtet sich „eigentlich“ auch an JEDEN, der an der gegenwärtigen Stimmung in der BRD interessiert ist, der viele Details über eine ziemlich vergessene Region am Rande der Republik enthält, in der ich seit 25 Jahren lebe. So bitte ich Sie als ein Kenner sozio-kultureller Verhältnisse im Land, diesen Brief wirklich zu lesen.

Ich bin Ihnen für Ihre Rede zum Tag der Deutschen Einheit dankbar, weil Sie dem Begriff der „Heimat“ einen neuen Akzent im Hinblick auf die Zukunft nachfolgender Generationen hinzugefügt haben – gegen jene Mauern, von denen Sie gesprochen haben in unserem Land. So möchte ich Ihnen hier über eine Mauer zwischen der Realpolitik und Wirtschaft und dem ländlichen „Lebenswert-Raum“ berichten.
Den Menschen gerade im ländlichen Raum wird „die Heimat“ unter den einst geerdeten Füßen weggezogen, und das wohl schon seit Wendebeginn. Heimat wird hier im äußersten Nordosten als ein Wort gehandelt, das im Alltag nicht mehr verwendet werden darf, weil es bei den Verwendern umweglos Rechtstendenzen vermuten lässt.
Seit 25 Jahren lebe ich als westdeutsche Kulturpädagogin im Nordosten. Ich habe eine Reihe von „Heimat-Projekten“ mit den Kindern meiner KInderAkademie realisiert. Z.B. ein Fotoprojekt mit Kita-Kindern „Ich sehe was, was Du nicht siehst“ – und die Fotos zeigten Blicke in die Gärten und Endlosen Energiepflanzenfelder, auf übervolle Aschenbecher an Straßenrändern, die Cameras richteten sich aus den Fenstern der „Platte“ oder auf gegenüberliegende leergezogene Häuserfronten. Ausgestellt in den Schaufenstern des Pasewalker „Woolworth“. Ich arbeite als Einzelkämpferin nach sozio-kulturellem Konzept in kreativer und gewaltpräventiver außerschulischer Bildungsarbeit in verschiedenen Werkstätten auf den Dörfern im Kreis Vorpommern-Greifswald. Meine Eltern waren lebenslang in der SPD – in einem sauberen westlichen Eigenheimdorf. Wenn auch nicht Parteigängerin – so fühle ich mich seit jeher linken Haltungen zum Menschsein verpflichtet. Vom Neigungsberuf Autorin und Bildende Künstlerin habe ich viele Kunst- und Hörspielwerkstätten, 28 Jugendclubs nach der Wende hier im Altkreis Uecker-Randow, heute Vorpommern- Greifswald, wieder aufgebaut, Festivals wie Nordischer Klang, Polnische Woche und Tanztendenzen und viele Ausstellungen im Land M-V organisiert. Diese Arbeit wurde mehrfach überregional, gewissermaßen „platonisch“ (ohne finanzielle Förderung) ausgezeichnet, u.a. mit dem Dt. lokalen Nachhaltigkeitspreis und als „Ausgezeichneter Ort im Land der Ideen“ – die Urkunde war von der Deutschen Bank ausgelobt (was ich mittlerweile als zynisch empfinde) und von Ihrem Vorgänger Joachim Gauck unterschrieben. Mit den Menschen hier teile ich nun eine 25jährige gemeinsame – solidarische – Geschichte. Das Glück, unterscheiden zu können zwischen den demokratischen Lernerfahrungen im Westen und der Erfahrung des „Wachsenmüssens demokratischer Strukturen“ schenkt mir den Blick für die Mängel und auch Vorzüge dieser nordostdeutschen Region. Ihrem Vorvor-Gänger Johannes Rau habe ich auf seinen Wunsch hin in den ersten Jahren nach meiner Übersiedlung aus dem Ruhrgebiet in mehreren Briefen über diese Erfahrungen berichtet, die wohl noch in Ihrem Archiv sein werden. Oft auch bedrückende Berichte, auf die er stets „mutmachend“ antwortete.
Doch mehr als ein Mal stehe ich vor den Abgründen westlich getönter, ignoranter Arroganz und der sie begleitenden zunehmend bedrückenden Hilflosigkeit der Bevölkerug gerade hier im ländlichen Raum am Rand der Republik. Ich hätte Ihnen, als Kennerin der umgebenden Dörfer, in denen ich mit meiner KinderAkademie im ländlichen Raum seit 12 Jahren überwiegend ehrenamtlich arbeite, voraussagen können, in welchen Dörfern AfD und NPD gewählt wird. Keine Überzeugungskreuze wurden da gesetzt. Diese Kreuze sind Synonyme für einen Satz wie „Da es jetzt noch schlimmer als früher ist, ist es sowieso egal, aber das Vertrauen ist schon lange verspielt.“
Denn: Der oft extreme Mangel an Empathie, an Zeichen von Zugehörigkeit/ Solidarität und Verständnis der Regierenden mit den Leuten hier auf dem Land ist nicht zu übersehen! Die Sehnsuchtsalternative „Landleben“ gibt es hier „nimmer“. Wie kann man hier weiter leben, wenn tagtäglich die Landmaschienen einige hundert Male durchs Dorf donnern, wo das Trinkwasser einige bedenkliche Grenzwerte aufweist, das Glyphosat ungehindert in die Gärten gespritzt wird, die sich an den Rändern der Felder befinden, wenn die letzten Natur- und Lebenswert-Räume mit monströsen Windenergieparks (mit 230 m hohen Mühlen) verstört und schließlich vernichtet werden ohne, dass die Betroffenen Einfluss nehmen, die Betreiber aber durchaus mit Vernichtung von Greifvogelhorsten Tatsachen schaffen können, wenn die Gülle und Gärreste aus Europas größten offenen Depots zum Himmel stinken ebenso wie die in den abgeholzten Waldgebieten einbetonierten Biogasanlagen wie Pilze in den Himmel schießen und Schlafen bei offenem Fenster ein Traum bleibt, ja, wenn Sie in der Dämmerung zu Erntezeiten der Energiepflanzen von nahen ohrenbetäubenden Schüssen aufgeschreckt werden, weil 10 Meter weiter mit den sich lichtenden Feldern durch Erntewagen das Wild in die Enge getrieben und in Massen von alljährlich herbei gereisten Westjägern – hier aus Vechta und Aachen – abgeschossen und in den Westen zum Verkauf fort transportiert wird. Ich erlebte es – erst gestern bei einer Geburtstagsfeier – vom Wohnzimmer meiner Nachbarn aus! Lebt man noch gern auf dem Lande, wenn wie in diesem Sommer einige Tage hintereinander Transall-Maschinen im Tiefflug – einen beim ersten Mal existenzialen Schock auslösend – über die Wälder, Häuser und Gärten jagen, ein Versuchsprojekt zwecks Vergrämung der Greifvögel für die geplante Installierung der großen Windparks, ging das Gerücht, nachdem die Flugaufsichtsbehörde dazu keine Angaben machen konnte.
„Meine“ Kinder kommen meist ohne Frühstück in die Werkstätten, verlieren ihren Hortplatz, wenn die Eltern nur minimal zu viel verdienen, werden als Begabte nicht wirklich gefördert, weil man sie in den zunehmend vor Schließung bedrohten Regionalschulen halten will. Man verzagt, wenn man Sie im Altherren- Club der betuchten Unternehmer der nächsten Kleinstadt – nach einem mit Publikationen und Ausstellung mit Arbeitsbeispielen illustrierten Vortrag über meine außerschulischen Werkstätten und Exkursionen – verächtlich ermahnt und regelrecht abbügelt, doch erstmal die Bildungsgutscheine der Hartz-Kinder auszufüllen, bevor Sie hier das Ansinnen formulieren, einen Zuschuss von wenigen hundert Euro für Museumsbesuche und Werkstätten zu erhalten. Weil halt gerade die Fahrkosten im ländlichen Raum am höchsten sind (Honorare, Aufwandsentschädigungen? Das erwarten wir hier schon lange nicht mehr!). Ja, und diese Herren sind zumeist Jäger, um aufs letzte Bild zurückzukommen – und einer der hier den Alltag der Leute beherrschenden Agronome, die hier intensive Landwirtschaft auf dem Rücken von Bevölkerung und Natur betreiben (in der Regel aus den „alten“ Bundesländern) – wird demnächst für die Villa seiner Jagdgesellschaft einige Kilometer weiter die Summe von 200.00 Euro aus EU-Mitteln erhalten, das wurde bereits mit Ausnahme von 2 Personen von der Jury abgenickt. (Auch für die Bearbeitung und Betreuung eines überaus umfangreichen Antrages braucht es Steuermittel.)
Ja, den Menschen wird „die Heimat“ (ein Wort, das hier nicht mehr verwendet werden darf und in Zusammenhang mit „Heimatpflege“ kürzlich aus einer soziokulturellen Dorf-Vereinssatzung gestrichen werden musste) unter den einst geerdeten Füßen der vielzitierten DDR-Mängelwirtschaft weggezogen. Sie werden verächtlich und zynisch von Politikern (teilweise immer noch die Wendehälse oder eben „Wessis“) und der Wirtschaft behandelt, stehen oft in gemeinsamer Front gegen die Bevölkerung wie bei der Durchsetzung monströser Windparks in unzerschnittenen Naturräumen. Die kleinen Bauern, zuvor nie politisch motiviert, stehen plötzlich schüchtern und stumm mit selbstgemalten Plakaten vor dem Gemeindesaal vor einer Sitzung ihrer Vertreter, die sie kaum eines Blickes würdigen. Wie sollen sich die Menschen hier fühlen? Für unsere wirklich vergessene und zunehmend hier und da kritisch auf Missstände zeigende Region wurde aus Schwerin ein „Vorpommern-Kommissar“ eingesetzt, ausgestattet mit 2 Millionen. Als ich ihn kürzlich mit einer ehrenamtlich mitarbeitenden Mutter besuchte und um einen Zuschuss für unsere Werkstätten bat, bot er mir als auch Vorsitzender der Volkssolidarität an, für das „sehr gute Honorar der Volkssolidarität“ Werkstätten in deren Kitas abzuhalten – sinngemäß: Von dem Honorar fallen dann die nötigen Gelder für Ihre Ausflüge mit den Kindern ab. * Ob auch er mit seinem Gehalt seine Projekte finanziert? Für mich als Autorin, Kulturarbeiterin und Bildende Künstlerin, als jemand aus dem politisch eher linken Spektrum ist nun bald „Schicht“ und die Kraft gegen diese Form undemokratischer Administration in nachhaltiger soziokultureller und existenzieller Unsicherheit nach zweieinhalb Jahrzehnten verbraucht. Die Geduld ist zu Ende und die Frage lautet: Weitertun? Wegziehen nach so vielen Jahren des Vertrautseins mit Region, Landschaft und Menschen? Die Kinder im ländlichen Raum, die Eltern oft arbeits- und mental mut- und orientierungslos, oft krank, als letzte Glieder dieser Gesellschaftskette, für die allein ich diese Arbeit tun konnte, im Stich lassen?
Mein Mann, der mich in meiner Arbeit immer beraten und begleitet hat, starb vor 4 Monaten plötzlich. Angesichts der derzeitigen Situation eine komplexe Herausforderung, hier zu bleiben.
Ich erwarte Ihre geschätzte Antwort mit Spannung.
Mit herzlichen Grüßen aus dem herbstlichen Aschersleben in Vorpommern
Angelika Janz
KInderAkademie im ländlichen Raum
Aschersleben 32
17379 Ferdinandshof
Fotos: Angelika Janz
Schwarze Mamba
Martina Kieninger
Aus dieser Wohnung, die vor einigen Jahren auch mir gehörte, die ich verlassen habe mit all ihrem Mobiliar, dem Sofa aus Kunstleder, der dunklen Kredenz, der Esszimmergarnitur – ein sehr geschontes Mobiliar, immer noch liegen die Schutzhüllen aus Plastikfolie über den rotsamtnen Sitzflächen der geschnitzten Stühle – aus unserer Wohnung zog ich zu ihr.
Es ist nicht einmal auszuschliessen, dass ich sie, meine Ex, wegen dieser Plastikhüllen über den Samtsitzen verlassen habe. Diese Hüllen: sie wirkten auf mich wie materialisierte Übervorsichtigkeit, eine Schonhaltung dem Leben gegenüber, abwaschbare Lebensangst, ein Leben wie nicht gelebt, das mich in die Zimmerfluchten des Palacio Salvo verschlug, in ein umfunktioniertes Hotelzimmer mit mamornen Mosaikböden, altmodisch hohen Zimmerdecken, schmalen Fenstern.
Mit zwei Koffern zog ich um, nur Kleidung und Bücher, hängte meine Anzüge neben die Kleider meiner Frau, ihre Kostüme und Blusen, den Rest, die Stühle, Tische, Teller und Töpfe hatte ich meiner Ex überlassen, nie waren sie mein Besitz gewesen, es waren immer die Möbel meiner Ex gewesen, ihre Couchgarnitur aus weissem Kunstleder, ihre Kredenz, ihr Esstisch, ihre hochlehnigen Stühle mit den rotsamtnen Sitzpolstern und Plastikfolien darüber. Ob ich letztlich wegen dieser Plastikhüllen über dem Polstersamt ausgezogen bin, wegen der Kredenz mit den blassen Blumen und leeren Parfumflakons, weiss ich nicht zu sagen, Schonen und Besitzen, meine Ex, ich stelle dies immer wieder mit großem Erstaunen fest, Maria Jose kann sich sowenig von ihren Besitztümern trennen wie ihre Mutter, auf deren Schrank sich noch die alten Koffer stapeln, mit denen sie in den Fünfzigern nach Buenos Aires reiste. Besitzen und Festhalten – es war dies der sicherste Weg, mich zu verlieren. Komme ich – selten genug – in diese, meine ehemalige Wohnung, so stehen die leeren Flakons noch immer auf der Kredenz wie eine Erinnerung an die Parfums, die ich meiner Ex im Laufe unserer Ehe geschenkt habe – ich verstehe diesen Sammeltrieb nicht. Vielleicht erlangt Maria Jose durch das Aufbewahren dieser an sich wertlosen Dinge ein gewisses Gefühl von materieller Teilhabe an der Welt, die sie in Wirklichkeit nicht besitzt.
Wir leben also im Hotel, ich und meine Frau, in einem ehemaligen Hotel, dessen Zimmerfolgen Mitte der Siebziger zu verschiedenen Wohnungseinheiten zusammengestellt wurden, weitervermieteten, meist möblierten Wohnungseinheiten, in einer angemieteten Wohnung leben wir, die eigentlich keine möblierte Wohnung mit funktionsfähiger Ausstattung ist, eher ein Grab der Dinge.
Dinge wie Ausgrabungsgegenstände, wie auf einem Sediment, schichtweise überlagerte unser zunehmender Besitz das, was an Einrichtung zur Vollmöblierung der Wohnung gehörte, bei ihrer Anmietung. Das Besteck, das Helene, meine Frau neu gekauft hat, überschichtete die Altbestände in der Küchenimprovisation, auf die zerbeulten Billigtöpfe stellte sie die guten, neuen, die sie von einer Europareise mitgebracht hatte, den Rest: Ölbilder von Sturm und Seenot, das Bettzeug, mitgemietet, der Geruch fremden Schlafs, hatten wir in Plastiktüten hinten im Schrank verstaut ebenso die leeren Parfumfläschchen von Simsen und Ablagen.
Das Aufbewahren alter Parfumflakons, deren Inhalt längst verbraucht ist, scheint mir – ich möchte darin ein südamerikanisches Phänomen erblicken, denn Helene, die einst eher zufällig als Lebensabschnittspartnerin eines Berliner Diplomaten nach Montevideo gelangte, sich nach Verschwinden des Botschaftsangehörigen jedoch zum Bleiben entschloss, Helene entsorgt die Glasflaschen umgehend, nicht so Maria Jose, meine Ex, auf deren Kredenz noch Exemplare aus den späten Achzigern stehen, verstaubende Geschenkpackungen in beflockten Pappschachteln mit barockprächtig goldgestanzten Markennamen der längst verbrauchten Inhalte, Massenware, die sie gleichwohl nicht wegwerfen kann, als ob die leeren Schächtelchen und Fläschchen, die Flakons und Döschen sich wieder von selbst füllten, sie werden zu Antiquitäten, erklärte mir Helene, wenn man sie nur lang genug aufbewahrt, aber nicht alle. Und nicht jede. Die von Lalique schon. Was meinst du, was man in Berlin dafür zahlt. Es ist nicht Lalique sagte ich, es ist Avon.
Von hier aus weiß ich eigentlich nicht, was ich noch erzählen sollte, so schrieb ich dem Ermittler, den ich beauftragt hatte. Ich liebe Maria Valkyria, Valkyria aus Buenos Aires, zugegeben, ich kenne sie nicht, ich kenne sie nicht näher und doch genau, ich kenne ihre Meinungen, ihre Ansichten, aus emails und postings und chats und blogs, doch besitze ich weder Anschrift noch Telefonnummer. Ich hätte sie gerne angerufen, doch davon wollte sie nichts wissen, sie war es, die mich anrief. Sie bestand darauf. Sie wolle mir ihre Telefonnummer nicht nennen und in vielen mails nannte sie mir die mehreren Gründe, die sie hinderten mir ihre Daten zu überlassen, sie nannte nur ihren Nachnamen, einen Nachnamen, der mit K beginnt, deutscher Abstammung vermutlich, Kunz vielleicht oder Kuntze, Kunze y Gomez, es ist keiner dieser seltenen Namen, auch wenn der Anfangsbuchstabe K keinen Spitzenwert bezüglich seiner Seitenzahl im Telefonbuch von Buenos Aires einnimmt, so ist Kunz wie Kuntze durchaus mehrfach vertreten, ich bitte Sie also um den vollständigen Datensatz der Dame mit Geburtsdatum, Geburtsort, einen eineindeutigen Datenzusammenhang, der nur und nur auf diese eine Person weist. Sie werden, sehr zu Recht, einwenden, dass der Nachname möglicherweise eine vollständige Erfindung der Dame sei. Dem habe ich wenig entgegenzusetzen, gebe jedoch zu bedenken, dass sie in diesem Fall wohl einen C-Familiennamen gewählt hätte, Casanova, Casablanca, warum also ausgerechnet deutsch? Darauf wußte er, der Ermittler, dem ich ein gewisses Verständnis für psychologische Stimmigkeiten unterstellen darf, nichts zu erwidern.
Die Daten, die ich besitze, umfassen also nicht mehr als diesen deutsch-spanischen Nachnamen, den Maria Valkyria mir nannte, sowie ihre email-Adresse, eine Versteckadresse übrigens, eine Adresse bei einer dieser Werbeplattformen, hotmail, gmail, die sie sich gesichert hat unter einem Spitznamen, patalapata@gmail.com. Sie wissen hiermit eigentlich alles, schrieb ich dem Ermittler. Glauben Sie mir, dass ich nichts unversucht ließ, die zu patalapata gehörige IP-Adresse herauszufinden, Gebiet, Anbieter, von dem aus sie ihre emails verschickte, es war vergeblich, es spricht für ihre Intelligenz, ihre Computererfahrung, sie hatte mit Anonymisierern gearbeitet, aber warum? Von Beginn unseres Meinungsaustauschs bis zur letzten Zeile schrieb sie unter Zuhilfenahme der misstrauischsten Software, ein Umstand, den ich ihr gegegenüber in einer diesbezüglichen mail erwähnte, nicht etwa vorhielt, wofür sie jedoch eine Antwort von gewisser Nachvollziehbarkeit hatte, eine Antwort, die hier nichts zur Sache tut.
Nur ein einziges Mal konnten wir, ich und ein Kollege, den ich ins Vertrauen gezogen und um Hilfe gebeten hatte, den Standort des benutzten Rechners ermitteln, es handelte sich um ein Call-Center in Nähe des Hafens. Ich stelle mir vor, wie sie, Maria Valkyria, dort zwischen den Begrenzungspappen der Halbkabine sitzt, hinter sich das Telefongeschrei schlechtbezahlter Seeleute, die dort zu den billigeren Tarifen in ihre Heimatländer telefonieren.
Aus der Vorstellung der schwatzenden Callcenter trat ich an jenem Abend in die schweigende Wohnung – es schwieg die Wohnung, die ich betrat, Helene wird ins Bett gegangen sein, sagte ich mir, sich auf die von uns angemietete Matratze gelegt haben, prall von den Träumen derer, die vor uns im Vollmöblierten hausten, dem Schlafgeruch der Vormieter, auf den Schichten des Geruchs wird sie liegen, doch unter der Badezimmertür, durch den unteren Spalt zwischen Tür und Fußboden drang Licht, ich öffnete die Tür zum Bad um die Lampe auszuschalten. Helene saß auf dem Badewannenrand.
„Du rauchst?“
„Nein“, erwiderte sie und zog an ihrem Zigarillo.
„Still.“
Eigentlich bestand kein Anlass zu dieser Aufforderung, klar und deutlich drangen die Worte aus dem Rohr, sie rutschten aus der Rohrleitung, es war keine Lauschanstrengung nötig.
„Ich weiß wirklich nicht, was du damit anfangen willst“
Es war nicht herauszufinden, woher die Stimme kam. Wo sich die Wohnung befand, in der diese Worte gesprochen wurden, aus welcher Wortrichtung die Sätze drangen, war im Augenblick nicht mit Bestimmtheit zu sagen, Denkpause, dann eine Entgegnung, seine Entgegnung, eine Männerantwort, still, nicht so laut, was sollen denn die Nachbarn von uns denken, vielleicht, ich weiß es nicht, dunkle, schlecht übertragene Worte, nicht klar zu verstehen, nun lachte die Frau.
„Die Laken auch?“ fragte sie, die Stimme durch die Rohre, eine volle, dunkel getönte, sehr weibliche Stimme, eine Stimme von Üppigkeit und Erotik .
„Gut, werfen wir die Münze. Ich will mich nicht streiten.“
Wir hörten die Frau oben kichern
„nicht um ein paar Bettlaken“ –
„Streiten! Du willst nicht streiten. Das ist mir neu“
Seine Antwort verrauschte in den Rohren.
„Obwohl“, so fuhr die Frauenstimme fort, wie gewillt, ihn zu überhören: Obwohl ich wirklich nicht weiß, was du mit Bettlaken anfängst, du wirst ihr doch wohl kaum unser altes Bettzeug mitbringen wollen“. Vielleicht sagte sie auch „ anbieten“ statt „mitbringen“ – ich weiß es nicht mehr, die Sätze waren nur zur Hälfte verständlich, ich reimte den Rest zu meiner Vorstellung, ergänzte ihn.
Sie kicherte. „Und außerdem habe ich sie bezahlt.“
„Wen?“
„Die Laken, aber bitte.“
Ich sah Helene an: „Das verspreche ich dir, Helene: sollte ich hier ausziehen, werde ich nichts mitnehmen, nichts, gar nichts.“ sagte ich, obwohl es keinen Anlass zu einem solchen Satz gab, doch Helene sagte nichts.
Wir saßen lauschend, schweigend auf dem Badewannenrand, versuchten, weiterhin vergeblich, den Wortwechsel zu orten, Schallverzerrung, das Hotel durchziehn die Rohrsysteme, Zufuhr und Abwasser, ich kenne nicht die Wasserwege im Palast, die Rohre der Entsorgung nicht, nicht die Rohrwege der Mülltüten, die wie schwere Frauenkörper, bleich und willenlos wie Leichen mit weichen Geräuschen ihren Weg durch die Stockwerke fallen, plötzlich die Koordinaten der Stimmen fast peilgenau zu erfassen, sie waren über uns, ich habe sie mir eingeprägt, die Geräusche, die Wege des Schalls und ich hätte schwören können – doch davon später.
Vielleicht waren sie nur ein einziges Stockwerk von uns entfernt.
„Unwahrscheinlich“ stellte Helene fest: „falls die Wohnungen über uns dieselbe Raumaufteilung besitzen. Ich glaube nicht, dass die beiden auf dem Fliesenboden ihres Badezimmers hocken um Laken zu verteilen. Sie müssen im Schlafzimmer sein“
„Vielleicht ist die Tür offen. Die Tür zum Bad.“
Es ging weiter.
Schritte in klappenden Hacken und in diesen – aber das konnte ich selbstverständlich nicht hören – Seidenstrümpfe um madenbleiche Beine– so stellte ich sie mir jedenfalls vor – vermutlich aus dem Schlafzimmer über den Korridor am Badezimmer vorbei in die Küche, der durch Rohr, Boden, Wand übermittelte Klang der Schritte deutete darauf, dass sich die Wohnung tatsächlich genau über der unseren befand.
Nun klar und deutlich die Worte: Du auch? Dann ein Ziehen und Ploppen wie von einer Kühlschranktür, wie die Überwindung eines leichten Unterdrucks, der die Kühlschranktür verschlossen hält, Flaschenklirren, still, sagte Helene wieder, sie könnten uns hören, sie könnten hören, dass man ihnen zuhört, es wäre peinlich.
Ich sagte nichts, stattdessen stellte ich mir ihren Mund vor, den Mund da oben, den passenden Mund zur Rohrstimme, wie er in den nach gärenden Nahrungsmitteln riechenden Atem des Kühlschranks hineinsprach. Dann mußte ich wieder die Beine zu den Schritten denken, die ich nicht anders zu denken vermochte als prall und bleich, die zu den blassen Beinen passende Figur, füllig und wie nicht zu fassen, ich betrachtete die rauchende Helene und dachte an Valkyria.
„Und du willst wirklich die Töpfe?“ fragte sie wieder, die Stimme deutlicher durch die Rohre. „du kannst doch gar nicht kochen.“
„Wenn du schon so fragst, dann, ja. Ja, die Töpfe auch. Und die Hälfte vom Geschirr.“
„Fang auf“
Klirren. Kurz darauf hörte es sich genauso an wie es sich anhört, wenn einem Menschen ein Haken in die Magengegend versetzt wird. Woher ich das weiß, wieso ich weiß, wie sich das anhört, tut ebenfalls nichts unmittelbar zur Sache.
„Müßten wir nicht die Polizei rufen“ sagte Helene und ich schlug die Bar gegenüber vor.
Guck mal nach hinten, aber dreh dich nicht um, sagte ich zu ihr, zu Helene, sie drehte sich natürlich trotzdem um, die volle Halbdrehung, Helene kann nicht unauffällig schauen wie die Südamerikanerinnen, nicht mit gesenktem Lid durch den schwarzgefiederten Fächer der Wimpern blicken, allerdings erwies sich meine Bitte als überflüssig, denn es war nichts zu sehen von der Meinungsverschiedenheit in der Wohnung über uns , deren Zeuge wir durch die Rohre hindurch geworden waren, die Stimme erhob sich, ging nach vorne und stand im Licht der Scheinwerfer, die madenfetten Beine stimmten nicht, sie war sehr schlank, sie war wahrscheinlich etwas jünger als Helene und sie hieß Giovana.
Ich verstand ihn trotzdem, Sie kennen den Text sicherlich, obwohl sie die Worte bis zur Unkenntlichkeit in den Melodiebogen stauchte und zerrte, En fun da la / man do li na / ya noes tas pa / se re na tas – die Silben sinnwidrig zerschnitten und geklebt, ya noes tas pa – ya no estas pa müsste es heissen, / en la tim ba / de la vi da / me plan te con / sie tey me dio – Enfunda la fun dala la mando lina, geh heim, Alter, die Frauen sind nichts mehr für dich, Qué querés, Cipriano, was willst du, hast keinen Saft mehr – ya no das más jugo. Son cincuenta abriles que encima llevás. Ich werde im April fünfundfünfzig, es wäre mir angenehm gewesen, hätte Giovana einen anderen Text gesungen – nicht diesen Tango, der mich, ich gebe es zu, verstimmte, höchstens 26, 27, Valkyria hat eben erst ihr Studium abgeschlossen.
“Gut, dass wir die Polizei nicht gerufen haben,” flüsterte meine Frau.
“Helene”, sagte ich, “ich muß mit dir reden.”
Ich hatte das alles bereits mit meiner Ex durchlebt und auch dieses Mal fiel es mir nicht leicht. Sie solle es bitte nicht als Kritik auffassen, aber es stimme ja wohl, dass sie sich nicht für die Papiermühlen an der Grenze zu Argentinien interessiere, nicht für das Zusammenspiel von Wirtschaft, Naturschutz und Außenpolitik, ja, sagte sie, seitdem Stefan sie in Monte habe sitzenlassen, nicht für die Themen, fuhr ich fort, ihren Einwurf übergehend, denn schließlich bin ich nicht daran schuld, dass der Typ nach Deutschland abgehauen ist, nicht für Gewässerschutz, die ich, als Chemiker, mit einigem Interesse verfolge, dann betonte ich, wie harmlos freundschaftlich die Beziehung mit Valkyria, Maria Valkyria Kuntze y Gomez begann, öffentlich begann auf einem der Zeitungsforen und mit einer Antwort auf eine chemische Fragestellung, Dioxine betreffend, Valkyria, als angehende Ökonomin, wie sie sich an einer Zeitungsdiskussion bezüglich der Zukunft der Papeleras, der Papiermühlen beteiligte, wir schrieben uns in der Folge mit zunehmender Frequenz, öffentlich und jederzeit einsehbar, aber Helene hat sich, diesen Vorwurf kann ich ihr nicht ersparen, nie um dergleichen Themen bekümmert, weder um Ökonomie, Ökologie noch Südamerika, sie hätte mitlesen können, den Austausch, den wir hatten, hätte sie mitverfolgen können, Osvaldo und Valkyria, beso Valkyria, beso Osvaldo, Waldo, Walli, Walli, Waldo, so ging das webseitenlang und immer noch auf den unverschlüsselten Seiten, dann erst, vor drei Monaten tauschten wir die mail-Adressen. Ich muß mit ihr zusammenleben, es ist unvermeidbar und ich erwarte auch gar nicht, dass sie, Helene, mich versteht, ich werde zu ihr ziehen, in die Wohnung, die wir uns in Pocitos mieten werden, ich dachte, sie lebt in Buenos Aires, so Helene erstaunt, hast du nicht gerade vor fünf Minuten gesagt, dass sie in Buenos Aires wohnt? Sie kommt nächsten Monat nach Montevideo, wenn sie, Helene, auf Deutschlandbesuch sei, dass ich Valkyria vom Flughafen abholen, dass ich mit Valkyria zunächst ins Victoria Plaza ziehen werde und dass ich sie, helene, davon habe vorab informieren wollen.
Ich hätte, sie, Helene nicht in gleicher Weise vor vollendete Tatsachen stellen, sie mit Valkyria betrügen können wie ich meine Ex, wie ich Maria Jose mit Helene betrog, ich hätte ja auch einfach gehen können, das müsse mir zugute halten, meine Hosen und Hemden aus dem Kleiderschrank nehmen können, sie, Helene hätte bei der Rückkehr von ihrer Reise die Wohnung leer gefunden, es wäre leichter gewesen für mich, es hätte in jenem Monat zwischen Geständnis und Ankunft diese zahlreichen Gespräche über Valkyria nicht gegeben, über ihr Aussehen. Alter, Genaues, alles wollte sie, Helene, wissen und ich nehme an, dass sie daran zweifelte, dass selbst mir nicht viel mehr bekannt war als email-Adresse, jpg-Datei und Vorname, den Helene wie einen dicken Kloß im Hals ausspricht, da sie das R nicht auf spanische Weise zu rollen vermag, Valkyria, nicht viel mehr als ein Name und doch kenne ich sie besser als ich Maria Jose kenne oder Helene. Ich kenne sie als lebten wir schon seit Jahren zusammen und einen Monat nach jenem Abend fuhr ich zum Flughafen.
Wie ich dem Beauftragten, dem Nachforschenden schon beim ersten Gespräch berichtete, wartete ich am Flughafen in Carrasco vergebens auf eine Maria Valkyria Kuntz oder Kunze.
Nach zwei Stunden beschloß ich, zum Palacio Salvo zurückzukehren, Helene würde die Wohnung bereits verlassen, sie würde ein Taxi gerufen haben, vielleicht würden sich die Taxis, die wir benutzten, sie stadtaus und ich stadteinwärts, noch kurz auf der Rambla begegnen, vielleicht würde ich noch sehen, wie sie am Taxistand vor dem Flughafengebäude mit ihrem Koffer ausstieg. Aber ich traf sie nicht. Vor dem Flughafengebäude schrie ein Bettler einem wild gestikulierenden Trenchcoat hinterher:
“Merken Sie sich das, ich bin Bettler und kein Dienstleister.”
Ich beschleunigte meine Schritte, erreichte den Trench gerade noch, bevor er in sein Auto stieg.
Er griff ins Innere seines Mantels, ungefähr in Brieftaschenhöhe griff er sich ins Mantelinnere, zog an einem Stück Schlauch, etwa daumendick, dessen Kopfende er mir entgegenhielt.
„Was sagen Sie dazu?“ fragte er: „Dieser Mensch, der sich nicht zu schade ist, sein ganzes Leben dem Bürgersteig zu widmen, hat sich geweigert, das heiligzusprechen, was mir das Heiligste ist, meine schwarze Mamba.“
Ich weiß nicht, wie eine Mamba aussieht, ich weiß bis heute nicht, ob es wirklich eine Mamba war, aber ich halte es für möglich.
Die Wohnung im Palacio Salvo war leer und ich ging ins Bad.
„Carrasco“ sagte die Frauenstimme, die ich durch die Rohre hörte, eine Stimme mit einem dicken R, einem deutschen R, das tief im Hals sitzt wie ein Kloß: „Er wird sie jetzt wahrscheinlich ins Victoria Plaza bringen“.
Belichtetes Papier
Angelika Janz
Belichtetes Papier oder
Er denkt an sein Land

Es galt, die dunkelsten Stellen auf dem Papier abzulichten. Gefahren warten nur auf jene, die nicht auf das Leben reagieren. Es galt, die Grenzen des Sagbaren – oder Unsagbaren – immer weiter hinauszutreiben, in Regionen, in denen ihre Sprache eine eigene Wirklichkeit schuf. Das Wissen über den Glauben war verloren gegangen, der Glaube an das Wissen überlebte. Am Ende galt es, den Glauben an das Wissen durch das Wissen selbst zu verlieren.
Das Blatt, das die Kopiermaschine ansaugte, gemäß ihrer Bestimmung, die dunkelsten Stellen auf dem Papier abzulichten, war leer. Oder nicht? Als es wieder hinaus glitt, war es ein anderes. Es war markiert. Die erwartete Kopie des Originals blieb aus. Die Maschine signalisierte einen Defekt.
Ich griff nach dem Original. Nach dem, was ich für das Original hielt. Dort gab es in der Mitte des Blattes eine dunkle Zeile, Buchstaben, die an den Rundungen unterbrochen waren, wieder ins Weiße hinein. Das Wort ließ sich lesen, es hieß Wiederholung. Das aber war nicht mein Wort.
Seit einigen Tagen kopierte ich in dem Büro am Mariannenplatz das Material für eine kleine Publikation visueller Poesie. Diesen Fragmenten ging es wie dem letzten Menschen eines ausgestorben geglaubten Stammes, den es erklärungslos in die westliche moderne Welt verschlagen hatte und der, von ein paar Sonnenstrahlen getroffen, dort erwacht. Ich hatte Monate zuvor einen Roman darüber geschrieben, ihn in eine kleine Holzkiste gepresst und diese für immer zugenagelt.
Das Büro lag isoliert von allen anderen Räumen am äußersten Rand des Komplexes. In dem ehemaligen Krankenhausgebäude einen Steinwurf vom Sperrgebiet der deutsch-deutschen Grenze entfernt verbrachte ich 6 Monate eines Kulturstipendiums. Ich hatte einen Kopierschein. Ich schuf mir damit die Arbeitsgrundlage für mein Stipendium. Doch jetzt hatte ich eine Zwangspause.
Die Schreibkraft am Schreibtisch nahe der Tür hielt in ihrem emsigen Schlagen auf Buchstabentasten inne. Sie schlug die Sprache, die sie auf weiße Blätter übertrug, das hatte ich deutlich im Kopf. Sie riss das engbeschriebene Blatt heraus und spannte in Windeseile ein neues ein. Hektisch setzte sie mit allen 1o Fingern zugleich ein einziges Wort aufs weiße Papier. Dann riss sie das Blatt wieder heraus. Sie schrie auf.
Blass war sie, ihre rosa geschminkten Lippen bebten, als sie zu mir ans wuchtige Kopiergerät trat, das parallel zu den breiten unverhangenen Fenstern aufgestellt war. Die Fenster gaben die Aussicht auf den unbegrünten, in langen Bahnen geharkten Grenzstreifen und den in seinen Konturen scharf heraus stechenden Kontrollturm frei. Das spätnachmittagliche Oktoberlicht schien in der Gräunis der zugemauerten Fassaden gegenüber ersoffen. Dort war die andere Welt, einen olympischen Steinwurf entfernt. Und doch ferner als Australien. Der Wachturm schien nahe herangerückt. Man konnte hinter dem länglichen Fenster des Turms den anonymen Oberkörper des diensthabenden Postens sehen. Er richtete sein Fernglas direkt in unser Büro. Offenbar galt sein Interesse nicht uns, die wir uns unschlüssig im Zimmer hin und herbewegten, sondern dem Kopiergerät und der beeindruckend großen elektrischen Schreibmaschine weiter hinten auf dem Tisch nahe der Tür. Das teilten uns seine hektisch das Glas führenden Bewegungen zwischen den beiden Geräten mit. Es war im Jahr 1986. Jetzt erst bemerkte ich, dass die Schreibdame, die mir nur wenig vertraut war, das Blatt in der Hand hielt. Ihre Hand zitterte und auf dem Blatt stand d a s Wort. Konnte der Kopierer ein Original verschlucken und es gegen ein anderes austauschen?
Im Flur kein Laut, es war kurz vor Feierabend. Der Büroraum lag am äußersten Ende des Gebäudes. Auf einem großen Tableau an der Flurwand hatte ein Künstler einige Dutzend schlecht präparierte tote Tauben angenagelt, in dessen Umfeld goldschimmernde Motten flatterten. Niemand hielt sich in den andren Räumen auf. Vereiste Zeit, eine Zeit ohne Vereinbarungen, ohne augenzwinkernde Zukunft. Im Raum das kanonische Summen der beiden Geräte. Vernetzte hardware war zu dieser Zeit in normal funktionierenden Büros nicht selbstverständlich wie heute und kaum mit Erfahrungswerten in Berührung gekommen. In dem Büro gab es kein Schreibgerät, das mit einem Druckgerät kausal verbunden war und schon gar nicht mit dem Kopierer.
Sanfte Wellen verbrauchter Luft aus den Gebläsen der Geräte versetzten unser Haar in flimmrige Vibration. Das war die einzige unkalkulierbare Bewegung in diesem Raum.
„Ich wollte es nicht schreiben“, stotterte die Frau mehr für sich, „die Maschine tat es für mich…meine Finger…“
„Sie mussten das Wort schreiben?“ fragte ich neugierig.
„Nein“, erwiderte sie. „Ich wollte es, ich schrieb es, aber ich weiß wirklich nicht, warum der Kopierer es protokolliert und gedruckt hat.“
Der Raum war eine Bühne. Eine Bühne mit Augen. Er beobachtete uns.
Sie richtete ihren Blick auf das Blatt, das ich nun in der Hand hielt. Sie schrie auf, grell, wechselte die Gesichtsfarbe: „ Das Kopiergerät muss ein Empfänger sein !“ Hochrot im Gesicht atmete sie theatralisch zwei Mal tief durch und sprach im genervten Tonfall weiter: „Ich bin jetzt fünfzehn Jahre hier und gucke immer auf diesen verdammten Streifen. Die Büroordnung gestattet weder Vorhänge noch Jalousien. Ich habe einmal nachgefragt, warum eigentlich. Das Zimmer sei groß genug, um der Sonne auszuweichen, hieß es. „ Warum erzählen Sie mir das ?“, fragte ich. „Weil sie uns ma-ni-pu-lieren – sie stören täglich meine Arbeit, sie beeinflussen sie, sie verfremden sie!“
Ich war beeindruckt. Mir gefiel, was sie sagte, weil es mehrdeutig war. Damals liebte ich das, weil es ein Schreibversprechen war. Sie deutete auf ihren Arbeitsplatz nahe der Tür. „Sehen Sie, ich hab es mit Distanz versucht. Da sind aber die Balkone und Fenster, drüben, sehen Sie, alles in Ostfarbe, graubrauntrüb. Sie arbeiten dahinter. Da ist immer jemand.“ Sie kicherte. Das Kichern wirkte traurig und selbstbeschwichtigend.
„Länger als zwei Minuten krieg ich da keinen zu Gesicht. Die schaffen sich immer schnell ihre Abgänge. Ist ja auch kein Anblick, das hier, dieses Bürro.“ Sie sprach das Wort zynisch und fast hasserfüllt aus. Man spürte, sie mochte sich nicht und auch nicht ihre Arbeit. Aus ihrem Mund gepresst stand das Wort wie ein politisch brisanter Begriff im Raum. Er passte nicht zu ihr.
Sie war das, was man eine nette Person im besten Alter nennt, trug eine röllchengelegte Frisur um den runden Kopf mit dem immer etwas zu bunt geschminkten Gesicht mit randloser Brille, jugendlich betonte Kleidung rund um den leicht fülligen Leib drapiert oder gewickelt. Die paar Male, die ich sie beim Kopieren erlebt hatte,verrieten: sie konsumierte gern Süßes, trank Auratee und war unpolitisch.
Das Unpolitische war ein bedeutender Teil ihrer Persönlichkeit, wie sie gerne betonte. Sie verwischte mit der Rückhand fahrig ihren Lippenstift. „Aber die da, die, die zwei, die machen sich einen Spaß mit mir. Die kenne ich,“ sie rang nach Luft, „verstehen Sie, ich bin für die ein Opfertyp, Ost gegen West, Sie verstehen, ich könnte ganze Romane darüber zusammenschreiben, wenn ich es hier nach Feierabend nur länger aushielte.“ Mit leisem Stolz fügte sie, auf die Maschine weisend, hinzu: „Das Ding da, das schreibt nämlich wie gedruckt.“ Und dann, gequält: „Ach, und die Ablösungen! Tagtäglich diese Ablösungen! Wenn man nur die Uhr danach stellen könnte!“ Sie setzte ein unbeteiligtes Gesicht auf. Es wirkte wirklich aufgesetzt. Und mit flüchtigem Blick auf das Blatt in meiner Hand tadelnd: „Was soll das, Verschwenderin? Sie haben das leere Blatt belichtet.“ Ich sagte: „Tut mir leid, ich habe das weiße Blatt nicht belichten wollen. Naja, ganz leer ist es nicht. Dieses eine Wort darauf ist vielleicht in Ihren Augen nicht der Mühe wert. Was in mich gefahren ist, es doch zu kopieren, weiß ich nicht. Vielleicht diese immer gleichen Handgriffe der letzten Tage. Ich kann mich an dieses Wort gar nicht erinnern. Sie wenigstens tun mit Kopf und Hand das Ihre. Ich aber tätige das meinige nur mit den Händen.“
„Ich muss mir das Mitdenken leider immer verbieten“, sagte die Schreibkraft plötzlich patzig, als habe ich ihr gerade ein Privileg genommen. „Ob ich was abschreibe oder nach skizzierten Anweisungen oder vom Diktaphon schreibe – ich schalte das da ab.“ Dabei tippte sie mit dem rosa lackierten Zeigefinger gegen die Stirn. Sie hatte Stummelfinger, an deren stumpfen Enden lange rosa Fingernägel klebten. Was sie sagte, glich ihren Fingern. „Immer ab schalte ich, immer ab. Ich entscheide hier nicht – , nein, niemals! – eigenmächtig. Ich arbeite eins zu eins. Man vertraut mir vollkommen.“
„Sie ist nun ausgeklinkt“, dachte ich.
Meine Schulter berührte die ihre. Ihr fades Parfüm vermischte sich mit dem Schweiß eines 8-stündigen Bürotages. Wir standen nebeneinander vor dem Fenster, jede mit einem weißen Blatt Papier in der Hand, auf dem ein einziges, das selbe Wort in Druckbuchstaben stand. Irgendwie gelang es uns nicht, vom Fenster wegzutreten. Wir hätten auf dem Gang eine rauchen können, um die Motten zu erschrecken. Im Archivraum einen Kaffee trinken können.
Auf unseren Gesichtern brannte der Fernblick der fremden Grenzbeamten. Menschen, die wir niemals kennenlernen würden. Ihre Blicke wanderten über die Flächen unserer Gesichter, tasteten unsere Körper ab, untersuchten jeden Gegenstand im Raum. In mir schwelte eine fast leidenschaftliche Unlust an der Situation, eine lähmende Gemütstrübnis, der keine Übelkeit folgen wollte, Überdrussempfinden, das aus Ohnmacht entsteht. Wir waren wie abbildhaft fixiert und vollkommen unsinnlich, wir hätten nackt dastehen können, beschmutzt, vergreist. Als Fremde oder als Feindinnen und zu niemandes Freude.
„Es muss eine Verbindung geben zwischen dem Kopiergerät und Ihrer elektrischen Schreibmaschine,“ sagte ich angesichts der deckungsgleichen Worte auf den Blättern in unseren Händen. Damals war es tatsächlich unvorstellbar, was heute selbstverständlich ist. Und es konnte auch keine Verbindung geben, weil niemand je eine solche in Betracht gezogen hatte. Man schrieb in der Regel in normalen Büros auf einer mechanischen oder elektrischen Maschine, und wenn man es wünschte, kopierte man das Getippte noch einmal. Der Kopiervorgang pro Blatt dauerte eine Zeitlang. Es war ein langsamer Umwandlungs- und Produktionsprozess, bei dem man als Wartender mitdachte. Man stand, atmete flach und gestaltete Zeit ganz für sich, bis so ein Blatt langsam das Gerät verlassen hatte. Man atmete Gase ein, die das Gebläse ausstieß. Das Gerät, in dessen Innern chemische und physikalische Prozesse lärmend an einem sichtbaren Ergebnis arbeiteten, war rigide, launisch und in seiner Erscheinung aufdringlich und nahezu gewalttätig. Wenn ich heute das damals so Selbstverständliche zu erklären versuche, schäme ich mich etwas. Ich habe das Gefühl, etwas Vertrautes zu verraten.
„Es gibt keine Verbindung,“ sagte die Schreibkraft schroff, fast böse.
„Dann sind es Strahlungen“, erwiderte ich aufs Geradewohl.
Plötzlich fuhr die Schreibkraft auf. “Darf man erfahren, was Sie seit einer Woche ständig zu kopieren haben?“ Sie steigerte sich in einen Verhörjargon: „Wie ich beobachten konnte, sind das immer nur ein paar Worte auf den vielen Blättern, lohnt sich das? Für wen machen Sie das? Wozu? Sie verschwenden Zeit und Material. “ Ich war verletzt und stürzte in zittrige Unsicherheit, als sei ich dabei, wissentlich einen irreparablen Fehler zu begehen. „Für mich.“ sagte ich nicht ohne leise Beschämung, die sich aus der Erkenntnis schälte, dass tatsächlich niemand verstehen könne, was es mit den Textfragmenten auf sich hatte. „Ich erforsche, wie sich Buchstaben, wenige Buchstaben und Buchstabenformationen, auf dem Papier verhalten…sozusagen. Ich füge ihnen später etwas Eigenes hinzu.“ Ließ sich das so erklären? Und nach einer Atempause sagte ich: “Andere Buchstaben. Ich füge neue Buchstaben hinzu. Der Sinn verändert sich dadurch. Der Sinn wird ein völlig anderer dadurch!“ Ich war erleichtert. Ich konnte meine Arbeit Menschen erklären, die nicht einen Schimmer von ihr hatten. „Und außerdem“ setzte ich noch eins drauf, „habe ich einen Kopierschein. Rt ist Teil meiner Förderung. Es geht Sie nichts an, was ich kopiere.“
„Erforschen, hinzufügen, verändern!“ Die Worte kollerten verächtlich aus dem verwischten nassrosa Mund der Frau, wertvolle Worte, die gefangen gehalten wurden in ihrem verstümmelten Lachen, das die Atmosphäre im Raum hässlich färbte.
Ich blieb verletzt. Ich rückte von ihr ab und sah auf den dämmrigen Grenzstreifen an diesem isabellfarbenen Oktobernachmittag hinaus. Was reimte man sich wohl dort hinten zusammen, während man uns beobachtete? Auf einmal fühlte ich mich dorthin mehr zugehörig als hierher.
Ein Wurf Spatzen balgte sich in den exakt gezogenen Furchen der nahezu unkrautfreien Erde des Niemandslandes. Lebendige kleine Schattenvögel auf grauer Erde im gelbgrau gesprenkelten letzten Tageslicht.
Dort müsste einmal Saat aufgehen, dachte ich wehmütig. Ein Beet ausgewachsener Kohlköpfe, violetter, grüner und gelber Kohlköpfe. Dazwischen scheckige Kaninchen. Kleine goldene Hamster und gefleckte Meerschweinchen. Und bunte Futterhäuschen dazwischen.
Im Turm drüben regte sich etwas. Was die beiden Grenzer in Bewegung brachte, gehörte nicht zum üblichen Dienstvollzug dieser Männer, das spürte ich. Einer der beiden hastete in dem kleinen Hochverlies zwischen den 4 Fenstern hin und her. In Richtung der gegenüberliegenden verwaisten Balkone riss er mehrfach sein Glas hoch und ließ es wieder sinken, hastete zwischen den Himmelsrichtungen hin und her. Erwarteten sie etwas? Das schnurgerade auf die Grenze und auf unser Büro zulaufende Grau wurde durch ein zweimenschengroßes, helles Geschoß plötzlich verstört. Verstört und dann aufgerissen. Eine kleine, helle, bewegliche, menschenkompakte Masse. Und schon hielt im herüberkreischenden Bremslärm, umwölkt vom Rauch des Dreitakters ein knallgelber Trabant. Sein Fahrer entwich dem Gefährt wie ein Gas, nicht unähnlich den unter grell eingeschalteten Scheinwerfern dinghaft geballten Auspuffgasen.
Er verschwand im Schatten der Mauer.
Wie gebannt hatten die beiden Uniformierten das undecodierbare Geschehen vom Wachturm verfolgt. Uns verband ein gemeinsames Bildgeschehen, ein Augenblicksfilm. Dann verschwanden sie aus dem Blickfeld des Turmfensters und tauchten auf dem Streifen vor dem Turm wieder auf, anonyme, uniformierte unbewegliche Verwischungen.
Hatte die Bürodame gar nichts bemerkt? „Das ist Blattverschwendung!“ stieß sie in meine Richtung hervor, als habe es die wenige Sekunden zwischen uns andauernde Solidarität in Notwehrstimmung nie gegeben. Ich registrierte diesen Satz und beantwortete ihn sofort mit einem unsanften Puff in ihre gepolsterte Seite. Denn in diesem Moment hechtete ein gedrungener, eher kleiner Herr in dunklem Anzug, mit großen, seiner Körpergröße unangemessenen Sprüngen über den Todesstreifen Richtung Kontrollturm.
„Der darf“, ließ die Schreibkraft anerkennend vernehmen, sie hatte den Grund ihrer Verärgerung vergessen. Aus den verwaisten Abschottungen der Fenster und Balkone auf der anderen Seite konnten plötzlich bewegliche grelle Lichtstreifen nach außen dringen und uns ungebrochen erreichen.
Der fliehende Mann war ein Fremdkörper. Er hielt beim Laufen in seiner rechten Hand etwas Rundes, Kompaktes hoch wie einen Ausweis. Erst war es nur eine Scheibe mit gleichmäßig bemustertem Rand, wurde plastisch im Näherkommen. Es war ein Wecker, ein billiger nostalgischer Wecker, wie man ihn im Kaufhäusern bekommt, ein Wecker für ein grausames, gänzlich untherapeutisches Wecken, der jetzt im Scheinwerferlicht bronzefarben aufblitzte. Einer der Uniformierten verharrte mit dem Rücken zu uns unbeweglich, während sich ihm der Weckermann näherte. Der zweite Grenzposten war nicht mehr zu sehen.
„Ein hohes Tier“, murmelte die Schreibkraft hypnotisiert, „ein sehr hohes Tier. Dabei rollte sie auf russische Weise das r. Und weiter: „Das ist keine Kontrolle und auch keine Ablösung, auch kein Fall von Republikflucht,- oder ist es…die Ablösung?“ Und sie wiederholte: „Die Ablösung?“ Als der Posten beflissen Dienstmütze, Jackett und Koppel richtete, um schließlich mit herab gefallenen Armen mit Blick auf den Weckermann zu erstarren, murmelte sie noch einmal : „Das ist was Höheres.“ Drüben tockerte noch immer der gelbe Trabi, produzierte dicken grauen Nebel.
Die Lichtstreifen hinter den Fenstern und Balkonen schalteten sich alle zugleich ab. Die beiden Menschen im Niemandsland schienen in verwischter Zeitlupe weiterzuexistieren. Die Berliner Dämmerung, die schon Ende Oktober ab mittags fast überall Zimmerbeleuchtung erforderlich macht, verbreitete jetzt eine falsche Traulichkeit, verödete diesen Ort am Ende alles Weltläufigen.
„Es gibt also auch hier Schlupflöcher“, bemerkte ich in Verkennung der Lage, „man müsste sich seine Spuren merken und dann…“
„Das probierʼn Se mal,“ berlinerte die Bürokraft zurück. Sie hatte ihr distinguiertes Angestelltengebaren abgestreift, als sie mich anfuhr : “Sie…Sie falsches Original! Nichts verstehen Sie! Sehen Sie genau hin! Der da, der da jetzt dem Grenzer den Wecker auf seinen ollen Duckschädel haut, der da….“ und tatsächlich sank der Uniformierte unendlich langsam nieder, „…der da weiß es! DER wiederholt sich nie!“
Der gedrungene Zivile mit dem Wecker wirkte unbeholfen. Wer verwendete schon einen Wecker als Waffe? Und das auf einem der gefährlichsten Grundstücke der Welt? Gefahren warten doch nur auf jene, die nicht auf das Leben reagieren. Ein wenig hektisch geworden, als habe er mit der Ohnmacht des Beamten nicht gerechnet, versuchte er ihn Richtung Kontrollturm zu schleifen, ja, er musste ihn die Treppen hoch gezerrt haben, denn nach einer Weile sah man ihn oben angelangt mit dem erschlafften Körper agieren, – einmal sah man einen hochgerissenen Arm, eine flatternde Hand, einen grobbeschuhten Fuß, in der Luft abgeknickt. Endlich schien er zur Ruhe gekommen zu sein und sichtlich erschöpft stützte sich der gedrungene Zivile irgendwo auf. Der zweite Posten blieb verschwunden. Plötzlich sahen wir das Fernglas auf uns gerichtet. Der fremde Zivile – seine etwas unbeholfenen Bewegungen ließen auf einen Mann um die fünfzig schließen – nahm uns ins Visier. „Schluss jetzt!“, schrie die Bürodame,“ ich hab auch was! Ja, da wirʼste staunen, ich kann nämlich auch!“ Sie riss ihre Brille vom Gesicht, das auf einmal ganz flach geworden war und wehrlos wirkte.
Wie der Mann drüben, so hechtete jetzt sie mit Riesenschritten durch den schlauchartigen Büroraum zu ihrem Schreibtisch an der Tür, riss eine Lade auf und beförderte ein elegantes gold-glitzerndes Opernglas zutage. Triumphierend hielt sie es hoch und war schon wieder am Fenster. Was passiert, wenn zwei Augenpaare über eine erhebliche Strecke hinweg durch Ferngläser einander treffen? Verschmelzen sie zu e i n e m Augenblick jenseits beider Blicke?
Dort draußen standen die spätherbstlichen Abendnebel unwirklich und kompakt mit durchsichtigen Zwischenräumen: Gestalten aus noch unentschiedener Materie auf dem Niemandsstreifen. Drüben produzierte noch immer der gelbe Trabi Lärm und dicken grauen Nebel.
Und ich hielt noch immer das umsonst belichtete Blatt Papier mit dem einen Wort in der Hand. Ich sah auf das Blatt und las das Wort Wiederholung: noch einmal.
„Ich wiederhole ihn, ich kopiere ihn!“ rief die Sekretärin unbeherrscht, ließ das Glas sinken und riss mir das Blatt aus der Hand. Sie las das Wort noch einmal still für sich, wobei sie die Lippen lautlos bewegte. „Sie werden sehen, er versteht uns!“ Sie gab mir das Blatt zurück. „Halten Sie es hoch, nein, nicht so Herzchen, so, ja, zu ihm, mit der Schriftseite zu ihm, in seine Richtung! „ Sie kommandierte: „Sie geben das Signal, ich überprüfe die Wirkung!“ Und legte das kleine Glitzerfernglas wieder an. Ich dachte: „Wenn du jetzt nicht einfach gehst, landest du in einem Albtraum. Nicht zu wissen, warum die Dinge geschehen, stürzt dich aus allen Halterungen vertrauter Ichvisionen.“
Ich blieb.
Ich hielt das Blatt hoch. Ich nehme ein Blatt vor den Mund, dachte ich. Der Zivile schien es zu lesen, gelesen zu haben. Es löste eine kleine Freude in mir aus, dass er mich bemerkt hatte, war ich doch Teil eines Ablaufs von vielleicht schon lange geplanten Vereinbarungen, an denen ich keinen Anteil hatte. Dann ließ er sein Fernglas sinken und wandte sich wieder ins Innere des Turmraumes.
Ich legte das Blatt beiseite, nahm der Anderen das Opernglas aus der Hand. Seltsamerweise ließ sie es geschehen. Ich richtete die Schärfe des Glases ein und erschrak vor der Nähe des fernen Ortes. Er wirkte karg und leer geräumt in dem matten Neonlicht. Der vorherrschende Ton tendierte zu einem matten Oliv-schwarz- weiß. Der mutmaßlich von der Weckerwaffe unschädlich gemachte junge Soldat hatte sich aufgerichtet. Wie er so wackelig dort stand, zeigte sein Gesicht Verblüffung und – ich war fassungslos – Respekt. „Er hat ihn nicht niedergeschlagen“, fasste ich meinen Eindruck zusammen „der Mann ist beim Anblick des anderen Mannes ohnmächtig geworden und sein Kamerad hat die Fassung verloren und ist geflohen!“ „Halt den Rand!“ ließ die Bürofrau vernehmen und nahm das Glas wieder an sich, ehe ich noch das Gesicht des Zivilen erforschen konnte, „Ihr Studierten wollt es immer anders gesehen haben, damitʼs hinterher einen Rest Aufklärungsbedarf gibt, so oder so, euch ist das Geheimnisvolle immer passender, statt der nackten Wahrheit ins Auge zu blicken!“ Und nach zwei hektischen Atemzügen: „Er schlug ihn mit dem Wecker nieder, pariert? Er schlug ihn nie-der, zack – und basta! Der Grenzer hat nur seine Pflicht getan!“
„Indem er niedersank“, ergänzte ich. Der gedrungene Zivile bewegte sich langsam, ungeübt, ungelenk. Der Grenzer war nicht mehr zu sehen. Er war – wohin auch immer – gegangen, wohl, um Meldung zu machen. Das Motorengeräusch des gelben Trabis gehörte nun ins Bild – als zweite Sinneswahrnehmung- oder Täuschung. Doch das Fahrzeug war in dem selbst produzierten Nebel nur noch zu ahnen.
Offenbar schaltete der Fremde drüben an Kontrollvorrichtungen herum, die man nicht sehen konnte; der Kopf war halb gesenkt, sein ab und zu aufschauendes Gesicht verriet ratlos konzentrierte Anspannung. Im Turm wurde es um einige Nuancen heller, es reichte aber kaum aus, Vertrauen in einen mutmaßlich alltäglichen Vorgang zu verbreiten. Der zu Kräften gekommene Grenzsoldat bewegte sich nur minimalistisch nah am Körper des Anderen, es wirkte, als versuche er ihm vergeblich Deckung zu geben. Manchmal hielt er sich die Hand vor den Mund, als ob er hustete. Dann umklammerte die Hand des Zivilen etwas Längliches, Dunkles mit einer langen Schnur daran, ein Mikrophon! Er versuchte, dahinein zu sprechen; seine legere Haltung signalisierte, dass er keine Befehle erteilte. In kleinen Schritten durchmaß er das nüchterne Turmzimmer, der Soldat in kleinen Schritten folgend, er schien zu plaudern, gestikulierte sparsam wie ein Moderator, doch mit fahrigen Blicken. Dann legte er das Mikrophon ab, griff in die Innentasche seines Jacketts, um ein weißes, offenbar beschriebenes Papier herauszuziehen.
„Aha?“, ließ die Bürofrau vernehmen, als habe sie genau das erwartet, sei aber nicht völlig sicher. Der Mann auf der anderen Seite faltete das Blatt langsam auseinander. Mit der rechten Hand hielt er das Blatt vor sein Gesicht, genauer gesagt, vor den Mund, denn die Augen blieben sichtbar. Die andere hielt wieder den Wecker in gleicher Höhe hoch. Dabei blickte er eindeutig in unsere Richtung. Die Sekretärin legte ihr Opernglas ab.
„Wiederholung“ stand auf meinem Blatt, das ich noch immer in der Hand hielt. Es war „mein“ Wort, aber ich wusste nicht, woher es gekommen war. „In Herzhöhe Ihr Blatt halten!“, befahl die Sekretärin und: „in seine Richtung – Herz gegen Herz!“ Ich parierte, warum, war mir nicht klar. „Eine Minute lang“, befahl die Frau und zählte leise bis 60. Dabei ließ sie ihren Blick nicht von dem Mann gegenüber, der wie ich nun das Blatt in Herzhöhe hielt. Dort war so etwas wie ein schmales, länglich kompaktes nicht ganz in den Aufgaben gelöstes Rechenkästchen, in der Mitte des Blattes platziert, erkennbar. Als gäbe es zwischen beiden Blättern eine Verbindung, dachte ich und:
Gibt es Fernsympathie? fragte ich mich. Warum mochte ich diesen wildfremden ein wenig dicklichen Menschen an einem so wildfremden Ort, der mir ferner als Australien war in dieser mehr als absurden Situation? Dann lachte die Bürofrau irre auf. Es hörte sich wie ein Schluchzer an. „Jetzt dürfen Sie“, und ich wusste, was gemeint war, ergriff das Opernglas erneut. Meine Augen fanden schnell hinüber, er hatte Blatt und Wecker niedergelegt und schaute mich per Fernglas direkt an. Ein volles, gebräuntes, wirklich nicht unsympathisches Gesicht, der ganze Mann atmete in einer Art energetischer Gefasstheit, ein Mann Mitte fünfzig, die ganze Gestalt durch ein Lächeln geprägt,- aber dieses Lächeln war schmerzlich neutral, unbeteiligt, ein Medienlächeln, ich war enttäuscht – hatte ich diesen Mann schon gesehen?
Auf seinem fast kahlen Kopf war eine dunkle Spur zu sehen, rötlich landkartenartig zur Stirn hin ausuferndes Gerinsel, war er verletzt worden? Da war etwas, das ich sicher kannte, etwas war durch die Medien gegangen, an mir vorbei, eine Stimme, sie sprach nicht meine Sprache, eine Tribüne, eine Delegation, alte Männer, Blitzlichter, Menschenmassen, die an der Tribüne teilnahmslos bunt und kontrolliert lärmend und doch irgendwie teilnahmslos vorbei glitten.
Jetzt hat es mich auch gepackt, dachte ich traurig. Zu Beginn meines Studiums hatte ich Descartes zu denken gelernt und riskiert, ein lebenslanges Getäuschtwerden vorzudenken, undecodierbare Wahrnehmungsprägungen. Ich fand mich damit ab, mich eines Tages in nicht mehr wieder erkennbaren Zusammenhängen vorzufinden, und damit hatte ich eine Tür geöffnet, mit Blick auf neue Namen, Bilder, Denklandschaften, Bücher.
Ich sah seine weinrote Krawatte, seine Hände lagen plan auf einem Tisch oder Schaltpult nahe dem Fenster, neben ihm der Wecker, dessen Zifferblatt in unsere Richtung schaute, hinter ihm der fast reglose Uniformierte, der es aufgegeben hatte sich vor ihm zu platzieren. Statt der Ziffern erkannte ich Buchstaben, 12 Buchstaben, und das Wort mit den 12 Buchstaben war ein deutsches, u n s e r Wort, es hieß Wiederholung, mit dem großen W auf der 12. Der Mann auf der anderen Seite bewegte sich kaum, er schaute mich an, er wusste, dass meine Augen seine Augen suchten. Meine Augen tränten. Dort drüben war es still und auch hier war es still. Ich wollte mir alles genau einprägen. Die Frau neben mir atmete gleichmäßig. Sie litt stumm in starrer Haltung. Das Büro war jetzt ein hermetisch abgeschlossener Behälter, verschworen seine Einrichtung gegen eine erst spät vom Menschen erfundene Zeit, und seine beiden Insassen verloren allmählich an Farbe und Willenskraft. Draußen verwischtem die endgültig eingefallene Düsternis und ein fein einsetzender Schneeregen die Sicht auf Einzelheiten. Der unerwartete Schnee verbindet beide durch den STREIFEN voneinander getrennten Umgebungen, dachte ich. Da gab es den Mann mit der weinroten Krawatte und dem Wecker mit den 12 Buchstaben in der hell erleuchteten Wachturmkabine und hinter ihm jemand, der seinen Posten, vielleicht sein Leben, ab heute verwirkt hatte. Ein scharf entwickeltes, beseeltes Fensterfoto mit wegretuschiertem Umraum. „Man sieht uns genau“, sagte die Sekretärin, ihre Stimme war kraftlos, als habe sie lange genug gegen etwas angeschrien. Dann ging es sehr schnell. Aus dem Nichts hatten sich mit Höchstgeschwindigkeit 4 oder 5 schwach erleuchtete Militärfahrzeuge der Mauereinfriedung von der anderen Seite genähert. „Das sind Kleinkübelwagen“, sagte die Sekretärin tonlos, ich kenne die Motoren von den Kontrollfahrten zwischen den Führungstürmen und sie entriss mir das Glas. Ich sah sie an, – ihr Körper hatte sich gelockert und ihre Bluse raschelte. Die lärmenden Dreitakter zerfetzten die Stille.
Sie eilte zum Lichtschalter und löschte das Licht und wir pressten unsere Gesichter an die Scheibe. Eine fast geräuschlose Aktion, die Uniformierten glitten durch die Nacht. Einmal hörten wir den deutlich gesprochenen Satz „Die Welt ist erkennbar!“. „Das ist die Kennung und normal“, reagierte die Sekretärin mit leiser Stimme darauf. Sie hatte sich wieder im Griff. Unter Führung zweier leitertragenden Uniformierten preschte der Trupp geduckt zur Mauer vor (gab es denn keine Tür, keinen Durchlass, wie war denn der gedrungene Zivile auf den STREIFEN gelangt?) und blitzschnell sah man diese explosive Traube bereits darauf agieren, nachdem man nur eine Sekunde lang unschlüssig auf freier Bahn – ein lebendes Militärdenkmal – gestanden hatte. Dort war die Stelle dunkel, der Schnee war sofort unter ihren erhitzten Stiefeln geschmolzen. Die zehn, fünfzehn Meter bis zum Turm überwanden sie alle ohne Zögern, sie trollten sich voran wie junge Hunde, ausnahmslos junge Grenzer. Warum geht keine Mine hoch, fragte ich mich? Ich entriss ihr das Fernglas wieder, und blickte ins Gesicht des Mannes im Turm am Fenster. Seine neutrales Medienlächeln war eingefroren und einer gespannten Erwartungsmimik gewichen. Er bewegte sich nicht. „Er ist ein Pantomime“, sagte ich. „Eine Attrappe, meine Liebe“, ergänzte sie, als habe sie auf diese Bemerkung gewartet. Die Kopiermaschine setzte sich augenblicklich wieder in Gang und stieß wohl endlich mein kopiertes Fragmentgedicht Blatt aus.
Ein Teil der Soldaten war in den Turm eingedrungen, der Rest nahm kreisförmig Stellung um den Turm herum ein. „Es sind 12 Mann“, sagte die Bürofrau. Sie schien etwas begriffen zu haben, von dem sie nicht wusste, auf welchem Wege es sie erreicht hatte. Ich sah den Mann am Fenster nicht mehr, gegenüber im Turm war das Licht gelöscht worden und der Truppe setzte sich als dicht schließendes Menschenmosaik über den Streifen hinweg in Bewegung. Mich beschlich ein Gefühl, ab jetzt nicht mehr hinschauen zu dürfen. Die Andere schaltete das Licht ein. „Feierabend, Sie Wiederholungszwang“, rief sie. Noch geblendet vom kalten Neonlicht tastete ich mich zum Kopierer und griff nach dem Blatt, das er endlich freigegeben hatte. Es war das Fragment, rechenkästchenartig mit halbgelösten Aufgaben, flatternd an den Rändern. Das Trabimotorengeräusch drüben, es war noch immer zu hören.
Wer liest heute noch Arndt?
Michael Gratz
„Der Gott, der Eisen wachsen ließ, der wollte keine Knechte“ (Wer liest heute noch Arndt?)
Wir Kleingläubigen glauben ja gern, daß Lyrik heute keine Bedeutung hat, außer für den kleinen Kreis der Lyrikleser. Dabei müssen wir nur den Blick kurz aus der Blase ziehen. Aus in Greifswald gegebenem Anlaß beschäftigte ich mich mit Ernst Moritz Arndt. Hier gibt es seit über 550 Jahren eine Universität, etwa 470 davon kam sie ohne Namen aus, aber 1933 erhielt sie auf Antrag eines stramm deutschnationalen Theologieprofessors, Mitglied des Stahlhelm, des Kyffhäuserbunds und der DNVP (Deutschnationalen Volkspartei), aus den Händen Hermann Görings, damals preußischer Ministerpräsident, den Namen Ernst Moritz Arndt. 1945 wurde der Name buchstäblich durchgestrichen auf den Uni-Stempeln, aber 1954, die DDR gründete die „Nationale Volksarmee“ und brauchte „nationale“ Traditionen, wurde der Name wieder eingeführt. (Jener Professor war inzwischen Mitglied der regierenden SED). Seit 1991 wird über den Namen diskutiert, erst Anfang 2017 gab es im Senat eine Zweidrittelmehrheit für die Streichung des Namens. Und dann brach ein wahrer Volkessturm (das Volk steht auf, der Sturm bricht los!) über Greifswald aus, eine veritable Provinzposse mit Menschenkette, Luftballons, Rosen für Arndt, Demonstrationen und Dutzenden Leserbriefen, in denen beklagt wurde, daß Studenten (die ja nicht richtige Greifswalder sind, weil sie wieder weggehn, solln erst mal ordentlich arbeiten lernen!) beziehungsweise Westprofessoren (die auch nicht richtige Greifswalder sind, selbst wenn sie seit 20 Jahren in der Stadt leben) „uns unsere Identität nehmen“ wollen. Sie erzielten einen Teilerfolg, das Ministerium in Schwerin hob die Aufhebung aus formalen Gründen auf. Aber diese finsteren Gesellen wühlen weiter und wollen uns unseren Arndt lesen. Das ist die Volksmeinung bei vielen Greifswaldern, es sind auch einige Politiker fast aller Parteien darunter. Also fragte ich mich: lesen sie eigentlich „ihren“ Dichter? Ich fragte in einer Greifswalder Buchhandlung, sie erinnerten sich an einen (1) Kunden, der in den Monaten seit dem Ausbruch des Arndtfurors nach einem Buch vom Meister gefragt hatte. Ich fragte in einem Greifswalder Forum, jemand sagte, es gäbe ja nichts im Buchhandel und sie benützten natürlich die alten Bücher, ein anderer: es gehe ja gar nicht um Arndt, es gehe um die Identität und wie seit 1990 mit ihr umgegangen werde.

Vor diesem Hintergrund begann ich nach Spuren einer Beschäftigung mit Arndt zu suchen. Ich fand nicht viel. Immerhin auf einer Greifswalder Neonaziseite (inzwischen nicht mehr im Netz) vier Verse von Arndt nebst seinem Bildnis auf der Titelseite:

(Der grammatische Fehler ist nicht original Arndt, sondern authentisch Neo).
Dieses Gedicht (eigentlich die erste Strophe eines Gedichts) ist weit verbreitet von Stickdeckchen bis zu allerlei völkischen und nationalen Devotionalien und Demobedarf. Das Gedicht lebt sozusagen als (völkisches) Gebrauchsgut.

Im folgenden untersuche ich Spuren des Umgangs mit Arndt-Versen in der Populär- und Rechtsfolklore-Kultur am Beispiel seines „Vaterlandslieds“ (Text siehe unten).
Ernst Moritz Arndt schrieb das Vaterlandslied (Der Gott, der Eisen wachsen ließ) im Jahr 1812, während der napoleonischen Besetzung. Es wurde vertont und fand während der Befreiungskriege und danach weite Verbreitung. Eine Google-Anfrage nach der ersten Zeile erbringt in weniger als einer Sekunde über 59.000 Fundstellen und schlägt weitere beliebte Suchanfragen vor. Besonders häufig sind Kombinationen mit dem Sänger Heino und der rechtsradikalen Band „Stahlgewitter“ sowie
- der gott der eisen wachsen ließ der wollte keine knechte t shirt
- der gott der eisen wachsen ließ schuf auch die eisenmänner (Berufslied)
- der gott der eisen wachsen ließ division wiking
Die rechtsradikale Enzyklopädie Metapedia erklärt:
Anfang des 20. Jahrhunderts wurde in manchen Liederbüchern die Strophe „Mit Henkerblut, Franzosenblut“ in „Mit Henker- und mit Knechteblut“ geändert, um den deutschen Freiheitskampf gegen jedweden Feind, nicht nur den französischen Erzfeind zu symbolisieren.
In neuerer Zeit wurde das Lied u. a. von Heino, Leger des Heils, Ultima Thule und dem 2009 verstorbenen Liedermacher Michael Müller neu veröffentlicht. Darüber hinaus diente das Gedicht als Grundlage für das 2011 auf dem Album Sturmzeichen erschienene Lied Der Eisen wachsen ließ von MaKss Damage.
Mit der verharmlosenden Sprache bin ich beim Thema. Sie tun so, als wären sie ein normales Wiki-Lexikon, aber es ist pure völkische Ideologie. Der deutsche Militarismus jener Jahre wird zum „Freiheitskampf gegen jedweden Feind“, der rechtsradikale Sänger Michael Müller, der vom Verfassungsschutz als „rechtsextremistisch“ eingestuft wurde und zusammen mit NPD-Kadern am Aufbau eines „Nationalen Widerstandes Süddeutschland“ mitwirkte und der auf die Melodie von Udo Jürgens, „Mit 66 Jahren“, zur Gaudi seines Publikums sang: „mit sechs Millionen Juden, da fängt der Spaß erst an“, wird in ihrer Darstellung zum fröhlich Erbepflege betreibenden „Liedermacher“. Und der Neonazi-Rapper MaKss Damage alias Julian Fritsch singt außer Arndt auch Sprüche wie „Ich leite Giftgas lyrisch in Siedlungen die jüdisch sind“. Vielleicht haben sie Arndt bei Heino kennengelernt, aber Arndts „Fans“ in der rechten Popkulturszene sind alles andere als harmlose Freunde der klassisch-romantischen deutschen Literatur. Die übergroße Mehrheit der Fundstellen führt direkt ins rechtsradikale, neonazistische Lager.
(Die Zitate im folgenden unverändert aus den Internetquellen)
„This song is a modern cover and reinterpretation of the german folksong Der Gott der Eisen wachsen ließ“, behauptet eine englischsprachige Seite, auf der die Texte von MaKss Damage veröffentlicht werden. Der Nazibarde singt jeweils zwei Originalstrophen von Arndt und dann einen längeren eigenen Text, der offen völkische und neonazistische Haßrede führt. Hier die erste Strophe der „Reinterpretation“ (die Stelle, wo im Text vier Pünktchen stehen, reimt per Assonanz „Führer“ auf „Brüder“). Wo es holprig wird, hört Arndt auf und fängt völkische Hetze an:
Der Gott der Eisen wachsen ließ wollte keine Moscheen.
Der wollte keine Teppiche und auch kein Kopftuch sehen.
Nein! Der Gott der Eisen wachsen ließ
lief schnell in unseren Herzen,
sodass uns unser Hass gestärkt den Gegner auszumerzen.
Der Gott der Eisen wachsen ließ, der sandte uns den ….
Auf das er wieder uns vereine, alle deutschen Brüder.
Und seht nur die Zeckenbrut glaubt, dass siegen könnte.
Darum sammelt all eure Wut und schickt sie in die Hölle!
Heidi Benneckenstein beschreibt in dem Buch „Ein deutsches Mädchen. Mein Leben in einer Neonazi-Familie“ (Stuttgart: Cotta 2017) den Platz von Arndt und Liedern überhaupt im völkischen Lebensstil:
“ Die Lieder hießen »Schwarze Fahne halte stand«, »Gebt Raum, ihr Völker« oder »Deutschland, Deutschland über alles«. Manche Titel klangen eher harmlos, als handle es sich um romantische Heimatlieder aus dem 19. Jahrhundert, zum Beispiel »Der Wind weht über Felder«, aber wenn man in die Strophen hineinlas, wurde schnell klar, welcher Wind hier gemeint war:
»Laßt uns Geist und Hände regen,
stählen unsere junge Kraft,
daß sie einst mit Gottes Segen
uns ein starkes Deutschland schafft!
Laßt nicht Neid die Blicke trüben,
urteilt nicht nach äußrem Schein,
laßt uns Zucht und Ordnung lieben,
pflichtgetreu im kleinsten sein.«
Ich legte es beiseite und wühlte weiter. Als Nächstes kamen jede Menge Briefe, Karten und Einladungen der Jungen Nationaldemokraten und der Heimattreuen Deutschen Jugend zum Vorschein, adressiert an Heidrun Redeker, an mich.
Ich las sie von der ersten bis zur letzten Zeile, Erinnerungen wurden wach, Bilder tauchten auf. Es folgten Flugblätter der NPD und der DVU . »Deutsch soll Deutschland sein!«, stand darauf. (…)
Ich fand zwei T-Shirts. Auf einem stand »Todesstrafe für Kinderschänder«, auf dem anderen »Der Gott, der Eisen wachsen ließ, der wollte keine Knechte« – der Anfang des Vaterlandslieds von Ernst Moritz Arndt aus dem Jahr 1812. Ich fand CD s von Stahlgewitter, Landser und Gigi und die braunen Stadtmusikanten.
Eine Seite „deutschesreichforever“ stellt den Text des Vaterlandslieds und andere Texte von Arndt und Hoffmann von Fallersleben neben krudesten Geschichtsrevisionismus und „modernen“ Israelboykott:

und offene Bekenntnisse zum Führer. Direkt neben Arndts Text stehen Bilder und Links wie diese:
Heino ist natürlich kein Nazi. Er hat nur einen anderen Musikgeschmack und sicher andere Meinungen als z.B. ich. Er singt Arndts Text, wenn auch nicht mit dem Original-„Franzosenblut“, sondern mit „Knechteblut“. Wo sein Lied bei youtube verbreitet wird, sammeln sich die rechten „Fans“ natürlich trotzdem. Anders als die gutwilligen Greifswalder Arndtfreunde wissen sie genau, wofür Arndt steht. Ein paar Zitate:
- Ich wollte, das die deutsche Jugend dieses Lied höret!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Mein Vater ( Korvettenkapitän und vorher Funker im Sperrbrecher 13 ) hat mich dieses Lied gelehrt.– ICH DANKE DIR !!!
- 88! Heil Heino*
- Deutschland ist nicht was sie einmal war ..
- Das Lied sollte man im Bundestag mal 24/7 laufen lassen. (jemand, der oder die sich „ThewhiteRose“ nennt)
- Der Künstler Makss Damage hat davon auch eine neue Version aufgelegt und den Text ein wenig angepasst. Findet ihr hier auf YouTube (jemand, der oder die sich Souveränität für Deutschland nennt)
- nationalistisches Heino + Frei.Wild** = Nationalistisches Traumpaar 2013
- Heute ist der 25567 Tag der Pein. Deutschland wehrt sich.***
* 88 ist der Code für HH = Heil Hitler (H ist der achte Buchstabe im Alphabet)
** Frei.Wild ist eine Deutschrock-Band aus der Gemeinde Brixen in Südtirol (Italien). Der Name lehnt sich an das Wort Freiwild an, sei aber durch die Zusammensetzung der Adjektive frei und wild entstanden. Von diversen Medien wird der Gruppe wiederholt eine Nähe zu politisch rechten Motiven vorgeworfen; die Band selbst distanziert sich von Extremismus jeglicher Art, so auch in der Absage an jede flüchtlingsfeindliche Position und an Fans, die solche Positionen vertreten. (Wikipedia)
*** vom 8. Mai 2015 25567 Tage zurück ist genau der 8. Mai 1945
Na und so weiter. Alle Zitate aus den ersten paar Seiten von tausenden der Googlesuche. Leider ist das meiste von der Art, ein paar Volksliedsammler und Arndtbiografen mal ausgenommen. Eine letzte quasi „literarische“ Fundsache:
Die Rechtsrockband „Stahlgewitter“ läßt es sich nicht nehmen, in ihrem Lied „Ruhm und Ehre der Waffen SS“ Arndt zu zitieren:
Fuer Deutschland und Europa,
fuer ein freies Abendland,
seit dem das letzte in Berlin getreu dem Einlauf noch widerstand,
gegen Bolschewismus,
und seine dunklen Maechte,
der Gott der Eisen machen liess,
der wollte keine Knechte
ich weiss dass ihr sie nie vergesst,
Ruhm und Ehre der Waffen-SS
ich weiss dass ihr sie nie vergesst,
Ruhm und Ehre der Waffen-SS
Wo „Arndt“ draufsteht, ist heute in den allermeisten Fällen schlimmstes neonazistisches „Gedanken“gut drin. Nicht alle, die auf dem Markt in Greifswald für Arndt als vermeintliche Identifikationsfigur demonstrierten, kannten diesen braunen Subtext. Einige aber schon! Den anderen rufe ich zu: Lest meinetwegen Arndt, den originalen. Die Geschmäcker sind verschieden wie die Meinungen. Aber paßt auf, ob wirklich Arndt drin ist, wo Arndt drauf steht.
Hier Strophe 1 und 5 des originalen Arndt:
Der Gott, der Eisen wachsen ließ,
Der wollte keine Knechte,
Drum gab er Säbel, Schwerdt und Spieß
Dem Mann in seine Rechte,
Drum gab er ihm den kühnen Muth,
Den Zorn der freien Rede,
Daß er bestände bis aufs Blut,
Bis in den Tod die Fehde.
(…)
Laßt klingen, was nur klingen kann,
Die Trommeln und die Flöten!
Wir wollen heute Mann für Mann
Mit Blut das Eisen röthen,
Mit Henkerblut, Franzosenblut –
O süßer Tag der Rache!
Das klinget allen Deutschen gut,
Das ist die große Sache.
manuskripte 217
Zeitschriftenschau
Michael Gratz
Die österreichische Literaturzeitschrift manuskripte erscheint im 57. Jahr. Heft 217 eröffnet mit einer seltenen Marginalie. Die Schriftstellerin Aslı Erdoğan, die im August 2016 in Istanbul verhaftet wurde, schrieb der Redaktion, sie sei stolz, daß zwei ihrer Artikel 2013 in manuskripte publiziert wurden; sie habe sie ihrer offiziellen Verteidigung vor Gericht beigefügt. Inzwischen wurde sie bekanntlich freigelassen und konnte nach längerer Ausreisesperre kürzlich ausreisen. Vor Gericht sagte sie: „Man sollte sich schämen, daß eine Schriftstellerin ihre Literatur in einem Gerichtssaal und flankiert von Gendarmen verteidigen muss“.
Das aktuelle Heft der Zeitschrift veröffentlicht u.a. Prosa von Sophie Reyer und Anja Utler sowie unter mehreren Beiträgen zum Literaturfestival im Rahmen des 50. Steirischen Herbstes Texte von Aslı Erdoğan, Jazra Khaleed und Serhij Zhadan. Von Olga Martynova gibt es Auszüge aus einem für 2018 geplanten Essayband mit dem Titel „Über die Dummheit der Stunde“ (Frühjahr 2018 bei S. Fischer). Abgedruckt ist ein Fragment aus „Probleme der Essayistik“. Die Ähnlichkeit des Titels mit einem Vortrag Gottfried Benns ist nicht zufällig. In Anlehnung an Benns „vier diagnostische Symptome“, anhand derer man erkennen könne, ob ein Text von 1950 „identisch mit der Zeit“ sei oder nicht (1. Andichten, 2. Wie-Vergleich, 3. Farbadjektive, 4. seraphischer Ton), lädt sie den Leser zu analogem Spiel mit der Gattung Essay ein. Lyrik und Essay hätten gemeinsam, daß der Leser zu aktivem Mittun eingeladen sei. „Sie belehren nicht, sie fordern auf, allein zu denken.“ Sie untersucht die (wie erst kürzlich wieder festzustellen war, auch bei manchen Lyrikern beliebte) Meinung, daß man ein „Gedicht“ durch einfaches Ausschneiden aus einem nicht lyrischen Text gewinnen könne. In einem spannenden Experiment entnimmt sie drei philosophischen bzw. publizistischen Texten (Wittgenstein, Benjamin, Marx) sowie erzählender Prosa von Goethe und Kafka kurze Auszüge, teilt sie auf „Verse“ auf und versieht sie mit eigener Überschrift. Das Wittgenstein-„Gedicht“ sieht so aus:
IM SELBEN KÄFIG MIT DEN URZEICHEN SITZEND
Die Bedeutungen von Urzeichen
können durch Erläuterungen
erklärt werden. Erläuterungen
sind Sätze,
welche die Urzeichen
enthalten.
Sie können also nur
verstanden werden, wenn
die Bedeutungen dieser Zeichen
bereits bekannt sind.
Im Ergebnis des Experiments stellt sie fest, daß die aus Erzählprosa gezogenen „Gedichte“ mehr Harmonie aufweisen als die aus der ersten Gruppe. Aus den Erzähltext-Gedichten erfahre man, „was uns der Autor sagen wollte“ (nicht zwar im Sinne einer von der Form unabhängigen Botschaft). In den Texten der ersten Gruppe aber, wenn man sie als Gedichte, also mindestens zweimal, lese, gehe es „ums Ganze“. Im Rhythmus wirkten sie unruhiger und eben „dichter“.
Dann wendet sie sich wieder in Analogie zu Benns „diagnostischen Symptomen“ den Wörtern zu. Im Fall des Essays geht es nicht um die Farbadjektive, sondern um Wörter, „die zusätzlich zu ihrer direkten Bedeutung eine emotionale Ladung haben, wie: Rot, braun, Geflüchtete, die Vorsilbe Post-, Europa oder Integration. Am Auftauchen dieser Wörter in Essays kann man bemerken, wie sich „reine Wortklischees“ in den Text einfügen. Es bestehe immer die Gefahr, daß Wörter die Gedanken „parasitisch ersetzen, statt sie zu transportieren“. „Dass bei einem Gedicht diese Gefahr besteht, wissen alle, die Gedichte schreiben, oder zumindest sollten sie es wissen. Aber auch wenn man, sagen wir, über die aktuelle Weltlage spricht, sollte man aufpassen.“ Von hier aus entwickelt Martynova eine spannende Analyse aktueller Kommunikationsschwierigkeiten im politischen Raum u.a. am Beispiel der Wörter postfaktisch, Elite, Volk oder Revolution. Sie zitiert einen Aufsatz von Pankaj Mishra, der einen überraschenden Vergleich zwischen Donald Trump und Jean-Jacques Rousseau aufstellte. Die Vergleichsebene ist hier der Angriff auf „Eliten“. Mishra löse das Problem nicht, daß die Welt so radikal anders geworden sei, daß eine Beschreibung noch fehle, aber seine große Leistung sei, daß er den Widerspruch offenlege und das ungelöste Problem wenigstens von einer überraschenden Seite zeige. Unbedingt lesenswert: der Auszug sofort, das Buch im nächsten Jahr.
Ich gehe noch einen kleinen Schritt zurück und zitiere aus dem Essay:
„Aber irgendwie sind es immer die ‚anderen‘, die die falschen Wörter verwenden. Es ist einfach, über die Wörter zu spotten, über die sich alle jeden Tag aufs Neue lustig machen (mit ‚alle‘ meine ich Menschen mit ähnlicher Gesinnung wie ich). Die ‚anderen‘ beim falschen Wort zu ertappen ist einfacher: ‚Gutmensch‘, ‚Lügenpresse‘, usw. Doch befällt lexikalische Verkalkung alle Lager. Das Wort ‚Lager‘ gefällt mir nicht. Doch leider stimmt das, Menschen verteilen sich gegenwärtig immer überzeugter auf verfeindete Lager. ‚Die Diskussion in Deutschland (…) ist gegenwärtig in einer Weise zwischen Befürwortern und Gegnern der ‚Willkommenskultur‘ festgefahren, die den wirklich anstehenden Entscheidungen nicht besonders gut tut. Unser Diskussionsklima ist vergiftet durch eine Kultur des Rechthabens und der moralischen Verurteilung der Kontrahenten, die tiefe Wurzeln in der deutschen Tradition hat‘, stellt Stephan Wackwitz (…) in einem Essay fest.‘ “ Wem fallen da nicht neben den politischen Schlachten der jüngsten Zeit auch aktuelle Lyrikdebatten ein? (Na, mir jedenfalls. Dazu vielleicht später!)
Ein Essay von Ilma Rakusa beschäftigt sich mit dem Thema „Die Geschwindigkeiten der Literatur“. Ihr Text liefert schöne Momentaufnahmen klassischer Erzähltexte etwa von Musil, Döblin oder Proust. Mit Zwischenstufen wie Yoko Tawada kommt sie dann zur Lyrik. An dieser Stelle verliert ihr Essay die, wie sage ich? Trennschärfe? Schlagkraft? Ich vermute, daß es an der Auswahl der Autoren liegt, die als Beispiele herangezogen werden. Nach den Klassikern und Meistern der Prosa (Beispiele von 12 Autoren werden genannt) kommen zwei europäische Autoren, Inger Christensen und Dane Zajc – hier überzeugt mich die Anknüpfung noch, wie bei dem angefügten Eduard Mörike – und dann drei lebende deutsche Lyriker, es sind (wer kann es erraten):
Durs Grünbein, Nico Bleutge und Jan Wagner – nein, Marion Poschmann hat auch einen kurzen Auftritt. Diese repräsentieren die Lyrik, flankiert von den Meistern der modernen Prosa und, im Schlußteil, Goethes Faust, Dostojewskis Großinquisitor sowie Samjatins und Orwells Dystopien. Die vier Lyriker, die zu den gefeiertsten und preis“gekrönten“ deutschen Lyrikern der Gegenwart zählen, werden durch den Rahmen quasi feierlich in die Weltliteratur aufgenommen. Dagegen ist zunächst nichts einzuwenden, nur so ein Gefühl, daß sie auf den Höhenkämmen der Weltliteratur vielleicht etwas einsam stehen. Weltliteratur und deutsche Gegenwartslyrik sind etwas ungleiche Partner (ob sie den Status von Christensens „Alphabet“ als eins der „großen Weltgedichte der Moderne“ – Detering – erlangen, bleibt abzuwarten).
Vielleicht muß man ja (bestimmt muß man) sich auf wenige repräsentative Beispiele beschränken, wenn man Bestimmtes mitteilen will. Aber was „repräsentieren“ diese drei oder vier Lyriker? Die deutschsprachige Gegenwartslyrik? So gut wie jeder Kenner wird da Bauchschmerzen haben. Vielleicht nicht weil diese dabei sind, sondern weil so viele nicht dabei sind.
Essay als Kanon, Gesetzestafel, Straße der Besten? Wer ist das Publikum solcher Essays? Mit einigem Schrecken stelle ich mir vor, wie Lehrer und Dozenten diesen Aufsatz benutzen könnten, um im Leistungs- oder Grundkurs Erzähltempi bei Musil, Mann und Döblin zu vergleichen. Und was machen sie mit den Lyrikern? Erfahren sie da etwas über die Poetik der deutschen Lyrik der Gegenwart? Ich fürchte, sie lernen einfach Kanon. Die Lyrik ist rasend schwer, ich kann es nicht alles selbst ausforschen, ich merke mir zu den „wichtigsten“ Autoren einen Satz (die Verfasserin sagt tatsächlich „doch im Trend liegt“ das und das, just im Lyrikteil) und kann mitreden. (Wo bleibt da die bei Martynova der Lyrik zugeschriebene Eigenaktivität, Drang zum Mitdichten?)
Dabei gibt es allein in diesem Heft der manuskripte Gedichte von Nancy Hünger, Georg Leß, Maja-Maria Becker, Uta Gosmann und Wolfgang A. Golznig. Muß ich die alle lesen?
Was, wenn die Kanontexte (nenne ich sie mal so) vor allem zum Grundkurs taugen? (Ich meine gar nicht diese vier AutorInnen, sondern die Reduktion auf sie, wie sie der Lyrikbetrieb vorlebt und Rakusas Essay exekutiert.)
Wäre ein „Betrieb“ und wären Vermittler denkbar, der und die nicht Positionen bestätigen und Kanon zementieren, sondern zu Entdeckungen einladen? Vielfalt statt Ein- (nein, nicht was Sie jetzt denken) -dimensionalität? Neugier auf die Vielzahl der Stimmen, aha, das gibt es und das, manches geht an mir vorbei, was mag noch kommen, vielleicht daß was einschlägt und bei mir bleibt?
Je ein Gedicht von Nancy Hünger und Georg Leß mag das Potential der Eigenerkundung andeuten:
Nancy Hünger
KANN MICH BITTE
jemand vernunft sprechen lehren die sprache
des immer so weiter und ist doch die beste aller
was welt ist möglich es geht uns ja gibt uns ja
geht uns ja gut wenn nur der hunger woanders
nicht wär woanders bäckt man kein gutes deutsch
kann einer mir das maul damit stopfen mehl und
mohn und die knochen zerbacken diese vernunft
ist hungrig kann irgendwer teilen dies brot
für die beste oder die mögliche teile mich
den mäulern und zieh mir die grannen hier
aus dem leib damit ich endlich sprechen lerne
fresse ich unser gutes deutsch kann man mich
bitte lehren was möglich was welt ist woanders:
lehren lieber den tod
Georg Leß
GEGEN DIE ÖFFENTLICHKEIT
auf Marktplätzen wurden ihre Gedichte
bearbeitet mit glühenden Gedichten
mit geschmolzenen Gedichten
gehängt in massiven Gedichten
an hoch aufragende Gedichte, schreckte einige von etwas ab
sind echte Gedichte da drin? fragt blinzelnd
ein Kind sich am Markttag
Ein Wort noch zu Wolfgang A. Golznig. Herausgeber Alfred Kolleritsch teilt mit, daß der ihm 1975 als 18jähriger Gymnasiast unaufgefordert eigene Gedichte gezeigt habe und das bis 1978 (im Heft steht fälschlich 1968) beibehalten habe. Dann habe er aufgehört zu schreiben, Kolleritsch habe ihn noch bedrängt, aber er habe nur mit einem Lächeln geantwortet. Im Mai diesen Jahres sei er im 58. Lebensjahr tot aufgefunden worden. Die Zeitschrift druckt Gedichte und einen Prosatext „Aus dem Leben & Tod des Gustav Mahler“. Besonders ein Gedicht aus sieben Strophen, „seven poets crossing the Alps“ fesselte meine Aufmerksamkeit und verlangt fernere Erkundung.













Neueste Kommentare