Lyrikzeitung & Poetry News
Das Archiv der Lyriknachrichten | Seit 2001 | News that stays news
sonntagsgedicht
Gerhard Jaschke
(Geboren 1949 in Wien)
Aus: sonntagsgedichte menschen neigen zum erfolg zeigen zähne klappern mit diesen werden zu riesen und gehen schliesslich kaputt. das ist kein lustiges ende. ich weiss. darum klatscht bitte nicht in die hände! durchbohrt lieber wände mit eurem kopf. das sagt euch euer armer tropf. aus dem gemurmel der welt
Aus: Versnetze_fünf. Deutschsprachige Lyrik der Gegenwart. Hrsg. Axel Kutsch. Weilerswist: Ralf Liebe, 2012, S. 302
Zwei alte Männer
Lorine Niedecker
(12. Mai 1903 Black Hawk Island – 31. Dezember 1970 ebd.)
Two old men —
one proposed they live together
take turns cooking, washing dishes
they were both alone.
His friend: ,,Our way of living
is so different:
you spit
I don’t spit.“
Zwei Alte —
der eine schlug vor, sie sollten zusammenleben,
sich beim Kochen und Spülen abwechseln,
beide waren allein.
Sein Freund: „Wir leben
so ganz andere Leben:
Du spuckst,
ich spucke nicht.“
Aus: Eliot Weinberger: Niedecker/Reznikoff. Deutsch von Beatrice Faßbender. In: Schreibheft 97, August 2021, S. 111
Ein unerhörtes Erlebnis
Christian Morgenstern
(* 6. Mai 1871 in München; † 31. März 1914 in Untermais, Tirol, Österreich-Ungarn)
Der Gaul Es läutet beim Professor Stein. Die Köchin rupft die Hühner. Die Minna geht: Wer kann das sein? – Ein Gaul steht vor der Türe. Die Minna wirft die Türe zu. Die Köchin kommt: Was gibt's denn? Das Fräulein kommt im Morgenschuh. Es kommt die ganze Familie. "Ich bin, verzeihn Sie", spricht der Gaul, "der Gaul vom Tischler Bartels. Ich brachte Ihnen dazumaul die Tür- und Fensterrahmen!" Die vierzehn Leute samt dem Mops, sie stehn, als ob sie träumten. Das kleinste Kind tut einen Hops, die andern stehn wie Bäume. Der Gaul, da keiner ihn versteht, schnalzt bloß mal mit der Zunge, dann kehrt er still sich ab und geht die Treppe wieder hinunter. Die dreizehn schaun auf ihren Herrn, ob er nicht sprechen möchte "Das war", spricht der Professor Stein "ein unerhörtes Erlebnis!... "
Aus: Lustige Lyrik. Fünfzig komische Gedichte. Ausgewählt von Harry Fröhlich. Ditzingen: Reclam, 2021, S. 42f
Form ist Wollust
Ernst Stadler
(* 11. August 1883 in Colmar, Elsass; † 30. Oktober 1914 bei Zandvoorde nahe Ypern in Belgien)
Form ist Wollust Form und Riegel mußten erst zerspringen, Welt durch aufgeschloßne Röhren dringen: Form ist Wollust, Friede, himmlisches Genügen, Doch mich reißt es, Ackerschollen umzupflügen. Form will mich verschnüren und verengen, Doch ich will mein Sein in alle Weiten drängen – Form ist klare Härte ohn Erbarmen, Doch mich treibt es zu den Dumpfen, zu den Armen, Und in grenzenlosem Michverschenken Will mich Leben mit Erfüllung tränken.
Aus: Ernst Stadler: Der Aufbruch und Verstreute Gedichte aus den Jahren 1910-1914. Berlin und Weimar: Aufbau, 1983, S. 25.
Verachtung der Welt
Sibylla Schwarz
(* 24. Februar 1621 Greifswald, † 10. August 1638 ebenda)
Anmerkungen zu diesem Gedicht (das in der Erstausgabe von 1650 durch einen Druckfehler „Betrachtung der Welt“ überschrieben ist) und speziell zu den Versen 5-8 hier unter dem Gedicht. Textfassung und Kommentar nach dem zweiten Band meiner Werkausgabe, der in diesem Herbst im Leipziger Verlag Reinecke & Voß erscheint. M.G.
Verachtung der Welt. Mehrer theils auß dem Niderlen= dischen verteutscht. O Daß Jch steigen möcht auß diesen tieffen Hölen / Bis an des Himmels Dach / zu den verklährten Sehlen / Nur einmahl anzusehn / was oben ist bereit / Was uns erfrewen wirt nach dieser trüeben Zeit ! Jch weiß nicht / wor ich bin / mein Hertz begint zu funcken / Durch ungewohnten Brandt / die Sinnen werden truncken / Der Geist steht auf dem Sprunck / die Sprach ist ungehemt / Die Feder ist vol Safft und gäntzlich ungezähmbt. Jch scheide von dem Fleisch / und leg es gantz beyseiten / Jch klimme nun hinauff ans Hauß der Ewigkeiten / Jch komb schon an das Liecht / und an den hellen Tagk / Dahin der bleiche Todt den Pfeil nicht schießen magk. ¶ Jch flieg itzt ausser mir / ich fliege von der Erden / Jch fliege Himmel an mit ungezähmbten Pferden / Jch seh ein klares Nas und Christallinen Bach / Jch seh den Lebensbaumb / Jch seh der Tage Tag / Jch hör ein großes Volck des Herren Thaten singen / Wohin doch / (O Vernunfft !) wie weit wiltu dich zwingen ? Jch seh das reine Lamb / und die geliebte stehn / O mögt Jch (Lieber Gott : ) O möcht ich weiter gehn ! Wegk / wegk / du schnöde Welt mit deinen argen Rencken / Jch will itzt höher gehn / und dein nicht mehr gedencken. Du bist nur wandelbahr / dich frist die schnelle Zeit / Dein gantzes Thun ist Staub / balt Lust balt wieder Leidt. Was will Jch dir / O Wellt ! für einen Nahmen finden ! Jch zweiffle / was ich thu / undt kan dich nicht entbinden / Du Gordianscher Knopf / du grosser Labyrinth / Du Jrwisch / wer dir folgt / verirt / verwirt / verschwindt. Man hört ja offtermahls die Frewde selber klagen : Wie schnell ist doch die Zeit / die alles kan verjagen ? Es scheint / daß ein Gespänst uns aus der Welt vertreibt / Es ist nur Wasser / Windt / was nicht beständig bleibt. Liebt Jemand einen Freundt in Lieb / in Lust / in Leiden / Es kompt in kurtzer Zeit / es kompt ein bitter scheiden / Wie mehr man dan mit ihm in süßer Lust verirrt / Wie schwerer uns hernach das schwere Scheiden wirt. Asverus grosses Fest / von hundert achtzig Tagen / Hat lengst die schnelle Zeit mit sich hinwegk getragen ; Das Leit hat auch sein Ziel / die Frewd ist leicht gethan / Das / was der Welt beliebt / ist nichts als lauter Wahn. Doch in des HERren Hauß / da so viel tausent Scharen Zusahmen sollen sein / zusahmen sollen fahren / ¶ Da ist das bitter Wort / das Scheiden nicht bekandt / Da ist die Fröligkeit / da bleibt sie mit bestandt. Wen schon die gantze Welt bestünd in Wasserwogen / Und alle tausendt Jahr da kehme zugeflogen Ein leichtes Federthier / und nehm ein Trüpflein Nas Aus dieser großen See / so hett es eine Mas / So würde doch zuletzt nach so viel tausent Jahren / Und tausent noch darzu / die See zu ende fahren / Und entlich nicht mehr sein ; der Brunn der Ewigkeit Wirdt nimmer außgeschöpfft / hat weder Ziel noch Zeit. Jst jemandt auff der Wellt / der allzeit geht in springen / Bei Wein / bei schöner Speiß / bei tausent schönen dingen / Jn dem er unter des sein innigs Hertze fragt / So fint er etwas doch / das seine Sehle nagt. Du siehst hir / was du siehst / kein dingk kan hir bekleiben / Der Häuser Hauß / die Welt / kan selbst nicht ewig bleiben / Und ist bei Gottes Hauß nur als ein Schwalbennest / Das nur / weiß nicht worvon / ist an der Mauwren fest. Wan jemandt sachen sieht / geziert an allen Kandten / Mit weißer Perlein Schar / mit schönen Diamanten / Das (ob das Auge schon es schetzet überfein) Jst doch nur Kinderspiel / ist doch nur lauter schein. Die Lust wirt mannigmahl auch diesen zugelassen / Die Gottes Feinde sindt / und gute Sitten hassen. Jhr / wens euch wiederfehrt / so denckt / so denckt / daran / Was Gott den seinen selbst für Schetze geben kan ? Wann Jemandt Garten sieht mit schönen Blumen prangen So wirdt sein gantzes Hertz mit fröligkeit umbfangen / Er wirdt von schöner Frucht / von Bäumen baldt ergetzt / Jm fall er sich zur Lust ins grüne niedersetzt. ¶ Er hört die Nachtigall so lieblich tirilieren / Und kan mit höchster Lust den Garten durchspatzieren : Dis ist nur kleine Frewd / die / wan man sich betrübt / Uns zur Ergetzligkeit der milde Schöpffer giebt : Was wirdt der guhte Gott den seinen Kindern geben / Die nach der kurtzen Zeit noch ewig mit Jhm leben ? Was wirdt doch seine Gunst ihn’n werffen in den Schooß / Wen Jhr entsehlter Leib ist dieses Leben looß ? Jm fall die güldne Sonn / mit Klarheit gantz ümbfangen / Kömpt als ein Breutigam auß ihrer Kammer gangen / Jm fall der klare Mon / und all das Sterne=Licht Vergünt der gantzen Wellt Jhr angenehm Gesicht / So wirt ja unsre Sehl mit frewden übergoßen ; Denckt / dis ist nur die Thür / darin noch ist beschloßen / Der überschöne Schatz / den eh kein Mensche schawt / Eh Gottes Braut / die Kirch / Jhm Ehlich wirdt vertrawt. Drümb last uns für dem Todt / ihr Christen / nicht verzagen / Eß kompt ein Frewdentagk nach diesen trüben tagen / Was in die Wellt nur kompt / muß alles auch hinnauß / Muß in der Erden Schlundt / und in ein höltzern Hauß. Es geh mir nun hinfort / es geh mir / als es will / Es geh mir böß und guht / es geh mir wüst und stil / Es geh mir / als es pflegt auff dieser Erden gehen / Gott thu mir was er will / Jhm will ich stille stehen / Jn Jhm bin ich allein zu frieden und in Ruh / Jn Jhm drückt man zu letzt mir Hertz und Auge zu. Was dieser Welt beliebt / soll mir nicht mehr belieben / Was diese Welt betrübt / soll mich nicht mehr betrüben / Was nun auff dieser Welt mein wacker Auge sicht / Das treckt hinfort die Sehl / das treckt mein Hertze nicht. ¶ Nun wündsch ich mir zu letzt den besten Wundsch auff Erden : Jn Christi JESV Bluht gereiniget zu werden / Und dann auch sanfft und still auß diesem Jammerthal Zu scheiden / wann Gott wil ! das ist mein Wündschen all.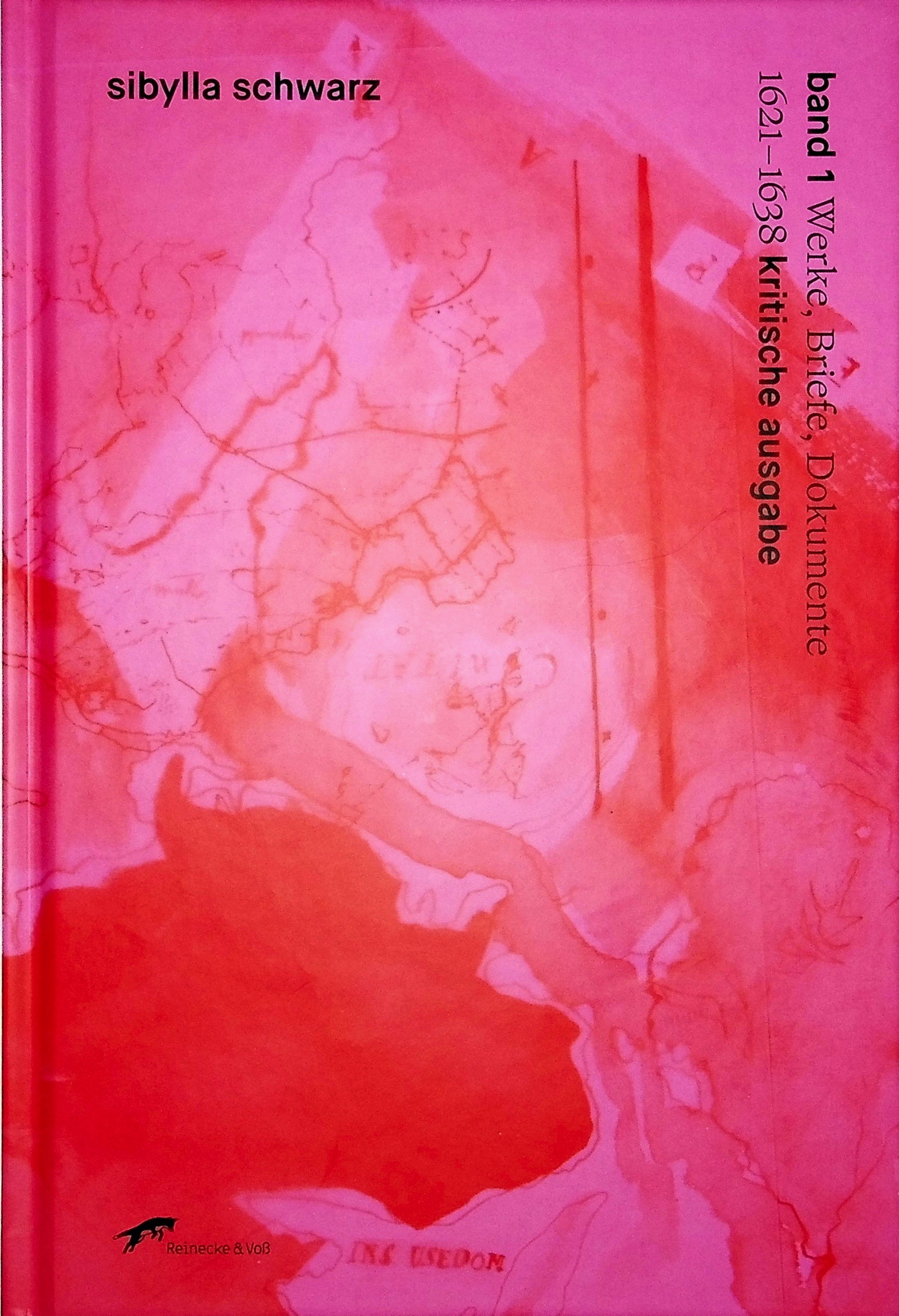

Im Brief an ihren Lehrer und späteren Herausgeber Samuel Gerlach vom 24.7.1637 schreibt Sibylla Schwarz, dass das „ganze opus“ des niederländischen Dichters Jacob Cats ihrem Bruder zugeschickt worden sei. Christian Schmitt hat in einem noch unpublizierten Beitrag nachgewiesen, dass das Gedicht zum größten Teil auf Jacob Cats Houwelyck beruht. Nach ihm handelt es sich um eine sehr freie Übersetzung, die collagenartig „Teile der Vorlage zu einer neuen lyrischen Einheit zusammenfügt“ (Zitat aus seinem Vortragsmanuskript, das er mir dankenswerter Weise zur Verfügung gestellt hat.)
Vorlage für die letzten Zeilen 5-8 ist Cats Houwelyck (Bedaeghde Huis-Moeder):
Waer ben ick mijn gemoet? mijn hert begint te voncken
Door ongewoonen brant, mijn sinnen worden droncken,
Mijn geest is opte loop, mijn losse reden holt,
Mijn breyn dat bortelt uyt, mijn siele suysebolt, (Schmitt 2021).
Wie fast immer ist es eine Kombination von fast wörtlicher und freier Übersetzung mit (schöpferischer) Weiterdichtung. Schmitt weist speziell bei diesem Gedicht nach, wie in den Umdichtungen und Hinzufügungen selbstbewusst die poetologische Position der Autorin entwickelt wird. „Mehrer theils“ in ihrer Überschrift gibt den freien Umgang direkt an.
Philip Larkin 100
Philip Larkin
(* 9. August 1922 in Coventry; † 2. Dezember 1985 in Hull)
Love, we must part now Love, we must part now: do not let it be Calamitous and bitter. In the past There has been too much moonlight and self-pity: Let us have done with it: for now at last Never has sun more boldly paced the sky, Never were hearts more eager to be free, To kick down worlds, lash forests; you and I No longer hold them; we are husks, that see The grain going forward to a different use. There is regret. Always, there is regret. But it is better that our lives unloose, As two tall ships, wind-mastered, wet with light, Break from an estuary with their courses set, And waving part, and waving drop from sight.
Nimms nicht so bitter Nimms nicht so bitter, daß wir scheiden müssen, Mein Lieb. Es gab in der Vergangenheit Zu viel an Selbstmitleid und Mondscheinküssen. Drum Schluß damit gemacht. Gewiß, bis heut Stieg keine Sonne höher am Azur, Begehrte nie ein Paar mehr, frei zu sein Und Welt zu stürzen, Wald zu peitschen. Nur Wir schaffen es nicht mehr. Wir sind wie Spreu, Das Korn geht anderer Verwendung zu. Bedauern, ja. Das wird es immer geben. Doch besser, daß wir scheiden, ich und du, Zwei Seglern gleich, vorm Wind, und feucht vom Licht, Die festen Kurses aus der Mündung streben Und winkend bald geraten außer Sicht.
Deutsch von Helmut Heinrich und Klaus-Dieter Sommer, aus: Horst Meller und Klaus Reichert (Hrsg.): Englische und amerikanische Dichtung 3. Von R. Browning bis Heaney. München: Beck, 2000, S. 342f
Novalis
Karoline von Günderrode
(* 11. Februar 1780 in Karlsruhe; † 26. Juli 1806 in Winkel)
Novalis deinem heilgen Seherblikken Novalis deinem heilgen Seherblikken Sind aufgeschlossen aller Welten Räume Dir offenbahrt sich weihend das Geheime Du schaust es in Prophetischem Entzükken. Du siehst der Dinge Zukunftsvolle Keime Und zu des Weltalls ewigen Geschikken Die gern dem Aug der Menschen sich entrükken Wirst du geführt durch ahndungsvolle Träume Du siehst das Recht, das Wahre, Schöne siegen Die Zeit sich selbst im Ewigen zernichten Und Eros ruhend sich dem Weltall fügen So hat der Weltgeist liebend sich vertrauet Und offenbahret in Novalis Dichten, Und wie Narziß in sich verliebt geschauet.
Abenddämmerung. Crepúsculo
Manuel Altolaguirre
(* 29. Juni 1905 in Málaga; † 26. Juli 1959 in Burgos)
Abenddämmerung Komm, ich will mich ausziehen! Schon ist das Licht weg, und ich habe diese Kleider satt. Nimm mir das Gewand! Damit sie glauben, ich sei gestorben, denn nackt ruhe ich die ganze Nacht, während sie meinen Schlaf bewachen; denn morgen früh, meiner Nacktheit entkleidet, gehe ich baden in einen Fluß, während sie mein Gewand mit anderm Gewand für immer verwahren. Komm, Tod, ich bin ein Kind und will, daß sie mich ausziehen, das Licht ist weg, und ich habe diese Kleider satt.
Aus: Poetas españoles. La generación del 27. Spanische Dichter. Die Generation von 1927. Hrsg. u. übersetzt von Erna Brandenberger. München: dtv, 1980 (dtv zweisprachig), S. 119ff
Crepúsculo ¡Ven, que quiero desnudarme! Ya se fue la luz, y tengo cansancio de estos vestidos. ¡Quítame el traje! Que crean que he muerto, porque, desnuda, mientras me velan el sueño, descanso toda la noche; porque mañana temprano, desnuda de mi desnudo, iré a bañarme en un río, mientras mi traje con traje lo guardarán para siempre. Ven, muerte, que soy un niño, y quiero que me desnuden, que se fue la luz y tengo cansancio de estos vestidos.
Auch ich war in Endivien
Àxel Sanjosé
Endivien Wenn all die schönen Frauen in Straßencafés sitzen und mit den Augen schauen, als würfen sie mit Blitzen, wenn sie Salat bestellen, ein Glas Prosecco trinken, derweil die Hündlein bellen und Freunde herzlich winken (und Rom nur mäßig finden und schwärmen von Bolivien), dann denk ich beim Verschwinden: Auch ich war in Endivien.
Aus: Àxel Sanjosé, Lebensmittellyrik. Nebst einem Anhang mit Büroartikellyrik. Illustriert von Gisela Messing. Wien: Edition Melos, 2022, S. 72
Meine eigne Klag
Christian Wagner
(* 5. August 1835 in Warmbronn; † 15. Februar 1918 ebenda)
AM ABEND DES LEBENS Ja, laßt mich klagen meine eigne Klag Die eigne Klag des ausgebrannten Lichts, Die eigne Klag, daß ich nicht mehr vermag Lichtwellen neu zu werfen in den Tag, Lichtsonnen neu zu streuen in das Nichts.
Aus: Christian Wagner, Eine Welt von einem Namenlosen. Das dichterische Werk. Hrsg. Ulrich Keicher. Göttingen: Wallstein, 2003, S. 193
Liebe Frau im Stein
Jesse Thoor
(* 23. Januar 1905 in Berlin; † 15. August 1952 in Lienz/Osttirol)
Rufe am Nachmittag Liebe Frau im Stein. Liebe Frau im Sonnenschein. Liebe Jungfrau mein — ich schmücke dein Kleid. Ich schmücke den Mantel dir, wenn ich übergossen bin von Reif und Tau — wenn ich ganz in mir den ewigen Leib anschau.
Aus: Jesse Thoor, Gedichte. Hrsg. / Nachwort Peter Hamm. Frankfurt/Main: Suhrkamp, 2004 (2. Aufl.) (Bibliothek Suhrkamp), S. 62
Wo sind sie jetzt
Hugo Ball
(* 22. Februar 1886 in Pirmasens; † 14. September 1927 in Sant’Abbondio-Gentilino, Schweiz)
Memento [Pfingsten 1924] Wo sind sie jetzt mit ihren Epauletten Die Feldmarschälle und von den Korvetten Die Kapitäne mit den goldenen Tressen? Wo sind sie jetzt, die prunkenden Maitressen? Wo blieben sie, die wogenden Musiken? Doktores und Gazetten und Fabriken? Wo sind sie nun, die grimmen Rezensenten? Die zarten Dandys mit den Priesterhänden? Wer liest noch in den köstlichen Brevieren Von dieser Zeit und ihren Aventüren? Wer weiß noch von den magischen Phiolen, Drin unser Herzblut glühte über Kohlen? Wie heißen sie, die sich die Zeit verkürzten, indem sie unsere Aschenurnen stürzten? Verschollen und vergessen sind die Namen Der hohen Herren und der edlen Damen. Ein dünner Flugsand decket ihr Gebein. Mit Wanderhügeln treibt ihr Leichenstein. In blaue Meere rollten von den Dünen Die Häupter der Zäsaren und Braminen.
Aus: Hugo Ball, Gesammelte Gedichte. Mit Photos und Faksimiles. Hrsg. Annemarie Schütt-Hennings. Zürich: Arche, 1963, S. 56
Beim Mondbetrachten
Saigyô
(1118-1190)
Ja, gerade weil die Wolken von Zeit zu Zeit darüber ziehen, tun sie etwas für den Mond: Sie sind ein Schmuck für ihn
Aus: Saigyô: Gedichte aus der Bergklause Sankashû. Ausgewählt und übersetzt mit Kommentar und Annotationen von Ekkehard May. Mainz: Dieterich’sche Verlagsbuchhandlung, 2021, S. 107
Und natürlich gilt Klopstocks Diktum, dass auch das Silbenmaß hin und wieder etwas mit ausdrücken müsse. Man beachte die doppelten Reduplikationen am Anfang des japanischen Texts:
naka-naka ni toki-doki kumo no kakaru koso tsuki wo motenasu kazari narikeri
Bashô (1644-1694), der Saigyô verehrte und häufig zitierte, machte ein Haiku zum Thema:
Wolken von Zeit zu Zeit gönnen den Menschen Rast beim Mondbetrachten
Aus: Ebd. S. 106








Fotos © Gratz
Hinter mir
Abi Anwari
HINTER MIR Ich bin hinter mir gelaufen. Hörte nicht schaute nicht. Ich bin hinter mir gelaufen.
Aus: Abi Anwari: Sonnenvogel. Gedichte. Edition fundamental, 2008, S. 10.
Abi Anwari, geboren 1946 in Teheran, lebt seit 1972 in Köln.
Alkohol
Ágnes Nemes Nagy
(* 3. Januar 1922 in Budapest; † 23. August 1991 ebenda)
Alkohol In klirrend sich häufenden Knoten stirbt der Wald, sagt Lebewohl. Die Grünsommerflamme verflogen. Was bleibt, ist der Rest-Alkohol. Trink, trink. Was Trester geblieben, press aus und schluck ihn runter. Schnaps-Seele, dunkel, durchtrieben, mach uns die Kehlen munter.
Deutsch von Christian Filips und Orsolya Kalász, aus: Ágnes Nemes Nagy, Mein Hirn: ein See. Berlin, Budapest und Schupfart, 2022, S. 106f
Alkohol Zörgő csomókban haldokol, kupac az erdő. A nyár zöld lángja, mint az alkohol elszállt. Maradt a seprő. Igyál, igyál. Ami maradt, sajtold ki, nyeld le. Hadd melegítse torkodat sötét, komisz pálinka-lelke.

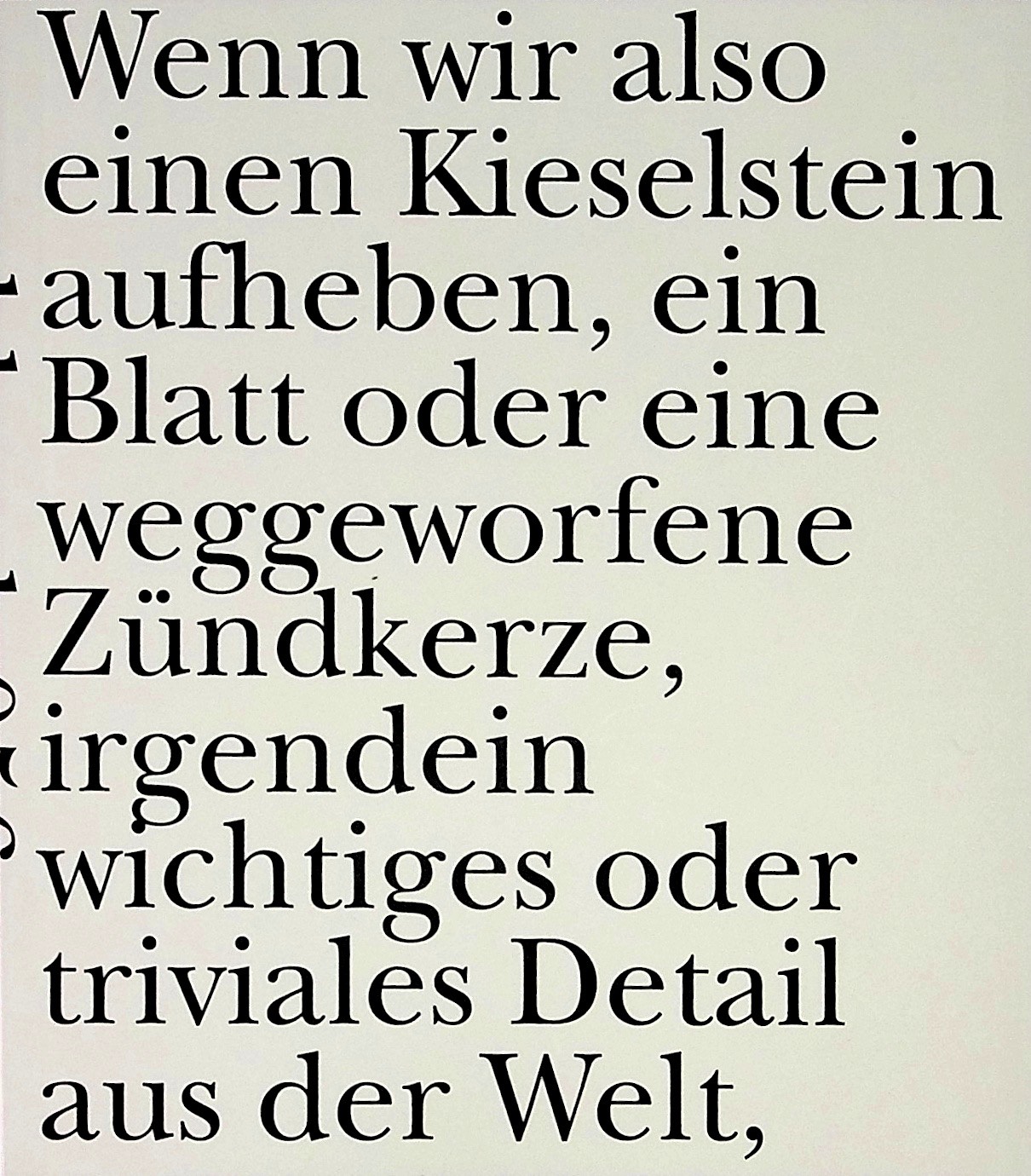


Neueste Kommentare