Lyrikzeitung & Poetry News
Das Archiv der Lyriknachrichten | Seit 2001 | News that stays news
Land der Schwätzer
Wann hat er das letzte Mal ein Gedicht gelesen? Dem Buchmesse-Besucher Uwe Thielemann entfährt ein „Oh Gott!“. „Das ist schon sehr lange her. Ich bin mehr so der Sachbuch-Fan“, schiebt er hinterher.
So wie Thielemann antworten am Freitag viele Besucher der Leipziger Buchmesse. Sie halten sich für literarisch interessiert – aber Gedichte? Lyrik, so sieht es aus, ist im Land der Dichter und Denker eine vergessene Gattung. / Focus („Für die Informationselite“)
Das stimmt schon. Aber, so sieht es aus, Hauptsache ist doch, den Schwätzern und Richtern fallen noch die richtigen Floskeln ein.
Ende der Skepsis
Hier spricht einer, der 1945 die vollständige ideelle und materielle Zerstörung Deutschlands am eigenen Leib er- und überlebt hat. Danach war er wie viele seiner Altersgenossen ausgenüchtert, für immer immun gegen Heilsversprechungen. Wellershoff ist einer der letzten dieser „skeptischen Generation“, die sich von nichts mehr überwältigen lassen will, auch nicht vom Tod. In diesem Sinne sind seine Reflexionen übers Altern und Sterben auch ein großes Generationenporträt. / Claus-Ulrich Bielefeld, Die Welt
Ans Ende kommen. Dieter Wellershoff erzählt übers Altern und Sterben. supposé, Berlin. 1 CD, ca. 18 €.
Kann man
… heute noch christliche Lyrik schreiben? Christian Lehnert feiert die Schöpfung und begegnet Engeln auf der Autobahn, schreibt Dorothea von Törne in der Welt – sie wird dabei richtig feierlich:
Lehnerts Verse sind dem Dunklen und Rätselhaften gewidmet, das sich rationaler Deutung entzieht. Damit ist er nicht allein. Die lyrische Pilgerschar auf dem Weg zum Geheimnis wird angeführt von Les Murray, einem Kandidaten für den Literaturnobelpreis. Der Australier hisst die poetologische Flagge mit seiner Behauptung: „Religionen sind Gedichte. Sie bringen/ unseren Tages- und Traumgeist in Einklang,/ unsere Gefühle, Instinkte,/ den Atem …“
Poetopie
eine die schreibt, autorisiert von einem der liest – beide allein in Einsamkeit mit allem verbunden
Hansjürgen Bulkowski
Lesen und Schreiben
Angelika Janz schreibt bei KuNo über Lesungen und andere Aktionsformen, Zitat:
Im kalten Februar 1979 begab ich mich frühmorgens, ausgerüstet mit einer Tüte Kreide, in die Essener Innenstadt und beschrieb auf Knien– die Texte langsam mitsprechend- die Fußgängerzone ab der Bahnhofsrolltreppe bis weit hinter die Kaufhauszone mit z. T. auswendigen eigenen wie auch augenblickshaft entwickelten Texten. An diesem Samstagmorgen sollten die Menschen die Texte mit ihren Schritten davontragen. Trotz von einigen Ladenbesitzern herbeigerufener Polizei, hingeworfenen Bettelgroschen und bald sich einstellender Presse (ein winziges Artikelchen „Schriftstellerin geht auf die Straße“, die – so erklärte es sich der Schreiber, aus Publikationsnot das Pflaster zu beschreiben gezwungen sei) und einer Menge Mitleser, Zuhörer und ideologischer Begleiter hielt ich – mit einigen Diskussionspausen – bis in den Abend durch und genoss in der Dämmerung in klirrender Luft und mit steif gefrorenen Gliedern (und geschwollenen Knien) das wunderbare Bild einer mit Literatur in der ganzen Breite vollgeschriebenen Fußgängerzone, über das die Menschen eilig liefen und so an seinem Verschwinden arbeiteten. Ich hatte diese Aktion am selben Morgen erst entschieden und hatte sie sie in der UBahn auf dem Weg dorthin „Schreiben wie gehen“ genannt.
Eine weitere Aktion zu Beginn der 80er Jahre kehrte den Prozess der Literaturproduktion um: Ich stand im Dunkeln auf einer zu einem Boot geformten Folie gefüllt mit blutroter Farbe. Im Hintergrund wechselten in loser Folge große Diaprojektionen von beliebigen Szenen aus Ländern aller Kontinente. „Böse Bilder rächen sich auch später nicht aber spätestens“. Das Gedichtfragment, das auf einer weißen Wand mit schwarzen Anstreicher- Schablonenbuchstaben aufgebracht war, sprang ich mit in der Farbe getauchten Füßen vor den wechselnden Projektionen so lange an, bis es unkenntlich war und an der Wand nur noch ein zerfranster roter Flecken – einer imaginären Landkarte gleich – zu sehen war.
Leerer Koffer
Eine Freundin von mir, eine russische Dichterin, später ermordet von unreinen Mächten (die es in Russland immer gibt), traf einmal in Bayern ein, und als sie vor mir ihren Koffer öffnete, waren, trostlos hin und her schlackernd, zwei, drei Bücher und ein paar Schuhe darin, weil sich in diesem Gepäck eigentlich die Leere des damaligen Lebens in Russland befand. / Bora Ćosić, NZZ
Herr J. kommentiert
die Verleihung des Buchmessepreises an einen Lyriker:
HerrJ…
gestern 12:48 Uhr
Christoph Meckels „Ausgabe letzter Hand“
(…) Er war und ist einer der großen Dichter der deutschen Nachkriegsliteratur.
So jedenfalls nennt ihn, den Berliner, der sich immer wieder in sein Dorf Rémuzat im Département Drôme im Südosten Frankreichs zurückgezogen hat, der Herausgeber einer jetzt erschienenen opulenten Gesamtausgabe der Meckelschen Gedichte. Gut 950 Seiten auf feinem Chamois-Dünndruckpapier umfasst die Ausgabe, zu der Wolfgang Matz ein ausführliches Nachwort geschrieben hat. Der Schutzumschlag zeigt ganz unverkennbar eine Grafik von Christoph Meckel, der auch an der Edition dieses gewichtigen Buches beteiligt war: Hier und da hat der Autor ein Gedicht noch einmal überarbeitet, grundsätzlich hat er sich im Zweifel für die jeweils späteste Fassung entschieden und damit den Fortgang des Lebens und der Erfahrungen mit der Entwicklung seines lyrischen Werks koordiniert. Ein solches Verfahren ruft nicht nur Gleichklang zwischen Leben und Werk hervor, sondern auch existenzielle Widersprüche und Dissonanzen. Christoph Meckel hat kurz vor seinem 80. Geburtstag im Juni dieses Jahres die große Chance zu einer „Ausgabe letzter Hand“ genutzt. / Herbert Wiesner, Die Welt
Christoph Meckel: Tarnkappe. Gesammelte Gedichte. Hanser, München. 960 S., 34,90 €.
Messestatistik
- 3000 Mitwirkende bei „Leipzig liest“ in 3200 Veranstaltungen an 410 Orten
- 2.263 Aussteller
- 2014 waren 237.000 Besucher da, davon 175.000 auf dem Messegelände
- Gastland Israel hat 8 Millionen Einwohner, Deutschland über 80 Millionen. In Israel gab es 2013 7863 Erstauflagen, in Deutschland mehr als zehnmal soviel: 81919.
- Bei gegenseitigen Übersetzungen ist Verhältnis umgekehrt: 63 Titel wurden aus dem Deutschen ins Hebräische übersetzt, das sind 8 Promille. Umgekehrt aus dem Hebräischen ins Deutsche waren es nur 40, das sind nicht einmal ein halbes Promille der deutschsprachigen Erstausgaben.
- In Israel gab es 2012 1664 Verlage, in Deutschland nur unwesentlich mehr: 2209.
- Bei der Lyrik aber scheinen die Israelis ähnlich zurückhaltend wie die Deutschen. 40 Autoren aus Israel und Deutschlandlesen und sprechen auf über 70 Veranstaltungen – Gedichte: keine. Auch in der kostenlos erhältlichen Pdf mit Angaben und Leseproben aus den in Leipzig vorgestellten Büchern gibt es auf 125 Seiten kein einziges Gedicht. (Also 1, in Worten eins, doch: bei der Vorstellungs des Romans „Reise nach Jerusalem“ des in Israel lebenden Palästinensers Ayman Sikseck wird ein Gedicht zitiert:
Ich schreibe in der hebräischen Sprache,
die nicht meine Muttersprache ist,
um auf der Welt verloren zu gehen.
Wer nicht verloren geht,
wird das Ganze nicht finden.
Denn jeder hat die gleichen Zehen an den Füßen,
die er behutsam einen vor den anderen setzt.
Aus „Ich schreibe Hebräisch“ von Salman Masalha
Sikseck, Ayman: Reise nach Jerusalem | Arche | 2012 ISBN: 978-3716026878 | Gebunden | 92 Seiten | 18,00 €
Das Programm Leipzig liest 2015 unter www.leipziger-buchmesse.de/leipzigliest
„Ausgeufertes Rezensionstagebuch“
Ann Cotten rezensiert bei lyrikkritik.de die Bände der Poeticon-Reihe von J.Frank. L&Poe präsentiert weitgehend dekontextualisierte süße und bittere Mandeln aus dem langen, funkelnden und üblich-scharfen Text.
GROSZBUCHSTABEN
Ein ausgeufertes Rezensionstagebuch über die Reihe „Poeticon“ im J. Frank Verlag.
Wie arrogante Sprüche auf Jutesäckchen: Großes Maul, schlechtes Material. Das könnte eine Formel für Frechheit und Jugend sein. In diese Mode fügt sich die Reihe wohl ein. Freilich messen sich diese kleinen Fibeln dadurch mit anderen Miniaturausgaben: Kapital, Koran, Bibel. Es gibt Ähnlichkeiten – auch in letzteren beiden steht viel Blödsinn drin.
Jetzt quäle ich mich wie ein Moralist durch die Heftchen und beschwere mich über die Ödnis, während ich doch eigentlich eine hitzköpfige, intolerante Leserin bin und lieber die Lektüre abbreche und spazierengehe, als zu leiden und nachher dem Autor Vorwürfe zu machen.
Aber es geht um die Poesie! Und um die Theorie! Ich lese weiter.
Wieder eineinhalb Seiten. Es ist wie ein Spaziergang am Meeresstrand. Schon irgendwie entspannend, wenn ich mal mein Erkenntnisinteresse vergessen könnte.
In einigen Endnoten steht a.a.O., obwohl die Referenz zum ersten Mal vorkommt. Am Oarsch, Oida! Das schreibe ich nur hin, um zu dokumentieren, dass das sehr wohl jemand bemerkt.
Ich kenne das und misstraue dem bei mir selber auch: das irre, das durch literarische Reproduktion meines Privaten so angeschwollene Selbstbewusstsein, mit dem ich imstande wäre, ein Pferd zu satteln und Richtung Nordpol loszureiten, ohne Jacke und ohne Pferd. So froh, den Zweifeln entkommen zu sein!
Es plätschert „ich finde“, „meine liebsten“, „wie ich immer so“ dahin, als schlenderte Ötzi mit seiner Kollektion von Bookmarks durch die Eiszeit.
Martina Hefter bringt auf S. 13 auf den Punkt, was ich über sie auch manchmal empfinde: „fröhlich (…) darüber, was sich da einer getraut hat“. Wenn bloß alle, wie sie, das Wagnis als Beginn einer tollen Arbeit begriffen, und nicht bloß als Ende des Nicht-Wagens!
Dass das stimmt und ich nicht bloß schlechte Laune habe, beweist mir später B. Reineckes Essay. Er erfüllt, bis auf die allerletzten paar Seiten, ganz und gar das von einem Essay erwartbare Niveau: nämlich, nicht sichtlich für Idioten geschrieben zu sein. Ernsthaft das Kriterium der Nützlichkeit zu verwenden, um die Pointen zu schärfen und mit intelligentem Urteil zu gewichten. Sich beim Schreiben nicht blöd zu stellen.
O ich auch, ich auch, ich hasse auch diese deutsch-wichtigtuerische „Bedeutung“, dieses ehrgeizige Flammenzünglein, das immer so viel Unrat hausieren trägt.
Bei der sich dem Publikum übergebenden Kunst (Es klingt wie Kotzen – und in der Tat ist eine Entsprechung aufzufinden, dieses Übergeben seiner Selbstquälereien an die Außenwelt erlöst das Subjekt; jemand anderer muss das Gift und die Materie der Transaktion aufputzen.) ist das Ausmaß des Auf-sich-selbst-geworfen-Seins nicht begrenzt.
Das ist es gerade. Ich ja auch nicht. Es ist vielleicht nicht die Zeit, es gibt auch nicht das rechtschaffene Publikum, das einen motivieren könnte, sich zu ordnen. Was kann man voraussetzen, was muss man erwähnen, was muss man dreimal in unterschiedlichen Kontexten erwähnen, damit es klar wird? Das Gegenüber ist das Interface vom Internet, ein unendliches Palaver. Wir treffen uns informell und üben schlecht strukturierte Gespräche. Und dann soll plötzlich eine poetologische Essayreihe die Welt retten?
Ich glaube, ich habe ein idealisiertes Englandbild und bevölkere die Insel mit lauter Sternes und Byrons, ach.
… Schopenhauers, des heldenhaftesten aller Grottenolme …
Das hätte auch fast ein deutscher Witz werden können.
… eine mit herbeibemühten Zitaten gewappnete Tirade gegen Reime und gegen schlechte Dichter. Sie werden vage in Zusammenhang gestellt, unklar bleibt, ob das Benutzen von Reimen dazu führt, dass man ein schlechter Dichter wird (Vorwurf: schlechte Gewohnheit, schlechte Gesellschaft), oder man Reime verwendet, weil man ein schlechter Dichter ist (Vorwurf: schlechter Geschmack).
… ob Grünbein wohl durch Elektrotherapie in größere Erregung versetzt, vermayröckerisiert werden könnte?
Grünbein behauptet natürlich auch Freiheit der Kunst, aber er empfindet und genießt und nutzt sie nicht, nicht einmal die des Künstlers. Er unterwirft sich den verschiedenen Disziplinen, dem Denken etwa, der Gefälligkeit und dem kreativen Ehrgeiz. Das ist nicht etwas, was man sich aussucht. Bestimmt würde er gerne innerlich so frei sein wie die Mayröcker. Deswegen ist seine Kunst viel verseuchter von den Irrtümern, Dummheiten, Eitelkeiten und vor allem falschen Befriedigungen, falschen Zielen seiner selbst, seiner Umgebung und seines Publikums, dem er als Mensch und als Dichter auf eine ja irgendwie natürliche Weise gefallen will – unfrei eben. Das macht ihn mir interessanter. Wegen dieser Schwäche oder aber auch dieser größeren Sich-selbst-Ausgesetztheit als Bürger und neureichen Schwärmer ist mir Grünbein irgendwie – verständlicher. Vielleicht aber liegt die Sympathie nur daran, dass ihm alle seine Verbrechen gegen den Geschmack und gegen die Hochherzigkeit, die er doch in den Gedichten mit großen Worten herbeischreiben will, gnadenlos vorgeworfen werden (auch wenn er nichtsdestotrotz eine große Fangemeinde hat – in meinem Bekanntenkreis ist niemand, der ihn schätzt). Mayröcker hingegen darf scheinbar alles. Was natürlich auch eine Frage des Alters ist, was den Zweiervergleich an sich ja schon bei Crauss ein wenig hinken machte.
Pathos? Ja, aber nur durchgestrichen bei Ron Winkler!
Und irgendwas in mir schreit immer, es ist wohl schon wieder der innere Psychoanalytiker: hört doch endlich auf, diese warmen Herzen von ostdeutschen Männern und Frauen zu dieser zwanghaften Sicherheitsironie zu zwingen, Diskurse!
Ein Prachtsatz, überladen mit abgenudelten, einander widersprechenden Metaphern und Floskeln, unentschieden zwischen zwei uralten und auf mehrfache Weisen kaputten Bildern.
(wer, übrigens, die Grazien „Damen“ nennt, sollte eigentlich als aus dem jungen Teil der Literatur ausgeschlossen gelten und eine Schweigepension Eierlikör bekommen)
Poetisiert euch = Nett sein, Leute! Aber auch wahr sein, und nicht schummeln!
… das Rohöl der Kulturwirtschaft
ND ist aber auch ein moralisierendes Ödpack.
… angesichts der vielen nach ihrem eigenen Verständnis urteilenden Vollkoffer …
Fußnoten sind dem Menschen zumutbar!
Es ist jetzt angemessen, den Griff zu entkrampfen, Ann.
Das kann man sagen. Da stimmen auch die Eltern zu.
Man merkt, das Kuhlbrodt ein paar Jahrzehnte liest, und zwar ernsthaft auch seit langem, vielleicht aufgrund der im Essay erwähnten Ermahnung eines Philosophieprofessors, sich der Werke, die man liest, nicht als Trümmerhalden zu bedienen, sondern ihre inneren und metatextuellen Zusammenhänge nachzuvollziehen. Ernsthaft meint vor allem, dass auch denkbar ist, aufgrund von Lektüre seine eigene Überzeugungen zu ändern. Was ich bei anderen dieser Reihe nicht vermuten würde, die das Zitatesamplen scheinbar bloß als Deko für ihre bevorzugten Ansichten betreiben.
Kuhlbrodt ist kein Denker-Grübler in dem Sinn, dass er Sachen bis in alle Winkel zu verfolgen wichtiger fände als deren Bezug zum Leben. Das ist sehr angenehm und angemessen. Er ist eher ein Naturgrübler, also ein nachdenklicher Mensch, der im Leben steht (auch als Position für einen Lyriker eigentlich nicht schlecht) – und nicht einer von diesen Gespenstern (wie ich tendentiell), die sich in die Theorie flüchten, um der Wirklichkeit zu entgehen. Wobei das natürlich auch ein Bezug zur Wirklichkeit ist.
Und wie er „ich“ schreibt, der Kuhlbrodt, so schlicht und normal!
„Wer sich seiner Sache nicht sicher ist, wie wir wohl alle uns nicht sicher sein können, sollte sich mit eigenen Weissagungen zurückhalten und Weisgesagtem gründlich misstrauen.“ Alle, also, seien immer unsicher, mundtot und misstrauisch. Das ist natürlich auf Anhieb ein erfrischendes Antidot zur Ode an die Freude, aber möge bloß Kassandra das nie hören! Das Problem ist, dass so nur diejenigen Idioten als Propheten überbleiben, denen nicht der leiseste Selbstzweifel einfällt. Ja, im Grunde ist es eh so. Und doch ist auch diese Forderung nicht so unsympathisch in ihrer Bevorzugung des Fressehaltens.
… Mangel an prinzipiellem Zweifel an seiner Methode. Für die gibt es halt ein Publikum, das sich gegenseitig darin bestärkt, das Verlogene, was ich an dieser Art von raunenden „Aufarbeitung“ oder bloß ergebnislosem Rumthematisieren so stark spüre, zu verleugnen.
… und ich bin hochzufrieden mit der Aussage „Geschichte ploppt herum wie in einer Betonmischmaschine.“
… soll die Motivation, die das Gedächtnis hat, zu schummeln und sein Material zu schlüssigen oder von der Gegenwart nachgefragten Eindrücken zu verarbeiten, ausgetrickst werden. Wenn das aber in kollektiven Ästhetiken und Moden, oder gar in Hinblick auf Lob geschieht, schlägt der Trick fehl. Deswegen ist wohl nicht prinzipiell und allgemein zu empfehlen, mehr Geschichte in die wohl buhlerischste aller Literaturformen, die Lyrik, einzuspeisen. Durch die bekannte Dunkelheit da drin, auch Mehrdeutigkeit und Idiosynkratik, die dominant geworden sind als radikal persönliche Ausdrucksweisen, ist viel Unfug, auch sehr blöder und brutaler, möglich.
Und obwohl das nicht sonderlich visionär klingt, geht es in Politik und Geschichtsschreibung in Wirklichkeit meistens um Schadensbegrenzung, also genau um dieses von Kuhlbrodt skeptisch beäugte Gatter der Freiheitsermöglichung innerhalb definierter Grenzen (bis zur Gewalt gegen andere, u.s.w.). Die euphorisierende Theorie ist von Schiller und Hölderlin schon in ausreichender Menge formuliert worden, in und aus unserer Zeit, wo wir uns zu recht viel weniger träumend mit der ganzen Menschheit verbunden fühlen. Da wir durch die verbesserte Informationsverbreitung nicht mehr die Naivität bezüglich Kolonialismus und Ausbeutung besitzen können wie die genannten, geliebten Dichter –
sollten wir lieber nicht versuchen, sie zu imitieren, sondern –
naja, das ist offen.
„Wie kann man den Versteher aushalten?“ Die argen Sätze sind wie zur Tarnung unter allerhand losem Geplapper versteckt.
Presseecho
 Eigentlich ist Lyrik für unsere Gegenwart die Literaturform schlechthin. Doch die Gedichtbände fristen immer noch ein Nischendasein. Kann die Leipziger Buchmesse, für deren Literaturpreis erstmals ein Lyriker nominiert ist, daran etwas ändern?
Eigentlich ist Lyrik für unsere Gegenwart die Literaturform schlechthin. Doch die Gedichtbände fristen immer noch ein Nischendasein. Kann die Leipziger Buchmesse, für deren Literaturpreis erstmals ein Lyriker nominiert ist, daran etwas ändern?
12.03.2015, von FELICITAS VON LOVENBERG, FAZ
Das Hamburger Abendblatt interviewte Jan Wagner („Mit dem feinsinnigen Alltagsbeobachter Jan Wagner ist auch ein Hamburger nominiert.“)
Ein Paukenschlag: Lyrik toppt Prosa. Eine mittlere Sensation: Mit Jan Wagners „Regentonnenvariationen“ holt erstmals ein Gedichtband den Leipziger Buchpreis / Mittelbayerische
Leipziger Buchmesse Mehr Licht für die Lyrik. Deutschlandradio Kultur
Der Preis zählt zu den wichtigsten Literaturauszeichnungen in Deutschland und ist mit je 15 000 Euro dotiert. / NZZ
Der Dichter auf verlorenem Posten.Wie erfreulich, dass Jan Wagner den Leipziger Buchpreis in diesem Jahr bekommt. Er ist einer der virtuosesten Lyriker, die wir gegenwärtig haben.
The poet Jan Wagner won the Leipzig Book Fair. All cheer. But why? This eternal entrails is a bankruptcy and symptomatic of the German literature. (…)
And the’ BBC’ analyzed these’ exciting news’ in advance at length on page one in the editorial and came to the conclusion that’ the balance of power between the novel and the poem would on the head made’.
In what world the living in? Sensation, Sensation: A sensation it might, if IS nudist would allow.
And power structure, power structure: this is not about the end of capitalism and the new social order.
So why are so drunk by itself – perhaps to hide the fact that it is a very cinnamon – and – sugary decision that would be strange if it were not symptomatic of a mental attitude that literature still, always, looks great German scholar in the country as a protection against the present. / Panteres

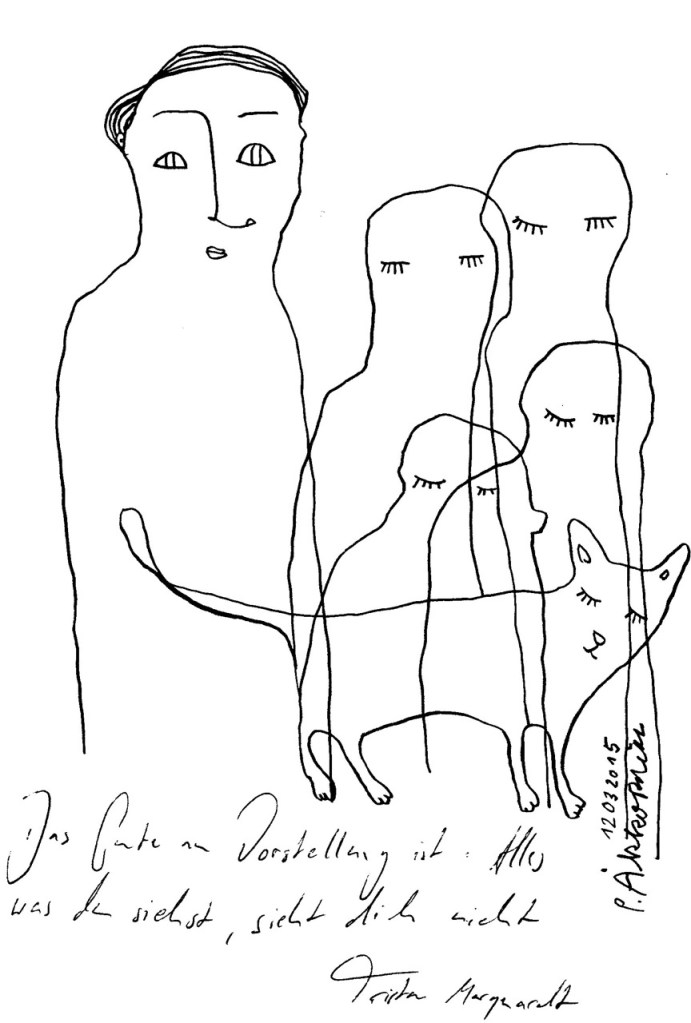



Liebe Lyriker: bitte jetzt nichts sagen. Liebe Jury: bitte mal in der Satzung nachsehen, ob man auch Leserkommentare auszeichnen kann. Davon gibts nämlich noch mehr als Lyrikbände. Und noch dämli…, ich meine noch-weniger-als-nichts-sagende.