Lyrikzeitung & Poetry News
Das Archiv der Lyriknachrichten | Seit 2001 | News that stays news
Poesie in Pillenform
Der Schweizer Dichter Felix Philipp Ingold war so freundlich, L&Poe eine Auswahl von unveröffentlichten Einzeilern/Monosticha, „die ich nicht mehr in Buchform bringen werde“, zu überlassen.
Lyrikzeitung & Poetry News wird ab heute etwa bis zum Jahresende jeden Donnerstag um 11 Uhr eines dieser Poesiekonzentrate, Gedichte in Pillenform veröffentlichen.
Heute:
Dort! der Wald. Nach unten steht er offen bis zum Meer. Tritt ein.
Siehe auch das Material zu NEE DIE IDEEN bei planetlyrik
Ingold bei L&Poe: https://lyrikzeitung.com/tag/felix-philipp-ingold/
Nee die Ideen
Pataphysische Fermaten
Matthes & Seitz
224 Seiten, Klappenbroschur
Mit einem Nachwort von Sabine Mainberger
ISBN: 978-3-88221-040-8
Für eine poetologische Lesart der Bratzlawer Kabbala
Auszüge aus einem Essay von Felix Philipp Ingold (in: Volltext 1/2015 S. 22ff)
Reb Tal: „Alle Buchstaben bilden die Abwesenheit.“
(Edmond Jabès)
Rabbi Nachman von Bratzlaw (1772–1810) – auch „der Bratzlawer“, „der Breslover“ genannt – ist durch die wortmächtige Vermittlung Martin Bubers als Verfasser ebenso erbaulicher wie abgründiger „Geschichten“ weithin bekannt, sogar populär geworden. Seit deren deutschsprachiger Erstausgabe von 1906 sind die Texte vielfach nachgedruckt und aus dem Deutschen auch in andere Sprachen übersetzt worden. Mit einer erweiterten, philologisch aufgebesserten, stilistisch aber glanzlosen Neufassung der Erzählungen des Rabbi Nachman von Bratzlaw hat Michael Brocke in den 1980er-Jahren das Interesse an dem großen chassidischen Gottesmann noch einmal nachhaltig reaktiviert. 1)
Weder bei Brocke noch bei Buber ist allerdings zu erfahren, dass Nachman nicht nur ein einfallsreicher und wirkungsstarker Geschichtenerzähler war, sondern auch – in viel größerem Umfang und viel höherer Qualität – ein Lehrmeister des Chassidismus und der neuzeitlichen Kabbala. Selbst Gershom Scholem, der dem chassidischen Judentum und der kabbalistischen Mystik mehrere Buchpublikationen gewidmet hat, geht an keiner Stelle auf Rabbi Nachmans Glaubens- und Lebenslehre ein, sondern begnügt sich damit, ihn, der als Chassid wie als Kabbalist eine herausragende (wiewohl umstrittene) Autorität war, in seinem umfangreichen Werk nur gerade zwei-, dreimal beiläufig zu erwähnen. 2)
Solche Missachtung (oder Verkennung) ist durchaus bemerkenswert, wenn auch kaum begreiflich, steht doch den rund 200 Druckseiten narrativer Prosa, die man von Nachman gemeinhin kennt, ein Konvolut von didaktischen, homiletischen, hermeneutischen, polemischen und aphoristischen Schriften gegenüber, das Tausende von Manuskript- beziehungsweise Druckseiten umfasst. Unter anderm wurde aus diesem Fundus das Opus magnum des Bratzlawers kompiliert, das 1808 und – postum – 1811 in zwei Teilen unter dem Titel Likkutei Moharan (Gesammelte Lehrmeinungen des Rabbi Nachman) erschien und das neuerdings als kommentierte hebräischenglische Parallelausgabe in fünfzehn Textbänden greifbar ist. 3) Eine deutsche Übersetzung der „Lehrmeinungen“ wie auch der übrigen diskursiven Schriften Nachmans liegt bisher nicht vor.
(…)
Nachmans Wunsch war es, das Denken von vorgegebener Begrifflichkeit, von logischer Schlüssigkeit, von objektiver Verbindlichkeit auf Subjektivität hin zu befreien, statt es – wie unter orthodoxen Juden oder aufgeklärten Christen üblich – methodologisch und institutionell zu domestizieren. Zum freien, intuitiven, nomadisch sich auslebenden Denken gehörten für ihn naturgemäß eben auch Widersprüche, Wiederholungen, Leerläufe, absurde Verschlaufungen, spontane Einfälle, und wenn man ihm Trivialität vorwarf, konnte er dies leicht mit dem Hinweis parieren, triviale Gedanken seien allemal freier und wahrhaftiger als fixe Ideen. Für noch freier und noch wahrhaftiger als irgendwelche in Worte gefasste Gedanken hielt er allerdings das Lachen und das Tanzen. Dass ein hochkarätiger Schriftgelehrter wie Gershom Scholem damit nicht eben viel anfangen konnte, ist leicht nachvollziehbar: Der Bratzlawer selbst hat die Gelehrsamkeit – auch seine eigene – bei der Wahrheitssuche als hinderlich empfunden und eben deshalb dafür plädiert, allem Vorwissen und Erkennenwollen zu entsagen.
Nachman selbst hat seine Autorschaft als problematisch, sein Werk als unzureichend, mitunter auch als frevelhaft und schädlich empfunden. Wichtige Teile daraus (angeblich die wichtigsten) hat er, geplagt von Selbstzweifeln und Wirkungsangst, dem Feuer übergeben – ein Vernichtungsakt, der den Text aufwerten, ihn in den Bereich des Hermetischen, wenn nicht gar des Heiligen einführen sollte: Niemand durfte ihn zu lesen bekommen, nur als ungelesener, als unlesbarer konnte er, meinte Rabbi Nachman, seinen vollen Sinn entfalten – indem er als Geheimnis bestehen blieb.
Was bei der talmudistischen Exegese schon lange praktiziert worden war, nämlich das fortschreitende, nicht so sehr auf den Text eingehende als vielmehr von ihm ausgehende Denken (ein Weiterdenken „über den Vers hinaus“ 6), das hat Rabbi Nachman mit rücksichtslosem Eigensinn ins Extrem getrieben, bis zu einem Punkt, an dem Wahn und Sinn tatsächlich kaum noch auseinander zu halten sind. Indem er den Akt des Schreibens – des Nachschreibens, Umschreibens, Überschreibens – an einen Mitautor delegierte, wertete er für sich selbst den Akt des Lesens zu einem produktiven Vorgang auf, der nicht mehr primär dem Verstehen und Bewahren des Gelesenen verpflichtet sein sollte, sondern der innovativen Sinnproduktion – ein Lektüreverständnis, das Fehldeutungen geradezu provoziert, um daraus neue Lesarten zu gewinnen.
Die so verstandene und so angewandte Lektüre ist dementsprechend eher als ein Gegenlesen denn ein Mit- oder Nachlesen aufzufassen, und „schöpferisch“ kann sie gerade dann werden, wenn sie auch als „Verlesung“, als Falschlesung ihre Berechtigung bekommt. 7) Der französische Talmudist Marc-Alain Ouaknin schlägt dafür die treffende wortspielerische Formulierung lire aux éclats vor, also „schallend lesen“ (mit impliziter Bezugnahme auf rire aux éclats, d. h. „schallend lachen“). 8) Da mit „éclats“ aber auch Funken oder Scherben gemeint sein können (denen in der Kabbala große symbolische Bedeutung zukommt), bedeutet der Ausdruck, als Homophon begriffen, auch so viel wie „in Trümmer lesen“. Beides – das laute Lesen wie das dekonstruktive Lesen – gehört zu Rabbi Nachmans Lektürekonzept, das den Schrifttext – ob als Feuerwerk oder als Trümmerwerk – überhaupt erst ermöglicht, ihn produktiv und innovativ werden lässt. Darin verbirgt sich die ungewöhnliche, deshalb auch unbequeme Idee – oder Vision –, wonach Autorschaft nicht Ordnung, sondern Chaos schafft, dass sie Funken und Scherben statt eines kohärenten Ganzen erzeugt, um auf diese (einzig mögliche) Weise den späteren Leser in die Pflicht zu nehmen, ihm aber auch die Möglichkeit zu geben, aus all den unverbundenen Fragmenten eine eigene, subjektiv bedingte Ordnung herzustellen und damit selbst zum Autor zu werden – zum Urheber eines Werks, das kraft kreativer Lektüre entsteht und in jedem Fall, ungeachtet seiner Qualität, als originell und singulär gelten darf. Eben diese Extremposition vertritt, zweihundert Jahre danach, der einflussreiche Großkritiker Harold Bloom, wenn er kurz und bündig festhält, literarisches Schreiben bestehe darin, Vorläufertexte – ob von Goethe oder Pound, von Homer oder Wallace Stevens – zu lesen, genauer: sie fehlzulesen (misreading), um sie als Überschreibung und Fortschreibung erneut produktiv zu machen. 9)
Originell können demzufolge bloß der Akt und die Art der Lektüre von Fremdtexten sein, nicht aber die angebliche „Schöpfung“ eines angeblichen „Originaltextes“. Was der solcherart entmächtigte Autor beim Lesen und durch das Lesen von Fremdtexten zu unverbundenen (oder unsinnig verbundenen) „Funken“ und „Scherben“ fragmentiert, das bietet sich dem nachkommenden Leser zu eigenmächtiger Rekonstruktion an, so dass dieser Leser zum Komplizen jenes Autors und zum Vollender eines Werks von eigener Ordnung und eigenem Anspruch wird. Ein Gleiches ließe sich in generellem Hinblick auf die Sprache sagen, die als solche auch bloß einen chaotischen Worthaufen bildet, der erst durch seine regelhafte Ausrichtung und praktische Erprobung zu sinnvollem Einsatz kommen kann. Was gemeinhin als „Originaltext“ gilt, ist demnach lediglich eine wie immer geartete, stets aber veränderte und ergänzte „Kopie“ eines bereits gelesenen Vor-Textes.
(…)
Wenn Rabbi Nachman, talmudistischer Tradition folgend, die in weitestem Verständnis „literarische“ Autorschaft an der kreativen Lektüre festmacht und das „Schöpfertum“ mit produktiv verfremdender Nachbereitung gleichsetzt, nimmt er damit um gut hundert Jahre vorweg, was die Poetik der klassischen Moderne, besonders aber die europäische Avantgarde der 1910er-, 1920er- Jahre zum Programm machen wird: Traditionsbruch als innovatives Verfahren, Schmähung anerkannter Autoritäten, Ablehnung oder Parodierung des bestehenden Kanons, Schwächung originaler Autorschaft bei gleichzeitiger Aufwertung des Sprachmaterials und seiner Eigendynamik, seiner „Selbstorganisation“ – all dies hatte sich auch Rabbi Nachman mit staunenswerter Radikalität und Konsequenz zur Aufgabe gemacht. Doch ihm ging es, wohlverstanden, nicht um Literatur als Kunst, sein Interesse galt allein der religiösen Rede, deren vielfältige Ausdrucksformen – von der Legende über den Lehrsatz bis zum Gebet – er gleichermaßen beherrschte und die er zusätzlich ergänzte durch bald kryptische, bald komische oder auch absurde Aussagen, deren Sinn darin bestehen sollte, neuen Sinn beziehungsweise Widersinn hervorzurufen. Nachmans bald schwärmerische, bald nörglerische Rhetorik war durchweg von einer fundamentalen Sprachskepsis konditioniert, von der schlichten Einsicht, dass die Sprache der realen Welt stets nachgeordnet ist, sie lediglich benennen, nicht aber hervorbringen kann.
(…)
Nachmans lurianische Vorstellung eines hinter seine und für seine Schöpfung sich zurückziehenden Gottes wie auch seine Funktionsbestimmung des Schreibens als kreative Lektüre weisen voraus auf den modernen Topos vom „Verschwinden“ oder vom „Tod“ des Autors, der in den antiautoritären 1968er-Jahren die internationale Literaturdebatte dominierte und schließlich in der Toterklärung der künstlerischen Literatur schlechthin ihren Höhepunkt fand. Heute, da jene Forderungen weitgehend vergessen sind und literarische Autorschaft erneut – bei Buchpremieren, Preisverleihungen, Lese- und Messeauftritten – vehement personalisiert wird, sollte man sich vielleicht einmal wieder daran erinnern, dass jeder Schreibende, ob er will oder nicht, an bereits Geschriebenem mit- und weiterschreibt, und dies in einem Ausmaß, dass man mit Edmond Jabès prosaisch konstatieren darf: Schreiben heißt geschrieben werden.
Anmerkungen
1 Die Geschichten des Rabbi Nachman, ihm nacherzählt von Martin Buber, Leipzig 1906; Die Erzählungen des Rabbi Nachman von Bratzlaw, aus dem Jiddischen und Hebräischen übersetzt und kommentiert von Michael Brocke, München 1985. Beide Ausgaben enthalten biografische Aufsätze zu Rabbi Nachman sowie Erläuterungen zu seinen Texten; Buber ergänzt die Geschichten durch ausgewählte „Worte des Rabbi Nachman“ aus andern Schriften und durch allgemeine Hinweise auf die jüdische Mystik.
2 Siehe u. a. Gershom Scholem, Die jüdische Mystik in ihren Hauptströmungen, Zürich 1957, wo Rabbi Nachman zwar als „tiefer Kopf“ (S. 380) genannt, aber nicht weiter gewürdigt wird. Man darf vermuten, dass der Bratzlawer wegen seiner inkohärenten Lehrmeinungen, seiner radikalen Sprach- und Wissenschaftsskepsis und generell wegen seines chassidischen Extremismus bei Scholem kein adäquates Verständnis finden konnte.
3 Likutey Moharan („Collected Teachings of Our Teacher, Rabbi Nachman“), translated to English and annotated by Rabbis Chaim Kramer and Moshe Mykoff, I-XV, Jerusalem/New York 1984-2014.
6 Vgl. dazu u. a. Emmanuel Lévinas, L’Au-delà du verset, Paris 1982.
7 In talmudistischem Verständnis ist Tradition, als das zu Lesende, eng an Innovation und Offenbarung gebunden: Lektüre als kreativer Prozess. Vom Exegeten wird „Kühnheit vor dem Text“ gefordert, er soll verfestigte Traditionen (Lesarten) unterlaufen und sprengen, darf sich nicht zufrieden geben mit dem, was er liest. Der vorgegebene Text kann und soll nicht eindeutig sein – nur in seiner Mehrstimmigkeit und Rätselhaftigkeit wird er sich als Lehre behaupten. Siehe dazu den aufschlussreichen Versuch über die „unendliche“ Bibellektüre jüdischer Kommentatoren von David Banon, La lecture infinie, Paris 1987.
8 Marc-Alain Ouaknin, Lire aux éclats, Paris 1989.
9 Harold Bloom, Kabbalah and Criticism, New York 1975, S. 102.
Linkssubversiver Spätpunk
Als Engstler 1986 mit dem Bücherverlegen begann, hatte er keinerlei Finanzkapital im Hintergrund. Das ist bis heute so. Sein Einmannbetrieb rechnet sich marktwirtschaftlich nicht. Engstlers Bücher, nunmehr knapp 200 und fast alle noch lieferbar, sind Nischenprodukte: Lyrik, experimentelle Prosa.
Das Bücherhaus hat etwas von einem verwunschenen Museum. Das Erdgeschoss sieht aus wie die Installation eines Buchladens mit Auslagen aktueller Titel, Tischchen mit Leselampe, Postkarten mit Agitpropsprüchen und Flugschriften unverständlicher Theorien. Das ganze Haus ist ein Speicher der Ideengeschichten. Lager und Archiv von der Beat-Generation über die Anti-Psychiatrie zur linksradikalen Subkultur.
„Es geht um das Bewahren“, wiederholt der eher linkssubversive als konservative Engstler. Denn die Hoch-Zeit dieser undogmatischen Rebellion, als sich Bücher wie „Rock-Power“ 200 000 mal verkauften, war ja schon in den 80er Jahren vorbei. Der Buchladen existiert theoretisch, wie ein abgeschlossenes Forschungsgebiet, denn praktisch kommt niemand. (…)
Engstler redet nicht gerne über seine eigene Dichterei. Wie jeder gute Verleger bringt er die Sprache immer wieder auf andere Autoren zurück. Dem großen „Indianer“ Burroughs hat er in Basel „die Hand geschüttelt“.
Von ihm hat er die „Cut-up“-Methode. Mit einfachen technischen Hilfsmitteln – einer Schere – wird da ein Text zerhackt und neu verklebt. Zeilen fallen, Bedeutungen verrutschen. Das Ergebnis dieser Zufalls-Montage ist Dekonstruktion von Sinn, im Wortverschnitt sollen sich neue poetische Assoziationsräume auftun.
Und kommen die Gedanken aus der Spur, spurt bald auch die Person nicht mehr. Hier ist der Keim zum Widerspruch, die Sprengkraft der Poesie.
„Die Revolution ist ein langes Gedicht. Jaja“, formulierte Helmut Salzinger einmal. Dessen Text-Collage „Swinging Benjamin“ von 1973, ein Klassiker der Pop-Kritik, ist inzwischen im Engstler Verlag wiederaufgelegt. Der ehemalige „Zeit“-Journalist Salzinger zog seinerzeit aufs Land, gründete die Kommune Head Farm, kaufte einen Fotokopierer zum Selbstpublizieren und schrieb von da an demütige Naturlyrik. Nach seinem Tod 1993 gab seine Frau Mo bei Engstler eine Handvoll nachgelassener Gedichte unter dem Titel „Vogelschau“ heraus.
Aber mit Schwärmerei und Naturverklärung hatte Engstler eigentlich nie was am Hut. Dem Spätpunk – der als alleinerziehender Vater das No-Future in ein Ja zum Leben ummünzte – war Sektiererei immer suspekt. Wer Hühner hält, muss sie auch schlachten können. Eines davon gibt es zum Abendessen. Wer Engstler ohne Auto in seinem heute literarischen Zonenrandgebiet besucht, bleibt am besten über Nacht. Im Gästezimmer steht mein Bilderbuchbauernbett.
Engstlers Bücher sind schön gemacht, aber nicht aufwendig. Er ist kein Bibliophiler, ihn interessiert der Inhalt. Eines der teuersten Bücher war vergangenes Jahr Paulus Böhmers Langgedicht „Zum Wasser will alles Wasser will weg“. Großes Format, bunte Zeichnungen, gutes Papier – „daran lass ich’s nicht scheitern“. Böhmer erhält am 2. April den Peter Huchel Preis dafür. Die Auflage von sagenhaften 500 Exemplaren sollte gerade so reichen.
In Engstlers Kalkulation spielt der Verkauf der Hälfte der Auflage die Produktionskosten ein. Gewinn wird in das nächste Buch investiert. (…)
In Papenfuß’ Schankwirtschaft Rumbalotte stellte Engstler vor kurzem auch sein neues Buch des Antipsychiaters Deligny vor. Die Kulturspelunke war brechend voll, es wurde höllisch gequalmt, Bücher wurden nicht gekauft. Junge Dichterinnen, Ann Cotten und Monika Rinck, rezitierten Gedichtetes, Papenfuß fummelte am Diaprojektor, Helmut Höge las aus seiner Endlosrecherche vor. / Sabine Vogel, FR
Anke-Bennholdt-Thomsen-Preis für Elke Erb
Elke Erb wird mit dem Anke-Bennholdt-Thomsen-Preis für Lyrik der Deutschen Schillerstiftung ausgezeichnet. Das über Jahrzehnte angewachsene Werk erstrecke sich von einer tagebuchartigen Prosa bis zu hoch konzentrierten Gedichten, hieß es in der Begründung der Jury. Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert und wird am 8. Mai im Deutschen Schillerarchiv in Marbach verliehen.
Vgl. hier
Lyrik des Anthropozäns
Zum Welttag der Poesie kooperiert das Lyrik Kabinett mit dem Deutschen Museum, um zu zeigen: Gedichte sollen nicht nur im engen Rahmen für Eingeweihte zelebriert werden, sondern die Menschen in unerwarteten Kontexten ansprechen und bereichern.
Seit es Menschen gibt, haben sie die Erde geprägt und verändert. Doch spätestens seit den 1950er Jahren hinterlassen wir auf unserem Planeten einen unwiderruflichen Fingerabdruck. Das Deutsche Museum widmet sich mit seiner großen Sonderausstellung „Willkommen im Anthropozän“ der in der Wissenschaft stark diskutierten Frage, ob sich die vom Menschen initiierten Veränderungen in geologischer Form niederschlagen und so langfristig sind, dass das Menschenzeitalter bereits ein neues Erdzeitalter ausgelöst hat. Bei der Lesung bilden die sechs Themenplattformen der Ausstellung – Evolution, Natur, Urbanität, Mobilität, Ernährung und Mensch-Maschine – die Orte, von denen aus die Gedichte hörbar werden, aufeinander antworten und das Anthropozän in der Vielfalt all seiner Aspekte kritisch spiegeln.
Lesung zum Welttag der Poesie in Kooperation mit dem Deutschen Museum
Lyrik des Anthropozäns
Es lesen eigene und fremde Texte:
Lydia Daher, Karin Fellner, Sabina Lorenz, Tristan Marquardt, Àxel Sanjosé, Nikolai Vogel
Konzept und Gedichtauswahl: Anja Bayer
Am Samstag, dem 21. März 2015
um 15:00 Uhr
Deutsches Museum
In der Ausstellung „Willkommen im Anthropozän. Unsere Verantwortung für die Zukunft der Erde“ (Sonderausstellungsraum 1. OG)
Eintritt: €8,50 / Studierende €3,00
Mitglieder Lyrik Kabinett: : gegen Vorlage der Mitgliedskarte ab 14 Uhr ermäßigter Eintritt €4 an Kasse 1 (keine Vormerkung nötig)
Auf der Suche

Fortgesetztes Vermächtnis
Der vorliegende Band „Fortgesetztes Vermächtnis“ beinhaltet bislang unveröffentlichte Gedichte, die allesamt nach der Jahrtausendwende entstanden sind. In höchster sprachlicher Präzision präsentiert sich Günter Kunert einmal mehr als Meister der Dichtkunst. Ungebrochen findet sich in diesen Gedichten Kunerts lebenslanges Nachspüren unscheinbarer Begebenheiten des Alltags. Ob es ein altes Haus ist oder ein Supermarkt, das menschliche Skelett oder Kometen im All, Kunert macht sich seinen eigenen unverwechselbaren Reim darauf. Zudem korrespondieren Kunerts Überlegungen immer wieder mit dem Phänomen der Sprache, ihren Buchstaben und Wörtern sowie den Büchern, die damit geschrieben wurden. / Volker Strebel, literaturkritik.de
Hubert Witt (Hg.) / Günter Kunert: Fortgesetztes Vermächtnis. Gedichte.
Carl Hanser Verlag, München 2014.
173 Seiten, 14,90 EUR.
ISBN-13: 9783446245303
Hilfsschule Bixley I und II – Zwei Bände des großen Lyrikers Ivan Blatný in famoser Übersetzung von Frank Wolf Matthies
von Axel Reitel (Auszug)
Als Milan Kundera im Jahre 1981 vom Journalisten Jürgen Serke auf dem Slawisten-Kongress in Philadelphia einen Gedichtband von Ivan Blatný (21. Dezember 1919 in Brünn – 5. August 1990 in Colchester) in die Hand gedrückt bekam, begann er zu schwärmen: „Den musst du besuchen. Wenn du wissen willst, wie phantastisch tschechische Lyrik in den vierziger Jahren war, dann wirst du es bei ihm erfahren. Einer der großen. Und Momente dieser Größe findest Du in diesem Band.“
Zu dieser Zeit lebte Ivan Blatný bereits seit drei Jahrzehnten zurückgezogen in einer psychiatrischen Anstalt, dem „Warren House“ im St. Clemen’s Hospital, bei Ipswitchtown, in England. Im Jahre 1948 hatte sich Blatný in London von einer tschechoslowakischen Delegation abgesetzt, um den geahnten stalinistischen Säuberungen in der Heimat zu entgehen.
(…)
Was Ivan Blatný fortan hinter den Anstaltsmauern schrieb, wurde ihm von den Wärtern im Warren-House Personal weggenommen, um es als das Geschreibsel eines Nicht-Zurechnungsfähigen wegzuschmeißen. Dies änderte sich – welch wundersame Fügung – mit einem Schlag im Jahre 1976.
Zu dieser Zeit war Ms. Frances Meacham als Krankenschwester tätig. Durch einen Angestellten kam ihr die Liste der Insassen des „Waren House“ in die Hände. Dabei machte sie der Name Ivan Blatný aus einem höchst erklärlichen wie schicksalhaften Grund hellhörig.
Am Ende des Zweiten Weltkrieges hatte Frances Meacham eine Liebesbeziehung mit einem tschechischen Piloten, der in der englischen Luftwaffe gegen Nazideutschland kämpfte.
Diese Beziehung zerbrach zwar nach dem Krieg, doch besuchte Ms. Meacham die CSSR immer wieder. Dieser Ivan Blatný, sagte sie sich, muss ein Tscheche sein.
Sie besuchte Ivan Blatný im „Warren House“ und bekam von ihm am Ende ihres Besuchs einen Packen Zettel mit der Bemerkung in die Hand gedrückt, die würden sonst doch nur „vom Wärter“ weggeworfen.“[1][2]Sie erkannte sofort, dass sie kein Geschreibsel eines Geisteskranken sondern hohe Dichtkunst las.
In der Folge sorgte Ms. Meacham mit Erfolg dafür, dass Ivan Blatný ab sofort einen „Tisch in der Ecke einer Anstaltswerkstätte“ bekam, wo er in Ruhe schreiben konnte: die Wärter warfen hinfort nichts mehr weg und Blatný bekam sogar eine Schreibmaschine. Derweil nahm sie, wieder mit Erfolg, Kontakt auf mit dem in Kanada ansässigen tschechischen Exil-Verlag „Sixty-Eight-Publishers“ auf. (…)
In den Jahren 2013 und 2014 legte der Schriftsteller und Dichter Frank Wolf Matthies „Bixley“ in deutscher Übersetzung komplett in zwei Bänden vor, jedoch „ausschließlich für den privaten Gebrauch und als Geschenk gedacht“, was der Rezensent mehr als bedauerlich findet, denn Milan Kunderas Schwärmen lässt sich bei der Lektüre im Jahr 2015 immer noch nachvollziehen. Mit seinen Übertragungen ist wirklich Frank Wolf Matthies etwas Wunderbares gelungen.
Bereits der Titel „Hilfsschule Bixley“ verweist auf ein zu erwartendes singuläres Ereignis und ist eines schon selbst. Man kann lange auf dem aktuellen „Lyrik-Markt“ nach einem Vergleich suchen: die Gedichte der Bixley-Bände geben sich nicht nur so. Die frühe Lyrik Ivan Blatnýs umfasst insgesamt vier Bände, der letzte erschien gegen Ende des Zweiten Weltkrieges erschien. Zu „Quellen der Inspiration“ (Serke) seiner Inspiration zählte Ivan Blatný die Dichtungen von T.S. Eliot, Carl Sandberg, Dylan Thomas und Walt Whitmann.
Eines seiner Hauptthemen ist das Glück auf dieser Welt. In einem Gedicht aus dem Jahr 1941 schrieb dazu Blatný: Siehe, wir sind in der Landschaft der neuen Wiederholungen, / und die Stadt auf den Hügeln unter uns tritt aus dem Morgen wie aus einem Bade heraus […] / Mehr bei tabula rasa
PS: Wie der Rezensent erfuhr, befindet sich „Hilfsschule Bixley Band III“ in Progress.
Ivan Blatný, Hilfsschule Bixley & andere Gedichte. Mit Bildern von Lutz Leibner. Ausgabe nur für Privat und zum Verschenken. Nicht paginiert. Nachdichtungen von Frank Wolf Matthies. Alle Rechte beim Nachdichter.
Ivan Blatný, Hilfsschule Bixley II. Gedichte. Mit Bildern von Lutz Leibner. Ausgabe nur für Privat und zum Verschenken. Nicht paginiert. Nachdichtungen von Frank Wolf Matthies. Alle Rechte beim Nachdichter.
Internetseite des Nachdichters:
www.frankwolfmatthies.de
[ii] Jürgen Serke, Die verbannten Dichter, Fischer TB 1982, S.175.
[iii] Ebenda, S. 180.
A Lid iz a Lid
Über den jiddischen Dichter Avrom Sutzkever schreibt Daniel Kahn (bei Faustkultur). Zitat:
Zwar schrieb er keine Lieder im eigentlichen Sinne, aber dem Jiddischen ist diese Unterscheidung ohnehin fremd. Ein Gedicht ist ein „Lid“. Genauso ein Musikstück. A Lid iz a Lid.
Auf die Frage, was ihnen denn zu moderner jiddischer Lyrik einfalle, erwähnen die meisten Menschen wahrscheinlich das Shtetl oder das Ghetto – wenn ihnen denn überhaupt irgendetwas einfällt. Das ist gleichermaßen beklagenswert und verständlich, wenn man in Betracht zieht, dass die Geschichte des jüdischen Lebens in Osteuropa gewöhnlich auf das dramatische Narrativ rückwärtsgewandter Primitivität und brutaler Vernichtung reduziert wird. Und doch greift es viel zu kurz. Denn: Die jiddische Kultur vor dem Holocaust war kosmopolitisch, international und stand in regem Austausch mit der literarischen Moderne. In Odessa, Warschau, Chicago, New York, Berlin und Buenos Aires waren nahezu alle epochemachenden Werke der Literatur und Philosophie in jiddischer Übersetzung erhältlich. Die Menschen dort lasen Proust, Nietzsche und Whitman. Joyce, Heine und Hamsun. Oder die russischen Autoren Majakowski, Dostojewski und Gogol. All diese Autoren waren Vorbilder für jiddische Schriftsteller wie Peretz, Ansky, Manger und Bashevis Singer. Tatsächlich waren die Jahre vor dem Holocaust eine unglaublich fruchtbringende Zeit für eine außergewöhnlich fruchtbare Kultur. Eines ihrer Zentren – sowohl religiös als auch säkular – war Wilna, das heutige Vilnius, welches damals Juden auf der ganzen Welt als „das Jerusalem Litauens“ bekannt war.
Einer der Protagonisten des reichen kulturellen Lebens dieser Stadt war der junge Avrom Sutzkever. Geboren wurde er 1913 im Gebiet des heutigen Weißrusslands; zum Zeitpunkt seines Todes im Jahre 2010 galt er als einer der größten jiddischen Dichter des 20. Jahrhunderts. Seine Bekanntheit stützte sich dabei nicht zuletzt auch auf das von ihm herausgegebene Magazin für jiddische Literatur Di Goldene Keyt (Die Goldene Kette), welches er in seiner neuen Heimat Israel nach dem Krieg gründete. (Sein kontinuierliches Engagement für das Magazin ist schon für sich genommen bemerkenswert, da der junge Staat Israel sein Bestes tat, die jiddische Sprache und Kultur zu unterdrücken.) Trotz all seiner Erfolge ist Sutzkever einem größeren Publikum außerhalb der Judaistik-Abteilungen einiger Universitätsbibliotheken weitgehend unbekannt geblieben. Und auch innerhalb besagter Judaistik-Abteilung wird man ihn wahrscheinlich eher unter der Kategorie „Holocaust-Dichtung“ als unter „jiddische Dichtung“ finden.
Ich persönlich stieß auf seine Lyrik in einem Buch über eben jenes Thema, nämlich in David Roskies Against the Apocalypse. Das war nur wenige Monate nachdem ich nach Berlin gezogen war – eine Stadt, die ich als amerikanischer, im Wissen um den Holocaust erzogener Jude vorher noch nie besucht hatte. Mein erster Kontakt mit dem Ort, an dem die Katastrophe ihren Ausgang nahm, stellte die von mir bisweilen akzeptierten Narrative – zum Beispiel „jüdische Hilflosigkeit angesichts des Krieges“ und „nationalistischer Triumphkult in Israel nach dem Krieg“ – vollkommen in Frage. Einer Figur wie Sutzkever in diesem Kontext zu begegnen war für mich faszinierend. Ich stieß auf das Gedicht „Vi Azoy“, welches in lateinischer Umschrift so beginnt:Vi Azoy?
Vi azoy un mit vos verstu filn,
dayn bekher in tog fun bafrayung?
Bistu greyt in dayn freyd tsu derfiln,
dayn fargangenhayts fintstere shrayung?
Vu es glivern sharbns fun tegin, a tom on a grunt, on a dek? …Es gibt viele Übersetzungen dieses Gedichts, die Folgende ist meine eigene. Sie ist frei und rhythmisch, Ausgangspunkt eines Liedes:
Wie und mit was wirst du füllen
deinen Becher am Tag der Befreiung?
Bist du bereit beim Freudengebrüll
zu hören das Echo der Schreie?
Wo Scherben funkeln von Tagen
In Gräben ohne Boden, ohne Dach?Du wirst Schlüssel suchen passend
für deine verrosteten Schlösser.
Wie Brot wirst du beißen die Gassen
Und denken: früher war es besser.
Und Zeit wird stumm an dir nagen
Wie eine Grille gefangen in der FaustDeine Erinnerung wird man vergleichen
mit einem alten, erloschenen Dorf.
Und deine Augen werden dort schleichen
Wie ein Maulwurf, wie ein Maulwurf – –(dt. Übersetzung: Max Czollek)
(1) Vi Azoy?
Fun Avrom Sutzkevervi azoy un mit vos vestu filn
dayn bekher in tog fun bafrayung?
Bistu greyt in dayn freyd tsu darfiln
dayn fargangenheits finstere shrayung?
Vu es glivern sharbns fun teg
in a tom on a grunt, on a dek?Du vest zukhn a shlisl tsu pasn
far dayne farhakte shleser
vi broyt vestu baysn di gasn
un trakhtn: der frier iz beser
un di tsayt vet dikh ekbern shtil
vi in foyst a gefangene grilun s’vet zayn dayn zikorn geglikhn
tsu an alter farshotener shtot
un dayn droysiker blik vet dort krikhn
vi a krot, vi a krot – –in Vilner geto, 14.2.1943
Jiddische Originalfassung

Mehr bei Faustkultur
Poesie und Subversion in China
Die chinesische Dichtung verfügt über eine 3000 Jahre alte Lyriktradition – eine schier unerschöpfliche Quelle. Wie keine andere hat sie in den letzten Jahren Einflüsse aus anderen Sprachen aufgenommen und sich dabei ebenso rasant verändert wie ihr Land. In drei Veranstaltungen fragt das 16. poesiefestival berlin am 24. und 25. Juni 2015 nach der subversiven Sprengkraft und dem kreativen Potential der zeitgenössischen chinesischen Lyrik im Spannungsfeld zwischen Tradition und Moderne. Zu Gast sind einige der experimentierfreudigsten Lyrikerinnen und Lyriker aus China sowie chinesische Dichter, die heute im Exil leben. Gemeinsam präsentieren sie die außergewöhnliche Vielfalt der aktuellen chinesischen Dichtung, wie sie in Deutschland in diesem Umfang bisher noch nicht zu erleben war.
Mit dabei sind Han Bo (Autor, China), Jiang Tao (Autor, China), Liao Yiwu (Autor, China / Deutschland), Lü Yue (Autorin, China), Ming Di (Autorin, China / USA), Wang Pu (Autor, China / USA), Yang Lian (Autor, China / Deutschland / Großbritannien), Zang Di (Autor, China).
Das poesiefestival berlin ist ein Projekt der Literaturwerkstatt Berlin und der Akademie der Künste und findet in der Akademie der Künste am Hanseatenweg statt.
Die moderne chinesische Lyrik kommt weder ohne die Auseinandersetzung mit ihrer immer noch lebendigen Tradition aus, noch ohne eine Positionierung angesichts moderner Entwicklungen in China und der Welt. Zwischen östlichen und westlichen Einflüssen entsteht ein einzigartiges Bekenntnis zur kreativen Grenzüberschreitung, das Dichter aus China und der Diaspora in einer Lesung seh- und hörbar machen. Eine weitere Lesung und eine Podiumsdiskussion beschäftigen sich mit Mitteln und Möglichkeiten von Gesellschaftskritik im poetischen Diskurs. Die zeitgenössische chinesische Lyrik verfügt über ein breites Arsenal subversiven Sprachgebrauchs, mal subtil, mal konfrontativ, mal satirisch. Lyriker aus dem Exil und aus China zeigen, wie daraus Gedichte von erstaunlicher Schlagkraft entstehen.
Das 16. poesiefestival berlin findet statt vom 19. – 27. Juni 2015 in der Akademie der Künste, Hanseatenweg. Weitere Informationen unter www.literaturwerkstatt.org
Das poesiefestival berlin ist ein Projekt der Literaturwerkstatt Berlin in Kooperation mit der Akademie der Künste und wird gefördert durch den Hauptstadtkulturfonds. Mit freundlicher Unterstützung durch: Friedrich-Ebert-Stiftung
Mi 24.6.2015, 19.00 Uhr
3000 Jahre Moderne
Chinesische Lyrik zwischen Ost und West
Lesung in Chinesisch und Deutsch
Ort: Akademie der Künste, Hanseatenweg 10, 10557 Berlin
Mit: Zang Di (Autor, China), Yang Lian (Autor, China/Deutschland/Großbritannien), Ming Di (Autorin, China/USA), Wang Pu (Autor, China/USA)
Moderation: Daniel Bayerstorfer (Übersetzer, München)
Do 25.6.2015, 17.30 Uhr
Wie nicht sprechen?
Poesie und Subversion in China
Diskussion in Chinesisch und Deutsch
Ort: Akademie der Künste, Hanseatenweg 10, 10557 Berlin
Mit: Liao Yiwu (Autor, China/Deutschland), Zang Di (Autor, China), Lü Yue (Autorin, China), Jiang Tao (Autor, China)
Moderation: N.N. und Ming Di (Herausgeberin, China/USA)
Do 25.6.2015, 19.00 Uhr
China heute: Lyrische Positionen
Lesung in Chinesisch und Deutsch
Ort: Akademie der Künste, Hanseatenweg 10, 10557 Berlin
Mit: Liao Yiwu (Autor, China/Deutschland), Lü Yue (Autorin, China), Han Bo (Autor, China), Jiang Tao (Autor, China)
Moderation: Daniel Bayerstorfer (Übersetzer, München)
Rhyme
[Anthony] Madrid spoke first, beginning with a general précis of his argument about the trajectory of rhyme in English verse. I’d heard this before, when Madrid joined Don Share and Lea Graham on a panel on the poetry of Michael Robbins I chaired at the Midwest MLA a year ago, but it’s such an intriguing argument I was happy to hear it rehearsed again. The gist of it is that after the Elizabethan period, whole categories of rhyme are, essentially, decommissioned from English verse, or become far less common (critics of Madrid’s theory love to find exceptions, but a full reading of his doctoral work in The Warrant for Rhyme reveals a strong case for a general trend of the kind he des/ cribes). Rhymes that involve strong semantic links—semantic similarities, or opposites, or rhymes from the same semantic category—greatly diminish over the course of the seventeenth century. So me/thee, mine/thine, he/she, berry/cherry, and the like become far less common. Madrid makes much of this: the link between rhymes becomes less rational, he says, and more a matter of mystery, as if the poet wills the rhyming words to belong together for reasons unknowable to the intellect.
The anti-semantic nature of rhyme becomes a norm in the eighteenth century, and it is only with Thomas Percy’s 19765 Reliques of Ancient English Poetry, an antiquarian’s selection of old ballads and other poems, that the older style of rhyme begins to return for the Romantic era. A Romantic like Byron, when he is serious, as in Childe Harold, rhymes like an eighteenth century poet, but when he’s comic, as in Don Juan or Beppo, he makes rhymes that go out of their way to draw attention to themselves, and appear as stunts (as Butler’s comic rhymes in Hubridas did). The rhyme becomes something deliberately original, frame-breaking and winking. And this sounds the death-knell for rhyme, since over the nineteenth century rhyme becomes less a holistic part of poems and more of an attention-grabbing device, until in the modern era it is all-but abandoned. / samizdatblog
Formate
„Und noch etwas wollte Hans Ulrich Obrist wissen. Beim Kuratieren von Kunst sei es ja so, dass man immer neue Formate entwickeln müsse – Performances, Computerinstallationen, Vitrinen – , weil nur die im kulturellen Gedächtnis bleiben würden [sic.]. Wie sich das damit denn in der deutschen Literaturszene verhalten würde?“
(aus: Dirk Knipphals, „Auf der Suche nach dem Hype“, TAZ vom 16.03.2015)
Format: HGL HalliGalliLesung
Erprobt: am 10.01.2015 zum Winterrundgang der Baumwollspinnerei in Leipzig, mit Ulrike Fiebig, Tim Holland und Michael Spyra als Gäste der Pilotenküche in der Halle 14.
Geeignet für: 3 und mehr Lesende/Autoren
Textformen: Lyrik, kurze Prosa und dramatische Texte eigenen sich besonders
Benötigt werden: 1x Rezeptionistenklingel, wahlweise dem namenstiftenden Kartenspiel entnommen.
Aufbau: Die Lesenden setzen sich im möglichst gleichen Abstand um die Klingel. Die Klingel muss jederzeit für jeden erreichbar sein.
Ablauf: Einer beginnt zu lesen und lässt deutlich hörbare Pausen zwischen seinen Leseabschnitten. Werden Anknüpfungspunkte erkannt, dürfen die anderen Lesenden auf die Klingel schlagen. Wer die Klingel zuerst trifft, darf die Lesung fortsetzen. Es wird so lange gelesen, bis einer der anderen auf die Glocke haut!
Anknüpfungspunkte sind hier weitestgehend frei, wenn auch für die Beteiligten nachvollziehbar zu interpretieren. Das können Stimmungen sein, Haltungen, Vokabeln die wiedererkannt werden, Themen, und so weiter.
In einer Variation des Spiels kann sich derjenige, der die Glocke trifft, auch etwas wünschen. Zum Beispiel: „Ich möchte, dass Ulrike den Text noch mal liest!“ oder „Ich würde gern hören, wie Tim sein Schaflied singt.“ Oder anderes.
Wirkung: Durch den Glocken- oder Klingelton hat der Zuhörer die Möglichkeit seine Konzentration und Aufmerksamkeitsverteilung neu zu arrangieren. Der Wettstreit der Lesenden wird auch zu einem Streit um die Glocke.


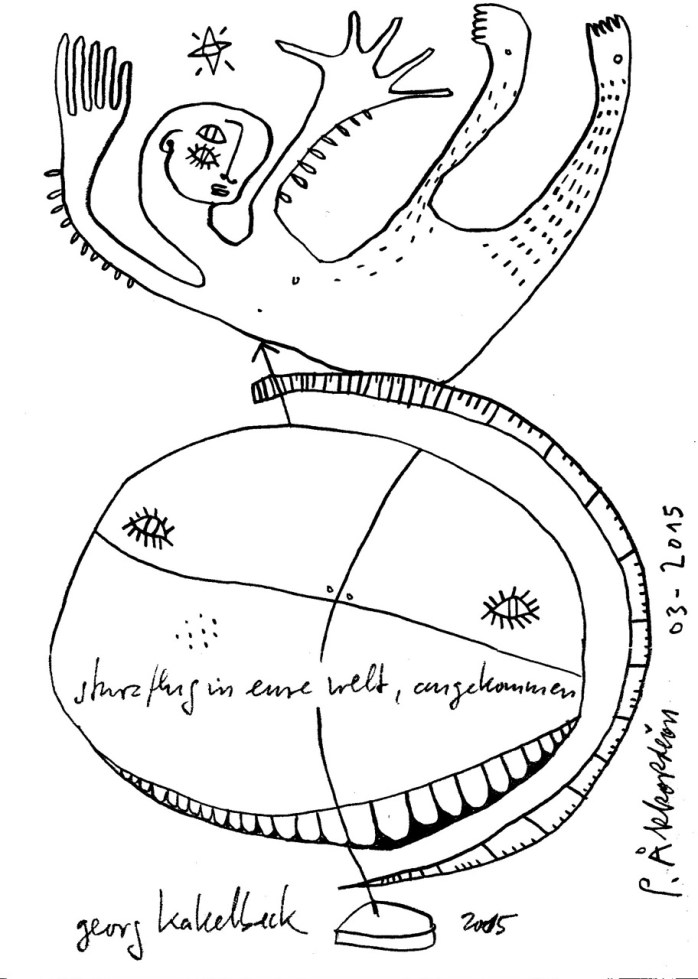




Neueste Kommentare