Lyrikzeitung & Poetry News
Das Archiv der Lyriknachrichten | Seit 2001 | News that stays news
Stanze
Jean Moréas
(* 15. April 1856 in Athen; † 30. April 1910 in Paris)
Stanze Sagt nicht: das Leben ist ein Festgelage; So spricht die Torheit wohl und ein gemeiner Sinn. Doch sagt nur ja nicht: es ist grenzenlose Plage; Dies zeugt von schlechtem Mut, dem alle Kräfte fliehn. Lacht, wie die Lenzluft spielt im Rutenwerk der Weiden, Weint wie der Tauwind, wie die Flut am Meeresstrand, Erkostet jede Lust, erduldet alle Leiden; Sagt, es ist viel, es ist, wie wenn der Traum entschwand.
Deutsch von Duschan Derndarsky, aus: Französische Lyrik von den Anfängen bis zur Gegenwart, zweisprachig. Hrsg. Kurt Schnelle. Leipzig: Reclam, 1967, S. 93
Stance Ne dites pas : la vie est un joyeux festin ; Ou c’est d’un esprit sot ou c’est d’une âme basse. Surtout ne dites point : elle est malheur sans fin ; C’est d’un mauvais courage et qui trop tôt se lasse. Riez comme au printemps s’agitent les rameaux, Pleurez comme la bise ou le flot sur la grève, Goûtez tous les plaisirs et souffrez tous les maux ; Et dites : c’est beaucoup et c’est l’ombre d’un rêve.
Ginster
Joan Maragall
(* 10. Oktober 1860 in Barcelona; † 20. Dezember 1911 ebenda)
GINESTA, wieder der Ginster! Der Ginster mit so viel Duft! Der Ginster, meine Geliebte, die zur Zeit der Hitze kommt. Um sie innig zu umarmen, lief den Hügel ich hinauf: Mit dem allerersten Kusse, hat sie mich ganz parfümiert. Der Wind wehte sehr erregend, und die Sonne glänzte nass: Wütend wandte sich die Pflanze hin zur Sonne, die nur lacht. Da fass ich sie um die Hüfte und die Schere macht schnippschnapp, während sie die Schönheit schneidet, bis das Herz hat Stopp! gesagt. Einer unschuldigen Weide nahm ich eine Rute ab, damit band ich die Geliebte eng zu einem kurzen Strauß. Als ich ihn gebunden hatte, wandte ich das Gesicht zum Meer ... Das Gesicht zum Meer ich wandte, das da glänzte wie Kristall; hielt den Strauß hoch in die Lüfte, und dann rannte ich hinab. (1907)

Aus dem Katalanischen von Àxel Sanjosé, aus: Joan Maragall, Der Pinien Grün, des Meeres Blau. Gedichte. katalanisch/deutsch. Ausgewählt, übertragen und mit einer Einführung von Àxel Sanjosé. München: Stiftung Lyrik Kabinett, 2022, S. 119
LA GINESTA altra vegada! La ginesta amb tanta olor! És la meva enamorada que ve al temps de la calor. Per a fer-Ii una abraçada he pujat dalt del serrat: de la primera besada m’ha deixat tot perfumat. Feia un vent que enarborava, feia un sol molt resplendent: la ginesta es regirava furiosa al sol rient. Jo la prenc per la cintura: l’estisora va en renou desflorant tanta hermosura, fins que el cor me n’ha dit prou. Amb un vímet que creixia innocent a vora seu he lligat la dolça aimia ben estreta en un pom breu. Quan I'he tinguda lligada m’he girat de cara, al mar... M’he girat al mar, de cara, que brillava com cristall: he aixecat el pom enlaire i he arrencat a córrer avall.
Bei der Lektüre eines französischen Textes
L&Poe Journal #02 Essay
Essay von Bertram Reinecke (Zweite Folge)
Bei der Lektüre eines französischen Textes
Beim Lesen eines spätstalinistischen Dichters
Über Haltung und Versgrammatik (2)
Bei der Lektüre eines französischen Textes
Besonders deutlich wird mir die umschriebene Farbenblindheit wenn ich beobachte, wie nahezu immer, wenn über Baudelaires Albatros gesprochen wird, jemand mit Emphase auf Georges „klassische“ Übertragung dieses Textes verweist, die nicht zu den Höchstleistungen der Übersetzungskunst gehört.[1] Nachgereichte Erläuterungen „wie geknickt“, „der matte steife“ und angeklebte Genitive „des deckes gängen“ sind nur zweitbeste Lösungen, ebenso ein Kompositum wie „bogenstrang“ (das um des Reimes Willen hier zudem den Sinn verdunkelt, denn der Fokus des Gedankens liegt eher darauf, dass der Vogel getroffen oder nicht getroffen würde, der hantierende Schütze ist ein Nebenschauplatz.) Abgesehen vielleicht vom Kompositum „bogenstrang“ dichtet George so auch nur, wenn er nicht anders kann (man vergleiche mit seinen eigenen Gedichten). Und weil der Meister für seine Fans immer recht hat: Ich bestehe hier nicht auf geschmeidigeren Übersetzungen, während es George etwa um eine Rauhigkeit ginge.[2] Das elidierte e bei Albatrosse ist mir zwar plausibel zur Vermeidung des Nebenklangs auf „die Trosse“. (Man hätte davon umgetrieben, aber ohne allzu hohen Preis den Vogel im Singular verbauen können, wie Wilhelm Richard Bergers Übertragung, wenn man sich scheute, auf ein Synonym auszuweichen). Und gerade weil bei George in der 7. Zeile etwas, was mir ebenfalls wenig glücklich scheint, nämlich mit der Machart des Textes auf seinen Inhalt zu verweisen: „Als sie • die herrn im azur • ungeschickt“ indem der Text hier metrisch aus dem Tritt kommt, offenbar intendiert war[3], kommen mir die scheinbar von ihm nicht zu vermeidenden Missklänge wie unglückliche Verschleierungen dieses Einfalls vor. Bis auf dieses durch einen eigentümlich ungünstigen Reim recht teuer erkaufte Gimmick findet etwa Monika Fahrenbach-Wachendorff praktisch überall glücklichere Lösungen und bleibt auch auf der Ebene der Wortsemantik und Reihenfolge tendenziell genauso nahe oder näher am Original. Wo sie scheinbar etwas nachzustellen genötigt wird, gelingt es ihr, das grammatisch im Folgetext überraschend wieder einzufangen: „Die Könige der Bläue, wie verlegen / Und kläglich da die weißen Flügel hängen,“ Das „wie verlegen“ zunächst scheinbar eine Adjektivergänzung zu „Könige der Bläue“ erweist sich zusätzlich als Attribut zu „hängen“. „Dem Herrscher in den Wolken gleicht der Dichter, / Der Schützen narrte, der den Sturm bezwang; / Hinabverbannt zu johlendem Gelichter,“ „der den Sturm bezwang“ zunächst (zu) später Nachtrag wahlweise zu „Herrscher“ oder „Dichter“ lässt sich im Nachgang als Subjekt der letzten Zeilen lesen und sorgt so dafür, die Plastizität der Methapher Dichter-als-Vogel zu erhöhen. Fritz Gundlach macht sich, indem er seiner Übersetzung eine Hebung mehr gönnt, zwar die Arbeit scheinbar leichter, er überträgt aber damit den Alexandriner des Originals. Die sind dann aber wieder doch nicht ganz so leicht zu gestalten ohne damit aufdringlich zu werden.
Einfacher macht es sich Simon Werle. Er ignoriert zu häufig, dass auch im französischen Alexandriner nach der 6. Silbe eine Wortgrenze liegen sollte. So kann dies verschleifen nicht mehr, wie bei einem sparsameren Einsatz, als Kunstmittel wirken, sondern wird Bequemlichkeit. Mir ist nicht klar, wofür er diese größeren Freiräume zu nutzen vorhatte. Es gibt durchaus besondere Schönheiten in seinem Albatros: Einige Zeilen erfüllen alle Forderungen, die man an einen guten Vers stellen kann, bleiben dabei aber so nüchtern gesprochen, dass sie selbst in einem Prosatext kaum auffallen würden, „Matrosen fangen — so vertreiben sie die Zeit -“ „Verwehren seine Riesenschwingen ihm das Gehen.“ Aber dafür bekommt man allzu oft nachgeschobene Erläuterungen oder angeklebte Genitive. Selbst, wo diese sich durch den Bau des französischen Vorbilds rechtfertigen ließen, sollte man zumindest zögern, sie im Deutschen nachzubilden.[4] Der französische Alexandriner, etabliert im Barock, hat als der Vers der Klassik dort eine ungebrochenere Tradition und verträgt eine größere Prätention als das deutsche Sondermaß einer abgelegten Epoche. Zumal der Eindruck des Angeklebten sich verstärkt, wenn die Hebung unmittelbar davor Schwierigkeiten hat sich zu behaupten, sei es, weil dort eine gänzlich unbetonte Silbe steht: „ Die großen weißen Fittiche bejammernswert“ oder weil ein einsilbiges und damit notorisch unentschiedenes[5] Wort den Platz der Hebung beansprucht: „Des Schiffs Verfolger in gelassenem Geleit“. Eine zwanglose Hebung ergibt sich in solchem Falle nur, wenn auch auf dem kleinen Wort ein semantisches Gewicht liegt. Wenn es vielleicht überraschend wäre, dass die Verfolger in diesem Geleit sich aufhielten – statt etwa außerhalb; wenn es hier sonderlich überraschend wäre, dass sich der Prinz nicht neben oder unter seinem Thron befindet: „Der Dichter gleicht dem Prinzen auf der Wolken Thron“ oder wenn ein „und“ Bestandteil einer kräftigen Klimax ist, was man der Zeile „Verbannt zu Boden und umbuht von lautem Hohn,“ nicht unbedingt nachsagen kann. Dadurch wird die Spitzfindigkeit „von lautem Hohn“ besonders aufdringlich. Ein wenig sieht es so aus, als wäre so etwas hier dem Reimzwang geschuldet, denn alle diese Geschraubtheiten finden sich im Versausgang. („der Hoheit bar“, „ Sturmeswehen“) In der Mitte, besser noch am Anfang, hätten sie eher gefunden und weniger präziös gesucht gewirkt. (Man hätte eher das Vertrauen entwickelt, dass diese Eigenheiten, obwohl einem selbst schwer zugänglich, hier mit gutem Grund ständen.)[6] Natürlich macht sich so harsche Kritik einer vielfach auch gefeierten Übersetzung sehr angreifbar.[7] Deshalb: Diese Detailkritik bezieht sich zunächst nur auf Werles Fassung des Albatros. In anderen Texten findet er durchaus glücklichere Lösungen und man mag ihm an vielen Stellen eine besondere Worttreue zuerkennen. Die Übersetzung dieses Gedichts ist auch schon deshalb zusätzlich eine besondere Herausforderung, weil es nochmals häufiger übersetzt wurde als andere Texte Baudelaires. Wer, wie Werle, den Vorschlägen seiner Vorgänger nicht folgen möchte, findet hier ein noch abgegrasteres Feld von möglichen Lösungen vor und muss zu immer exoterischeren Ideen Zuflucht nehmen.
In Bezug auf seine Übersetzung aber von einem „Qualitätssprung“ zu sprechen, wie Rainer Moritz im DlF dies tat und zu loben, er mache die Blumen des Bösen wieder lebendig, insofern er das Wilde (Spleenige?) dieses Dichters wieder zugänglich mache, scheint mir von einem verfehlten Blick auch den Dichter und seine Rezeptionsgeschichte zu zeugen.[8] Lag das Skanalöse, das was damals Irritierte nicht vielmehr darin, dass Baudelaire eine schockierende Wirklichkeitswahrnehmung in ein (oft ostentativ) straffes Verskleid verarbeitete? (Dieser poetische Anspruch ist für sich selbst genommen keineswegs neu: Jede Zeit hat ihre Schockmomente und muss ihren Dichter finden, genau diese Schocks auszulösen, denn die Barockdichter taten teils nichts anderes.) Wenn sich eine „glänzende Neuübersetzung“ (Andreas Isenscheid) dazu entschließt, diese Spannung aufzugeben, und die Regler in Bezug auf Intensitätsvokabular (etwas zu) hoch gedreht wurden, erwiese sich der frische Glanz als einer von Neusilber: Die Gedichte mögen in dieser Fassung neue Frische erhalten.[9] Indem sie sich dazu aber am Kern vorbei mogeln, ersparen sie uns das Eingeständnis, dass manches, was damals interessant war, es heute vielleicht nicht mehr ist: Walter Benjamin beobachtet Baudelaires Dichtkunst dabei, wie sie sich scheinbar den Markt noch anschaut, sich insgeheim aber schon feilbietet, er beschreibt den Dichter als den freigesetzten Bohemien, der noch unentschieden ist, ob er Heldenadel preisen oder sich dem durchschnittlichen Besitzbürgertum anschmiegen soll. Er würde sich auch zu den Unterdrückten gesellen, wenn ihm deren Massenführer nicht zuwider wären. Ist die Haltung des privaten Flaneurs, der meint, die gesellschaftliche Welt (lediglich) von außen zu überblicken, deren Teil er unbewusst ist, nicht längst gängige Münze geworden? (Schon Literaturbetrieb z.B. sind schließlich auch immer die anderen.) Wäre es nicht produktiver zuzugeben, das uns manches an dem Dichter darum kalt lässt? Dass die relative Durchgesetztheit von ihm erstmals erprobter Haltungen seine Revolte im Nachhinein etwas biederer aussehen lässt? Es würde uns zumindest die Chance bieten, statt mühselig seinen Reiz gewissermaßen ins Wedekindsche verflachend neu zu inszenieren, um uns unseres rechten Glaubens in der Klassikerkirche zu versichern, lieber zu schauen, ob dort, wo das Versprechen seiner Dichtung längst eingeholt ist, nicht andere Utopien offen zu Tage liegen, die wir noch nicht richtig gesehen haben, weil uns eben gerade noch der Dichter auf dem Podest beschäftigte. Wir könnten zum Beispiel Trakl nicht immer nur als den existenziellen Ausdruckskünstler mit dem schweren Schicksal lesen, sondern als eine eigene subjektive Version von Spleen und Ideal, indem wir das versierte Verskleid seiner früheren Gedichte, mit ihrer ironischen Distanznahme ernster nähmen. („Wie schön sich Bild an Bildchen reiht“ Verklärter Herbst) Wir könnten es lächerlicher finden, wenn uns heute George als ein Urvater neuer Klassizität angedient wird, während die Zeitgenossen seinen gespannten Stil als schroffe Modernität wahrnahmen. Wenn seine Rezeption weniger schockhaft verlief, als die seiner französischen Vorbilder, dann sicherlich erstens, weil er zwanglos an den nationalromantischen Spleen der Zeit anknüpfen konnte, zweitens weil er als Bote der neuesten Trends aus Paris eine gewisse Hippness beanspruchte und drittens sein gebildetes Publikum auf diesen Stil weitkettiger grammatischer Bögen und entlegener Konzeptualisierungen durch die Machart der deutschen Danteübertragungen bereits vorbereitet war. Ebenso an Dante geschult und weniger ausgeschlafft von notorischer Rezeption werden einem auch die Verse Theodor Däublers, eines geheimen Inspirators der Expressionisten, entgegentreten. Mag im Ganzen an seinem Hauptwerk dem Nordlicht, einem wie die Fleur du mal sorgsam durchkomponierten und zu Zyklen geordneten Band, manches etwas fine-de-siecle-haft süffig wirken (auch Werles Baudelaire gerät ja manchmal in diese Bereiche) so verbergen sich unter dieser Schicht doch berückend aberwitzige semantische Konzeptualisierungen und seine Zeilen behalten, isoliert Vers für Vers betrachtet, überraschend wenig von dieser Süßlichkeit, sondern wirken auch heute noch erstaunlich frisch, solange man nicht dekretierte, dass ein metrisch geregelter Vers immer altmodisch schon allein wegen eben dieses Umstands wäre.
Ich habe dieses fast antiquarisch anmutende Unterfangen, die Versgrammatik metrisch gebundener Texte zu durchleuchten, hier nur deshalb aufgenommen, weil sich in dieser hohen Schichtung von Regeln besonders gut zeigt, dass Dichtung verstehen und Dichtung schreiben in weiten Teilen darauf basiert, mit welcher Lektüre wir uns welches Hierarchiemodell von erzeugenden Regularitäten zurechtlegen, mit dem wir bewerten, was Erstes und was Hinzutretendes (Schmuck, Versfüllung etc.) ist.
Solche Betrachtungen sind für manchen, etwa für Germanisten aus einer hermeneutischen Tradition, ein Angriff auf die Integrität der Lyrik. Gerade das Gedicht, wenn nicht glückende Literatur überhaupt, zeichne sich dadurch aus, dass ein Organon entstehe, indem alles gleich wichtig und gleich ursprünglich sei.[10] Es wäre gerade das Erkenntnismerkmal des scheiternden Kunstwerkes, wenn das nicht aufginge. Gestützt ist diese Vorstellung von der vagen Idee, dass auch die Sprache ein solcher Gesamtfunktionskörper sei, ein kunstgerechtes Arbeiten also diesen Zusammenhang nur sorgfältig zu erhalten hätte, während das arbiträre Arbeiten von Kleinmeistern, Epigonen oder Experimentatoren diese innere Notwendigkeit zerrisse. Von unserer Position ist so ein Anschein innerer Notwendigkeit ein besonderes Merkmal vieler Kunstrichtungen aber nicht konstitutiv für Kunst überhaupt.
Diese Kunstrichtungen verkörpern lediglich ein bestimmtes Geschmacksideal und dieser Anschein des Gleich-Ursprünglichen, musste mühsam (zu hohem Preis) in einer Sprache arrangiert werden, die mit Wittgenstein gesprochen, eine Ansammlung von mehr oder weniger ineinander greifenden Sprachspielen (Sprachhandlungsmodellen) ist, der zwanglos auch welche hinzugefügt oder weggenommen werden können.
Beim Lesen eines spätstalinistischen Dichters
Die enge Schichtung von Regularitäten, am verslich gebundenen Gedicht besonders sichtbar, stellt den Dichter vor Probleme, gibt ihm aber auch besondere Möglichkeiten, in moralisch und diskursiv verminten Kontexten das eine zu sagen und das andere zu verschweigen. Und Verschweigen erkennt man insbesondere daran, dass unterschiedliche Deutungen sich weitgehend am selben Text rechtfertigen können. Das lässt sich auch an Texten zeigen, deren Regelschichtung weniger klar zu Tage liegt, weil die verwendeten Regeln nicht Bestandteil des (notorisch gleichwohl nicht gekannten) Kanons sind.
Das Gedicht Bei der Lektüre eines sowjetischen Buches wird gern herangezogen, um die (vorsichtig gesprochen) „realsozialistische“ Gesinnung des späten Brecht auch im Gedicht zu belegen.[11]
Verse wie „Die Wolga, lese ich, zu bezwingen / Wird keine leichte Aufgabe sein. Sie wird / Ihre Töchter zu Hilfe rufen, die Oka, Kama, Unsha, Wjetluga / Und ihre Enkelinnen, die Tschussowaja, die Wjatka. / Alle ihre Kräfte wird sie sammeln, mit den Wassern aus siebentausend Nebenflüssen / Wird sie sich zornerfüllt auf den Stalingrader Staudamm stürzen. / Dieses erfinderische Genie, mit dem teuflischen Spürsinn / Des Griechen Odysseus, … // … lese ich, die Sowjetmenschen … // … werden sie / Noch vor dem Jahre 1958 / Bezwingen …“ wurden auch von BrechtspezialistInnen[12] als reifere Geschwister der damals verbreiteten Hauruck-Panegyrik betrachtet. „Die Zahl siebentausend ist ein rhetorischer Kunstgriff: Schon in der Bibel steht sie für ‚unendlich viele‘.[13] Die Antropomorphisierung der Wolga illustriert auch in anschaulicher Weise, daß es sich um einen Kampf zwischen Natur und Mensch handelt.“[14]
Das wäre aber doch seltsam. Wo läge die Dialektik? Zum selben Zyklus gehört überdies der Text Die Musen: „Wenn der Eiserne sie prügelt / Singen die Musen lauter. / Aus gebläuten Augen / Himmeln sie ihn hündisch an.“ Ist es sinnvoll der Dichter habe im selben Zyklus zugleich beide Haltungen eingenommen? Währen sie dann als Probestücke verschiedener Haltungen überhaupt ideologisch ausdeutbar?
Ich lese in diesem Text etwas anderes. Vor allem lese ich zwei Mal: „lese ich“. Sollen das bloß etwa retardierende Einschübe sein? Und warum gerade zweimal dieses Verb? So flektiert gibt es das in den gesamten Buckower Elegien sonst nicht. Es gibt allerdings zwei Titel, die „Beim Lesen …“ beginnen. Warum lautet dieser Titel hier im Gegensatz dazu: „Bei der Lektüre …“, warum nennt Brecht hier die Quelle vager als die anderen? Ich fühle mich besonders gehalten, auf das zu achten, was Brecht hier als seine Lektüre vorstellt. Ist hier nicht geradezu auffällig, dass der Text sich besonders archaischer Mittel bedient? Würde Brecht ohne guten Grund neuen Wein in so alte Schläuche geben? Das ist doch singulär innerhalb dieser Elegien! Möchte er vielleicht genau hier, dass man sich an jenes antikisierenden Heldenpathos erinnert, das ein Dutzend Jahre zuvor in Deutschland gängige Münze war? Denn bei genauer Betrachtung erweist es sich auch in sich als wenig adäquat: Warum antropomorphisiert der Dichter gerade dann, wenn er einen Kampf zwischen Mensch und Natur schildern will, die Natur, führt sie sogar eng mit einer antiken Mythengestalt, lässt sie also gerade nicht als sie selbst auftreten? Verunklart das Verwandtschaftsbild hier nicht gerade das Stück Technik zusätzlich, das vorgeblich abgebildet werden soll? Man würde sich Filiation in Bezug auf Flüsse, (zumindest solange das eine Metapher und keine Allegorie sein soll) doch genau umgekehrt vorstellen müssen, also entweder so, dass damit über Deltabildung geredet würde oder dass die Flüsse als Kinder und deren Zuflüsse als Eltern auftreten etc.? Es ist also dem Realismus sehr schädlich hier die abgeleitete Redewendung herbeizuzitieren, die uns auch vom „Vater Rhein“ sprechen lässt. Sind solche Nachlässigkeiten denkbar bei einem Dichter, der gerade in den Buckower Elegien sich als brillanter Verdichter und Verschlüssler erweist? „Die Fuchsien unter dem Löwenmaul billig und eitel.“ Ist es nicht auffällig, dass gerade da, wo der Text besonders mythisch und ausgeschmückt wird, sehr große Zeilenlängen auftreten? Während Deutungen, wie Bohnerts hier zu dem Argument Zuflucht nehmen könnten, es solle die Fülle des Wassers mit der Überlänge der Zeile veranschaulicht werden, ruft es mir laut zu: „Zu viel“, zumal für den bündigen Stil der Elegien. Diese auffälligen Länge hat ja auch die Zeile, in der das Tun der Sowjetmenschen geschildert wird, ebenso die drittletzte Zeile der Elegie, in der längst nicht mehr von dem Übermaß des Wassers gehandelt wird.
Es ist wohl vielmehr so: Brecht wollte seine Lektüre vorzeigen: Seht, so ist es, die Botschaft hör ich wohl. Und unterschlägt (deutet an) „allein, mir fehlt der Glaube“. Er liefert in seiner Schilderung der Utopie ein Spiel mit ostentativer Ungeschicklichkeit, wie es sich auch bei George in Zeile 7 des Albatros findet. Der Dichter sieht nicht mit eigenen Augen, er liest nur. Durch die relative Sperrigkeit der vom Dichter angebotenen Lektüre, wird auch dem Leser der Umstand, dass der selbst liest vor Augen geführt.
Dies passt zur Einstellung, die Brechts Beim Lesen des Horaz vorführt „ … Einmal verrannen / Die schwarzen Gewässer. Freilich, wie wenige / Dauerten länger!“ ebenso, wie zu Eisen: „Doch was da aus Holz war / Bog sich und blieb“ Es passt besser als die hochherzige Feier des Fortschritts der hier abgewiesenen Deutung zur teils lakonisch scharf düsteren, teils skeptischen, teils eher melancholischen Grundstimmung der restlichen Arbeiten des Zyklus. Es passt zur bekannten Parabel, in der Herr Keuner der falschen Wahrheit zustimmt, um sicherzustellen, dass er sie überdauert. Das passt zu Brechts Aufsatz: „Schwierigkeiten beim Sagen der Wahrheit.“ Dort rät er dem Künstler, der in Zeiten unterdrückter Wahrheit sprechen muss: Wenn eine Wahrheit nicht gesagt werden kann, solle er das, was als Wahrheit fälschlich gilt, so schlecht sagen, dass die eigentliche Wahrheit für diejenigen, die sie angeht, hindurch leuchtet. Zweitens: Er trage besondere Sorge, dass die Wahrheit an den Wächtern der Öffentlichkeit vorbei diejenigen erreicht, die sie angeht.
So mag auch dieses Gedicht eher an die Sensibilität des kundigen Lesers appellieren, wahrzunehmen, wie der Sozialismus zwar noch kaum Brot oder ein Dach über dem Kopf zu bieten hatte, aber große Versprechen, während eine oberflächliche Botschaft die oberflächlichen Gatekeeper einer Öffentlichkeit überwinden half, die ohnehin nicht sensibel genug waren, unendlich viele banale, lächerliche und monströse Texte auszusortieren, so lange sie nur tagespolitisch konform schienen.[15]
Sein eloquent vorgetragener Anspruch, in der Literatur kämpferische Wahrheiten vorzutragen, mag zusammen mit seiner Eignung für die Schule, mit ihren holzschnitthaften Didaxen, besonders dazu beigetragen haben, Brechts Bild in der breiten Öffentlichkeit zu dem eines pädagogisierenden Moralikers und Wegbereiters der parteilich volkstümlich gedachten Programmlyrik der 70er zu verflachen. Gedichtkunst ist bei ihm besonders deutlich (Gegenrhytmische Technik, Verfremdung, Parodie), aber auch sonst immer uneigentliche Sprache. Einer mag mit der Faust auf den Tisch gehauen haben, gesagt haben, „wie es wirklich ist“ (Fried? Brinkmann?). Am Heer der Epigonen sieht man spätestens: Er erfand lediglich eine neue Art von Sprachspielen. Der Ausweg in ein Jenseits der Literatur war noch stets eine Illusion. (Vielleicht eine produktive, aber eine Illusion.)
[1] Ich verzichte hier wie in den Folgekapiteln auf Einrückung der besprochenen Gedichte, da sie sich leicht im Netz auffinden lassen.
[2] Zu solchen Spitzfindigkeiten, nämlich jemanden genau für das Gegenteil dessen zu verteidigen, was sie eigentlich an einem Dichter schätzen, bloß, weil es vom Meister kommt, nehmen ja Apologeten gern Zuflucht.
[3]Eine Umtauschprobe erweist schnell, dass es so leicht anders ginge. Dies legt mir hier Willkür statt Zwang nahe nahe: „Als sie · die herren im azur · geknickt /… /Und an der seite schleifen ungeschickt“
[4] oder das dargebotene Material so geschickt rückbinden, wie es Monika Fahrenbach-Wachendorff tut.
[5] Besonders dann, wenn es sich nicht um ein Hauptwort handelt.
[6] Fortschrittlicher wäre es gewesen, sich durchgehend stärker an mündlicher Sprache zu orientieren, wie mit der doppelten Elision der vierten Zeile „Wenn’s überm bittren Abgrund zieht die Bahn.“ In so schroffem Gegensatz zu dem extrem ins hochsprachliche gerückten Kontext wirken solche Findungen allerdings nicht wie poetisches Programm sondern eher wie Notlösungen.
[7] „Mach es doch selbst erst einmal besser“ Ich habe (wie mancheR) in vergleichbar engen (dem abgegrasten Shakespeare) oder engeren Kontexten (bei der Übersetzung von Villanellen, wo man mit 2 Endreimen 19 Verse zusammenbringt) solche Mittel vermieden. Ich mache jedoch die Erfahrung, dass selbst, wenn man solche mühevollen Herausforderungen annimmt, die Mauer aus Abwehr nicht bröckeln muss. Oft heißt es dann: Du bist ja selbst Partei, Dein Urteil ist genau deswegen, höchstsubjektiv. (Schlimmstenfalls sogar: missgünstig) Es scheint, eine Art tabuisierende Imprägnierung gegen bestimmte Formen von Forderung an die Dichtung zu geben, die aus spontanem Vertrauen hier und freischwebendem Misstrauen dort besteht. Diese Reflexe, die die Frage moderieren, was sich bis zu welchem Punkt rechtfertigen muss, und was sich, im Gegensatz dazu, von selbst versteht, scheinen mir oft bestimmender für die Geschichte der Dichtkunst, als die Entdeckungen neuer dichterischer Techniken und Sageweisen oder die Fortentwicklung des analytischen Bestecks. Denn zuerst verbieten sich in einem solchen Fall diejenigen den Mund, denen eine heikle Sache nicht wichtig genug ist, zweitens diejenigen, die unsicher sind, ob sie argumentativ schlagfertig genug sind. Die übrigen wissen, dass für die Klärung einer solch umstrittenen Frage ein gewisser Aufwand nötig wird, für den nicht in jeder Situation Raum ist. Dadurch wird eine Position umso exotischer, und schon deshalb steigt für diejenigen, die sie vertreten möchten, die Rechtfertigungslast. Ein Teufelskreis in dem Positionen untergehen können, ohne dass je ein valides Argument gegen sie vorlag.
[8] Auch Jürgen Brocan sprach Fauf Fixpoetry von einer „Sternstunde der Translationskunst“. (Er hält im übrigen wie Rainer Moritz größere Aussschnitte aus dessen deutschen Albertros für geeignet, Werles besondere Leistung zu veranschaulichen.) Respekt habe ich nur insoweit, als ich auch allenfalls ahne, was es heißt, als Nachgeborener so vieler interessanter Mittler diese Strecke zu gehen. Vielleicht wäre es sinnvoller gewesen, sich auf die Stücke zu beschränken, zu denen es nicht bereits eine große Menge von Übertragungen mit sehr verschiedenen Geschmäckern und unterschiedlichen Stärken gibt, und diese dann umso sorgfältiger zu übertragen? Freilich wissen wir, dass sich für solche Detailsorge nicht so leicht Öffentlichkeit organisieren lässt, wie für einen kompletten Baudelaire.
[9] Schnell wird man hier so wahrgenommen, als würde man Ansprüche der Form hier gegen Ansprüche des Inhalts ausspielen, aber ist das wahr? Wörtliche Treue ist ebenfalls nur eine Formalie. Formalist bleibt jeder, der Übersetzungen ausschließlich dafür rügt, dass irgendeine Stelle wortsemantisch nicht bietet, was das Original sagt und meint, die Sache wäre damit entschieden. Das ist erst ein halbes Argument: Oft nehmen Überetzungen an einer Stelle etwas weg, um es dem Text an anderer Stelle zurückzuerstatten. Vom Standpunkt des Wort-für-Wort-Klaubers wird aus einer Richtigkeit so schlimmstenfalls gleich ein doppelter Fehler. Überdies müsste von Fall zu Fall schon vorab eine Begründung treten, warum die Übersetzung Schlechteres bietet und nicht anderes ebenso Gutes. Mindestens müsste dargestellt werden, warum diese Abweichung zumindest unauthentisch, hier unbaudelairsch ist. Und das ist viel schwerer zu argumentieren: Oft hat jemand manches genau so geschrieben, weil das Wortmaterial der Ausgangssprache eben dies als glückliche Lösung nahelegt und eine Übersetzung reproduziert ein Ähnliches mit der glücklichsten Lösung im deutschen Wort- und Lautbestand. So erst kritisierte man Dichtung als Dichtung in ihrem je ganz persönlichen Gewebe, so nähme man den Dichter ernst und verkleinerte ihn nicht zum Statementinhaber und Stichwortgeber. Allerdings gewinnt man leicht bei zahlreichen lobenden Texten zu Werles Neuübersetzung das Gefühl, die Rezensenten interessierte mehr die Kulturgeschichte des späten 19. Jahrhunderts als die Dichtung. (Gemessen an dem Raum, den die Schilderung historischer Vorgänge im Vergleich zur Darstellung der Dichtung und ihrer Übersetzung einnimmt).
[10] Eine ältere Dame wollte testen, ob die „jungen Dichter“ sich denn noch in klassischer Lyrik auskennen und sprach mit mir den Erlkönig. Bei der Zeile „Den Erlenkönig mit Kron’ und Schweif?“ geriet sie ins Stocken, ob wir uns das richtig gemerkt hätten, weil ihr die Zeile irgendwie falsch vorkam. Sie hatte richtig bemerkt, dass Goethe hier offenbar etwas nur notdürftiges passend zum „Nebelstreif“ fand,, insofern er den Schweif hier aussehen lassen muss, als wäre er ein notwendiges Attribut für Könige (oder zumindest für Erlkönige), was wenig Sinn ergibt. Dieser Umstand wird etwas dadurch vertuscht, dass das weniger Selbstverständliche vor das Passendere geschaltet wurde. Auch wenn der Notreim so als solcher weniger auffällig ist, ist zu sehen: Selbst in den klassischsten Werken gibt es neben den Dingen, die den Anschein innerer Notwenigkeit erwecken, solche, die eher arbiträr hinzutreten. Man kann diesem Befund stets ausweichen, indem man darauf verweist, dass das inkriminierte Werk nur zufällig populär und kein echtes Beispiel für Klassizität im Sinne des Anspruchs organischer Notwendigkeit sei. Es entwickelte sich ein Hase und Igel Spiel, denn der Vorrat an diskutablen Texten ist enorm. Wie wehrte man sich aber gegen den Hinweis, dass man mit dem Kompliment solcher organischen Folgerichtigkeit schlicht immer jene Texte belegte, die den persönlichen Vorlieben besonders einleuchtend erscheinen?
[11] Neben dem Paradebeispiel dem Stück Die Maßnahme, das eine ganz andere Diskussion herausforderte, die hier unterbleibt.
[12] So schreibt Christiane Bohnert, Verfasserin einer Brecht-Monografie zu den im Gedicht geschilderten Vorgängen „Brecht zieht aus solcher Möglichkeit sinnvollen Tuns Hoffnung, dass die faschistischen Bewußtseinsrückstände überwunden werden können in Deutschland“ Rhetorische Gedichte im Spannungsfeld der Geschichte in Brechtjournal 2 Hg. Jan Knopf, Frankfurt (Main), 1986
[13] Die Zahl 7000 steht in der Bibel gerade nicht für „unendlich viele“, sondern fast immer im Verhältnis zu anderen Zahlen, oder, wie in 1. Könige 19,18, genau dafür, dass es eben gerade nicht unendlich viele, sondern etwelche aus vielen sind: „Und ich will übriglassen siebentausend in Israel: alle Kniee, die sich nicht gebeugt haben vor Baal, und allen Mund, der ihn nicht geküßt hat.“
[14] ebenda
[15] Vielleicht wäre die Brechtphilologie für diesen Aspekt sensibler gewesen, wenn der thematisierte Staudamm nicht bereits 1957, also wider Erwarten planwirtschaftlich fristgerecht fertiggestellt worden wäre. In diesem Falle hätte das Gedicht sein volles Potential erweisen können, insofern es ein unerfülltes Versprechen öffentlich erinnerte.
Ach, der Kunst blauer Dunst
Ludwig Tieck
(* 31. Mai 1773 in Berlin; † 28. April 1853 ebenda)
Thalia's Wehklage in Deutschland Ach! der Kunst Blauer Dunst, Von den Spielern Die sich schwenken, Und den Dichtern Die sich renken, Wie die Gunst Von den Fühlern In den Bänken, Und den Richtern Die da denken, Macht mich schüchtern: Das Allwissen Von Gesichtern Die so nüchtern, Glanz von Lichtern Aus Coulissen, Bengals Feuer, Bunte Wände Ohne Ende, Die so theuer, – Ach! und gar Costum Deutscher Bühnen Ruhm Macht mich völlig dumm. –
Fliegen Adler jemals so?
Hart Crane
(* 21. Juli 1899 in Garrettsville, Ohio; † 27. April 1932 im Golf von Mexiko)
The Sad Indian Sad heart, the gymnast of inertia, does not count Hours, days – and scarcely sun and moon The warp is in the woof – and his keen vision Spells what his tongue has had – and only that How more? – but the lash, lost vantage – and the prison His fathers took for granted ages since – and so he looms Farther than his sun-shadow – farther than wings – Their shadows even – now can’t carry him. He does not know the new hum in the sky And – backwards – is it thus the eagles fly?
Der traurige Indianer Trauriges Herz, Tänzer der Trägheit, achtet nicht Der Stunden, Tage – selten der Sonn’, des Mondes. Der Einschlag sitzt im Blut. Sein scharfer Blick Zählt nurmehr, was der Zunge zustieß – einzig dies. Wie anders? Peitsche nur, verstellte Sicht und Haft Den Vätern von altersher vertraut – so ragt er drohend Weiter als Sonnenschatten, weiter als Flügel Und deren Schatten – die ihn nicht mehr tragen. Er kennt den neuen Laut im Himmel nicht, Und – rückwärts – fliegen Adler jemals so?
Deutsch von Roswith von Freydorf, aus: Die weiten Horizonte. The Vast Norizons. Amerikanische Lyrik 1638 bis 1980. Originale und deutsche Fassung. Nachdichtungen Roswith von Freydorf. Hrsg. Teut Andreas Riese. O.O.: Guido Pressler, 1985, S. 272f
Der Mann mit dem Zirkel
Ștefan Augustin Doinaș
(eigentlich Ștefan Popa, * 26. April 1922, heute vor 100 Jahren, in Cherechiu, Arad, Rumänien, † 25. Mai 2002 in Bukarest)
Der Mann mit dem Zirkel Ich ritzte gestern abend in den Sand der Welt die Formel neuen Fugs, die im Entstehen der Dinge heimliche Gestalt enthält, die unbewegte, ohne ein Vergehen. Hier dieser Ring, in den ich nun versuch zu bannen der bewegten Sterne Meer, ein Feuermal, magischer Kreis und Spruch, sich selber wilde Nahrung und Begehr, und dort als meiner Weisheit Sinngebild ein Strahlenzelt, durchsichtiges Gehänge: das Dreieck, meines Strebens Ziel, mein Schild im Bronzeton der abendlichen Klänge. Nichts schien mir nicht genau hineinzupassen in diese allzu fest erprobten Formen: nicht Lilienkelche seidiges Erblassen, nicht blitzender Kristalle bittre Normen. Sie werden ganz von Klängen vollgesogen, denn das Geschöpf, gleich dem geblasnen Rohr, betastet die Kontur, wenn sie vollzogen, doch Maße dringen kaum bis an sein Ohr. So glaubte ich. Und unter späten Sternen zur Nacht hielt ich den Zirkel nur zur Seite: der Bauherr aller Harmonien und Fernen, der Reiher aller sanft erflognen Weite. Jahrhunderte vergehn in einer Stunde, wenn holder Schlaf mit Lüge im Verein. Kein einziger der auserlesnen Funde des Abends blieb mir unberührt und rein! Mit Höllenschwüle und mit schwarzem Regen ist heut das düstre Morgenrot entbrannt. Der Riesenkräuter Blätterlappen fegen wie Brandungsschäume rauschend an den Strand. Verknorrte Stämme, Knorpel in den Dünen, verschmutzte Fühler edelsten Empfangs, dem als Orakel ich mich wollt erkühnen, durchsichtiges Bild, seh ich im Untergang. O Meer in Krämpfen, zuckend bis zur Tiefe, was wühlst du Höllenfruchtbarkeit empor? Statt daß vom Felsen Salz mich singend riefe, gehn Summer und Reptilien draus hervor. Die Sterne auf der Düne gehn verbogen, zerstört der Elemente ew’ger Brauch, seitdem die tote Maus den Kreis umzogen, den fleckenlosen, mit Kadaverhauch. Die ihr des göttlichen Geäders Weise vergessen habt und windgeprägte Letter, ihr habt jetzt Asche, Kleingehölz zur Speise vom Ameishaufen — ungebundne Blätter. Ihr Flieger auch, in Schwärmen und in Scharen, gebrochen ist, der euch bewußt gewesen, der Flügelschlag, voll Seele und erfahren, durch den der rohe Flug zur Kunst genesen! Weh! Dies Gestirn sinkt immer tiefer ab... Kristalle sind zersprungen und verbluten, und tausend träge Wasser fließen ab und trüben großer Ströme wache Fluten. So steh ich mitten im Verfall der Welt und harre stumm ergeben auf die Stunde, wo Blumen faulen, krötengleich geschwellt, die mir verwischen meines Zirkels Runde. Dann senke ich die Spitze in den Sand. Die gleichen Zeichen blitzen und bestehn. Als Urbild sind in Fug und Form gebannt die Dinge, die in dieser Welt vergehn.
Deutsch von Wolf von Aichelburg, aus: Lyrik aus Rumänien. Hrsg. Eva Behring. Leipzig: Reclam, 1980, S. 202ff.
Über Haltung und Versgrammatik
L&Poe Journal #02 Essay
Essay von Bertram Reinecke (Erste Folge)
Über Haltung und Versgrammatik
Über Haltung und Versgrammatik.
Wer Verse aus unveränderten fremden Versen zusammensetzt, so wie ich das tue, erhält leicht Lob für die artifizielle Höhe seiner Werke. Dies ist jedoch oft ein Ja-aber-Lob und kommt mir eher wie ein vergiftetes Kompliment vor. Etwa wie bis vor wenigen Jahren nach jedem Open Mike die Texte der Preisträger für ihre Kunstfertigkeit gelobt wurden, um sie dann sofort im Ganzen zu verwerfen: Die Jugend habe nichts zu erzählen.
Was mir schon bei Prosa nicht recht einsichtig ist, die Unterstellung, es stünde ein ungestaltes Etwas, das Eigentliche der Kunst, einer schriftstellerischen Technik gegenüber, die wie ein Filter dieses Eigentliche verdünne, wird in Bezug auf ein Sprachkunstwerk, wie es das Gedicht ist, noch schiefer. Zwar beschwören feinsinnige Interpretationen auch immer wieder, dass Form und Inhalt, zumindest im fraglichen, jeweils hochstehenden Werk, eine Einheit bildeten, doch dieser Gedanke bestreitet eher das Selbstverständliche dieser Tatsache, indem er fraglos impliziert, in einem anderen, weniger gelungenen Werk, könnten sie ebensogut auseinandertreten. Natürlich kann man oft sofort sagen: Dieser Text benutzt inadäquate Mittel, ist zu feierlich, zu förmlich oder zu lax etc. Dies alles ist aber eine rein informelle Redeweise. Will man einen solchen Fall genauer beschreiben, kann man ebensogut sagen: Moniert ein Kritiker in dieser Weise etwas als schlecht gesagt, scheint ihm meist eigentlich eher der mitgeteilte Inhalt falsch, widersprüchlich oder dunkel. In der Regel ersetzt er insgeheim das, was gesagt ist, gegen etwas, was man hier so ähnlich hätte vielleicht sagen sollen, und rügt das Auseinandertreten von Form und Inhalt in Bezug auf diese neu erfundene Aussage.[1] Er deutet einen empfundenen Mangel des Inhalts zu einem Mangel der Form. Es gilt heute ja fast als etwas unanständig, Gedichte nach ihrem Aussagegehalt zu bewerten. Deswegen wählt man oft intuitiv diesen Umweg über den Zugriff auf die Form, die dann als eine nicht mehr zeitgemäße, banale, unverbindliche etc. gedacht wird,.
Wie jeder weiß bedeutet das nicht, dass man deshalb gern über Grammatik und Syntax redet. So wie eben angedeutet, bleibt dies meist nur das Scheinthema, Regeln der Sprache, Regeln der Dichtung (es gibt sie, aber sie sind implizit, sobald sie formuliert werden können, fangen sie an fraglich zu werden) sind ein Thema, vor dem man generell zurückschreckt. Allzu schnell setzt man sich unter Verdacht, selbst beschränkt oder unfrei zu sein. Um der Gefahr zu entgehen, dass der eigene Stil sich lediglich als ein Set mehr oder weniger arbiträrer Gewohnheiten erweist, das als Masche verdächtigbar wäre, übt man sich gern in Intransparenz und redet statt über Regularitäten lieber über esoterische Obertöne, die ein feines Ohr erfordern, als über den Stoff und die Fäden, aus denen die Poesie in Wirklichkeit hergestellt sind. Diese müssten hingegen Masche für Masche reproduzierbar, also sehr einfach sein.
Wenn sie jedoch einfach sind, wie wäre denn die oben unterstellte Umdeutung überhaupt möglich: Sähe man, wenn es so wäre, nicht z.B. die klare grammatische Form und wäre sich einig?
„Die Bedeutung eines Wortes ist sein Gebrauch in der Sprache“ sagt einer, das gilt im Großen und Ganzen (des inneren Lexikons sozusagen) aber auch im Kleinen. Besonders interessant wird es da, wo allgemein gängige Worte auf ein Netz von zahlreichen syntaktischen und grammatischen Regeln treffen, die ineinander aber auch mit weiteren Formregeln zusammenarbeiten.
Deswegen kommt es mir nicht nur schief vor, Inhalt und Form zu trennen, sondern ebenso schief, grammatische Regeln getrennt von metrischen, syntaktischen oder topologischen zu diskutieren. Und man verzeihe mir auch, dass ich, bevor ich zu aktuelleren Beispielen aus der eigenen Werkstatt komme, hier zunächst manchem vielleicht etwas bieder erscheinende Klassikerphilologie betreibe. Wenn ich dabei Texte auch teils weitgehend interpretiere wie ein Deutschlehrer, dann natürlich nicht, weil es mir um die Botschaften der Texte besonders zu tun wäre, sondern weil ich zeigen möchte, wie die Bewertung einzelner Formmittel kein Glasperlenspiel ist, sondern unmittelbar durchschlägt auf den Horizont dessen, was wir „verstehen“.
Wünsche haben
„Nur einen Sommer gönnt, ihr Gewaltigen / und einen Herbst zu reifem Gesange mir / daß williger mein Herz vom süßen …“ beginnt Hölderlins An die Parzen. Der deutsche Satzbau, das metrische Schema und ein Set von Inversionsregeln schaffen hier eine Unbestimmtheitsstelle, die sich nicht „nah am Text“ auflösen lässt. Grammatisch ist jedenfalls nicht klar, ob sich der Sprecher des Gedichtes einen Sommer und zusätzlich einen Herbst zum Singen wünscht, oder ob Sommer wie Herbst zwei Dinge sind, die in derselben Hinsicht zu reifem Gesange nötig sind.[2] (sensu composito vs. sensu diviso). Dass hier ein wesentlicher Unterschied liegen kann, macht ein pragmatischeres Beispiel vielleicht klarer: Jemand kann sich ein Haus im Süden und ein schnelles Auto wünschen. Einerseits kann intendiert sein, dass die Wünsche zusammengehören, dass er das Auto beispielsweise zu nutzen wünscht, um sein Haus zu erreichen. Es kann aber auch sein, dass es ihm einerseits um ein Haus dort und andererseits um ein Auto für gelegentliche Spritztouren geht. Jene getrennte Lesart wirkt etwas arbiträr und wird von Lesern des „großen“ Hölderlins gern übergangen, aber es ist eine Frage der Interpretation: Immerhin sind der Sommer und der Herbst durch einen zusätzlichen Einschub („ihr Gewaltigen“) und einen Zeilenbruch getrennt. Selbstverständlich können Hölderlinleser auf Parallelstellen verweisen, so ein Abstand sei eben ein Ergebnis der Verschiebungsprozeduren, mit denen man so eine Odenform einrichtete. Andererseits ließe sich fragen, ob es nicht vielleicht dem Dichter auch zur Ehre gereiche, ihn so zu lesen, dass er stärker von der banalen Not des Einzelnen mitspricht, wie es in diesem zweiten Lesevorschlag stärker angelegt ist. Man kann das vielleicht in der Stroemfeldausgabe nachschlagen, ich tue das nicht, weil es mir hier nicht um Hölderlinphilologie geht, sondern darum, zu zeigen, wie verschiedene jeweils einfache Bildungsregeln sich schichten und die inhaltliche Ausdeutung des Textes stark davon abhängt, in welcher Priorität diese einfachen Bildungsregeln geschichtet sind. Mich rührt der Gedanke, Hölderlin habe sich einfach auch mal eine wunderschöne Zeit in seinem an Zumutung reichen Leben gewünscht.
Noch verzwickter wird es, wenn man die dritte Zeile hinzunimmt. Was macht das Herz williger: Der Herbst allein? Der Sommer und der Herbst gemeinsam? In derselben Hinsicht? Es könnte ja ein nicht mitgesagtes Drittes geben, was erst diesen Zusammenhang herstellt, so kann sich jemand ja das Auto für Spritztouren und das Haus im Süden wünschen, aber doch gemeinsam insofern, dass etwa beide Status repräsentieren? Und dann gibt es noch eine weitere Lesart, die im Gesamtzusammenhang zunächst die schwächste scheint: Das willige Herz könnte auch nur als Folge des Sommers gedacht werden, Herbst und Gesang kämen sozusagen nur on top, weil der topologische Ort bereits betreten ist. So mutet der Text etwas simpel aus der Schulrhetorik gefolgert an, wer mit metrischen Zeilen im Kopf umgeht, kann sich eine solche Entstehungsweise aber gut vorstellen. Da geistert einem vielleicht der Stoßseufzer durch den Kopf „Nur einen Sommer, gönnt ihr Gewaltigen“ und dann findet sich der wirklich schlagende Abgang: „daß williger mein Herz vom süßen“ ( Kann, wer nicht regelmäßig mit dem hochgestimmten Versmaterial vergangener Epochen umgeht, den Fall ins Lakonischere hier noch mitvollziehen?) Grundstimmung und Ton eines Bittgebetes sind sprachlich schon erschlossen, dieser Topos wird nun weiter ausgeführt. Jedenfalls gruppieren sich Zeile eins und drei zueinander, indem das Metrum dieser beiden Zeilen aufgeraut ist. Oder ist es gerade umgekehrt, dass die Sauberkeit[3] der zweiten Zeile ihre Ursprünglichkeit markiert, während sich das andere nachträglich anfügte? Noch einmal: Man kann das vielleicht in der Stroemfeldausgabe nachschlagen, ich tue das nicht, weil es mir hier nicht um Hölderlinphilologie geht, sondern darum, zu zeigen, wie verschiedene jeweils einfache Bildungsregeln sich schichten und die inhaltliche Ausdeutung des Textes stark davon abhängt, in welcher Priorität diese einfachen Bildungsregeln geschichtet sind. Ein feinsinniges ästhetisches Ohr tut hier nichts, es sei denn, man meint damit seine Intuitionen über die Vorfahrtsregeln (im Sinne der optimality theory) im Bereich von Syntax, Grammatik und Metrik.
Wer nicht über deutliche Intuitionen zu Bildungsregeln und deren Schichtung verfügt, sieht besonders metrisch gebundene Texte, so könnte man sagen, nur in Schwarz /Weiß, nach den Umrissen der Wortsemantik und den Grautönen der Standardgrammatik. Diese s/w Sicht haben etwa SchülerInnen, die, zu Recht gelangweilt, im barocken Sonett wieder und wieder die Vergänglichkeitstopik herausarbeiten. Diese Topik ist nicht Inhalt, der gesagt wird, sondern eher Form, in der etwas ausgedrückt wird. Dieses Etwas kann nur der heraus spüren, der die Gewichte der jeweiligen Regeln ahnt: Erfahrungen mit (oder Hypothesen über) Schwierigkeiten ihrer Einhaltung hat. Wo musste etwa ein Alexandriner sorgsam in seinen Gegensatzgewichten gebaut werden, wo war der Tatbestand klein genug oder bekannt genug, dass er zur Anspielung verkleinert werden konnte? Wo nötigt eine Aussagestruktur dem Dichter ab, die Lastwechsel des Alexandriners zu verschleifen? Welche Akkumulation füllt nur einen Zeilenrest aus? Welche rafft vorher eingeführte Motive zu einem Höhepunkt? Erst von hier her lässt sich ganz erschließen, worauf hin der Vers gespannt ist. Ist etwa ein Vergänglichkeitstopos defensiv gedacht? (Vergeblichkeit) oder soll er Mut zusprechen (Auch Deine Widerstände sind ein zeitlich Ding.)? Aussageabsicht wird hier zu einem Etwas, dass nicht biografisch psychologisch gefasst ist, sondern, insofern es anhand der Versgrammatik erschlossen wird, jenseits der Empirie der Zeitläufe (nicht aber ihrer Lesegeschichte) liegt.
[1] Dass etwas des Feierns würdig ist, ist ja ein Inhalt, ein durch Pathos unfreiwillig komischer Text mag dies nicht ausdrücken, jenseits der Autorenintention stellt er aber dennoch ja weiterhin genau diese Aussage in Frage.
[2] Was im Gesamtkontext des Gedichtes als Marginalie erscheinen mag, ist, wie ich selbst erlebt habe, eine Frage, an der sich Germanisten auch heute noch die Köpfe heißreden können.
[3] Wenn man auf „reifem“ den Hauptakzent legt, passt sogar eine kleine Zäsur dazwischen.
Gestern hat er meine Hände geküßt
Jindřich Hořejší
(* 25. April 1886 in Prag; † 30. Mai 1941 ebenda)
Lied Gestern hat er meine Hände geküßt, ihr Mädchen. Meine Finger sind noch von den Küssen erfüllt, als hätte er sie mit schönen Ringen umhüllt; und immer wieder lächelt sie mich an wie eine Gemme aus roter Koralle, die kleine Wunde, die ich vom Tippen habe; als er den Mund darauflegte, ätzte er sie mit seinem lebendigen Herzen. Gestern hat er meine Hände geküßt, ihr Mädchen. Meine Finger haben gezittert, meine Finger waren verwirrt, wer ihnen wohl die süßen Küsse zurückgab, mit denen sie stets die Schreibmaschine liebkosen, ihre tagtägliche Arbeit, um den Hunger von Mutter und Schwestern zu stillen. Mädchen, ihr Mädchen, nehmt Geliebte, die eure Hände küssen, Hände, nicht weiße, gezähmte. Das sind Geliebte mit goldenem Herzen.
Aus dem Tschechischen von Roland Erb, in: Süß ist es zu leben. Tschechische Dichtung von den Anfängen bis 1920. München: Deutsche Verlags-Anstalt, 2006, S. 426
Hersch Glik 100
Vor 100 Jahren, am 24. April 1922, wurde Hersch Glik in Wilna geboren. Jiddisch הִירְש גְלִיק : andere Namensformen Hirsh Glick, Hirsh Glik.
„Geboren 1922 in Wilna als Sohn eines Altstoffhändlers. Jüdische und weltliche Bildung. Arbeit in einer Buchbinderei und einer Papierfabrik. Schrieb zunächst hebräische Gedichte und ging erst unter dem Einfluß der Gruppe Jung-Wilne zum Jiddischen über. 1941 Zwangsarbeit in Torfgruben bei Wilna. Während der Liquidierung des Wilnaer Gettos versuchte er, sich zu den Partisanen in den Wäldern durchzuschlagen. Gestapobaft, Flucht aus einem Lager, 1944 im Kampf gegen die Deutschen gefallen. Sein Partisanenlied wurde zur Hymne des Widerstands.“ (aus „Der Fiedler vom Getto“, s.u.)
Jüdisches Partisanenlied Sage nimmermehr, du gehst den letzten Weg, wenn vor blauen Tag ein Bleigewölk sich legt: unsre heißersehnte Stunde, sie ist nah, unsre Tritte werden trommeln: Wir sind da! Vom grünen Palmenland zum weiten Land im Schnee, so kommen wir mit unsrer Qual, mit unserm Weh, und wo gefallen ist ein Spritzer unsres Bluts, dort wird sprießen unsre Stärke, unser Mut. Einst wird Sonne sein, die unsern Tag bescheint, und das Gestern wird verschwinden mit dem Feind. Steigt zu spät für uns der Sonnenball sei dies Lied für unsre Kinder ein Fanal. Das Lied, geschrieben ists mit Blut und nicht mit Blei und kein Vogel hats gesungen, leicht und frei, s hat ein Volk an rauchgeschwärzter Wand das Lied gesungen mit der Waffe in der Hand. Drum sage nimmermehr, du gehst den letzten Weg, wenn vor blauen Tag ein Bleigewölk sich legt: unsre heißersehnte Stunde, sie ist nah, unsre Tritte werden trommeln: Wir sind da!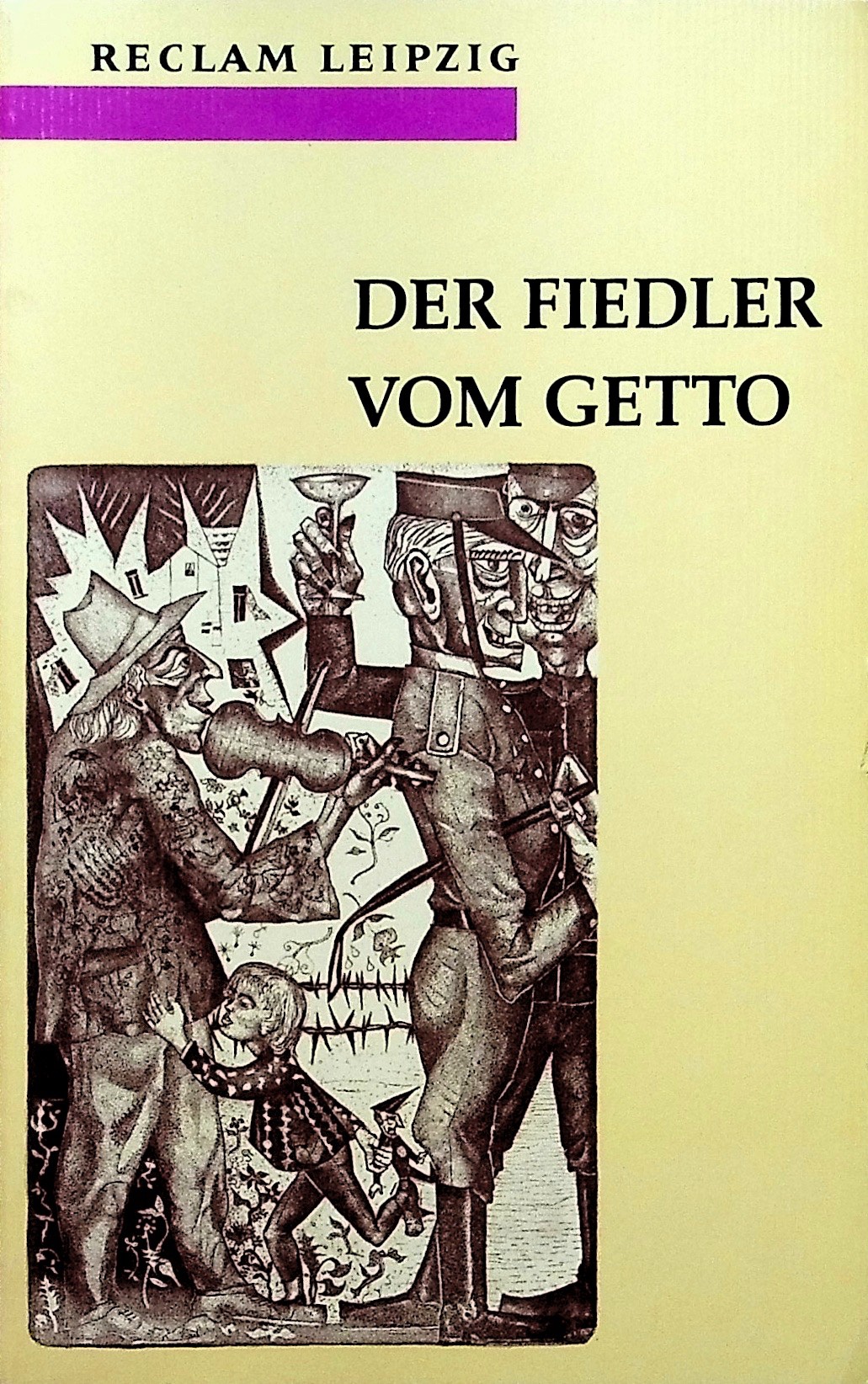
5. Aufl. 1993 / 2. Aufl. 1968
Aus dem Jiddischen von Hubert Witt, aus: Der Fiedler vom Getto. Jiddische Gedichte aus Polen. Ausgewählt und aus dem Jiddischen übertragen von Hubert Witt. 5. Auflage 1993 (1. 1966), S. 256
dos partizanerlid zog nit keyn mol az du geyst dem letstn veg, khotsh himlen blayene farshteln bloye teg. kumen vet nokh undzer oysgebenkte sho - es vet a poyk ton undzer trot: mir zaynen do! fun grinem palmenland biz vaysn land fun shney, mir kumen on mit undzer payn, mit undzer vey, un vu gefaln s'iz a shprits fun undzer blut, shprotsn vet dort undzer gvure, undzer mut. es vet di morgnzun bagildn undz dem haynt, un der nekhtn vet farshvindn mitn faynd. nor oyb farzamen vet di zun un der kayor – vi a parol zol geyn dos lid fun dor tsu dor. dos lid geshribn iz mit blut un nit mit blay, s'iz nit keyn lidl fun a foygl af der fray, dos hot a folk tsvishn falndike vent, dos lid gezungen mit naganes in di hent! to zog nit keyn mol, az du geyst dem letstn veg, khotsh himlen blayene farshteln bloye teg. kumen vet nokh undzer oysgebenkte sho – es vet a poyk ton undzer trot: mir zaynen do!

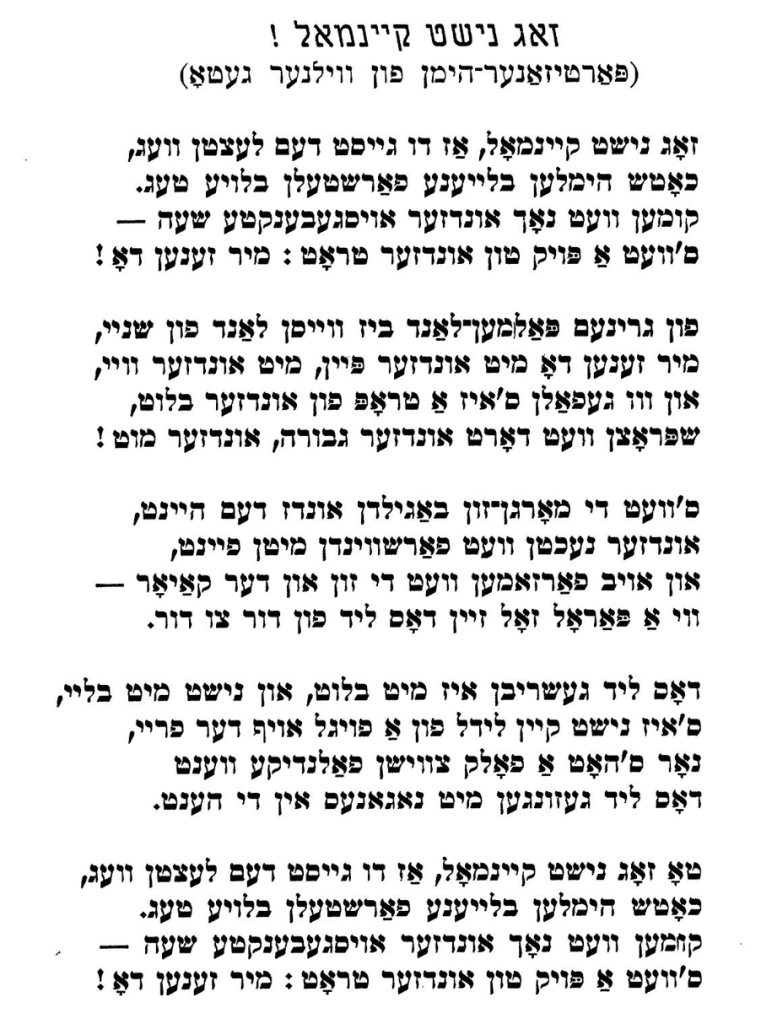
Odessa-Sonett
Und was ist mit Odessa? Was war da? Was ist da? Hier ein Gedicht von Leander Sukov (aus dem Odessa-Band der Städtereihe „Europa erlesen“) – aus dem wir es natürlich auch nicht erfahren, es ist ein Gedicht. Sukov hat in den letzten Jahren unterschiedliche Stellungnahmen zum Geschehen in der Ukraine abgegeben. Er ist im März aus der Partei Die Linke ausgetreten und hat das mit der Haltung der Partei zur russischen Invasion begründet.
Leander Sukov
Odessa-Sonett Sie kondolieren der Ukraine, der Toten in Odessa wegen. Dies’ Jahr, das ist das Jahr der Schweine, die sich an Krieg und Tod erregen. Die Grabesreden halten jene, aus deren Reih’n die Mörder stammen. Die braucht man für die großen Pläne, braucht ihre Taten, braucht die Flammen. Entfacht, das nationale Feuer. Entfacht, der nationale Hass. Der Haß gebiert die Ungeheuer. Und Ungeheuer fordern Fraß. Es kondolier’n mit falschen Mienen, die Schweine, die am Krieg verdienen.
Aus: Europa erlesen. Odessa. Hrsg. Dareg A. Zabarah. Klagenfurt: Wieser, 2017, S. 266.
Der Göttliche
Heute vor 530 Jahren geboren: Pietro Aretino, genannt „der Göttliche“, aber o weh: „ein Dichter voll Talent, aber ohne alle sittliche Würde“ (Herders Conversations-Lexikon 1854), „durch sittenlose Schriften berüchtigt“ (Brockhaus 1911). Einige der „sittenlosen“ Sonette kann man in dem von Tobias Roth herausgegebenen Band „Welt der Renaissance“ (Ausgewählt, übersetzt & erläutert von Tobias Roth. Berlin: Galiani, 2020, 2. Aufl. 2021) nachlesen. Hier ein kirchenkritisches Gedicht im italienischen Original und einer Prosaübersetzung. (Den Originaltext findet man im Internet an verschiedenen Stellen als „anonyme Schmähung“, aber in Hartmut Köhlers Anthologie „Poesie der Welt. Italien“ steht er unter Aretinos Namen).
Non ti maravigliar, Roma, se tanto s'indugia a far del papa la elezione, perché fra' cardinai Pier con ragione non trova chi sie degno del suo manto. La cagion è che sempre ha moglie accanto questo, e quel volentier tocca il garzone, l'altro a mensa dispùta d'un boccone e quel di inghiottir pesche si dà il vanto. Uno è falsario, l'altro è adulatore, e questo è ladro e pieno di eresia, e chi di Giuda è assai più traditore. Chi è di Spagna e chi di Francia spia e chi ben mille volte a tutte l'ore Dio venderebbe per far simonia. Sicché truovisi via di far un buon pastor fuor di conclavi, che di san Pietro riscuota le chiavi e questi uomini pravi, che la Chiesa di Dio stiman sì poco, al ciel per cortesia sbalzi col fuoco.
Wundere dich nicht, Rom, wenn man so lange zögert, die Wahl des Papstes vorzunehmen, denn unter den Kardinäleti findet Petrus mit Recht keinen, der seines Mantels würdig wäre.
Der Grund ist, daß dieser ständig ein Weib zur Seite hat, jener gerne den Knaben berührt, der andere bei Tisch um einen Bissen streitet und jener sich rühmt, Pfirsiche zu verschlingen.
Einer ist Fälscher, der andere Schmeichler, und dieser ist ein Gauner und voll Ketzerei, und mancher ist noch viel mehr Verräter als Judas.
Mancher ist ein Spion Spaniens und mancher Frankreichs, und mancher würde wohl tausendmal zu jeder Stunde Gott verkaufen, um Simonie zu treiben.
So möge sich ein Weg finden, einen guten Hirten außerhalb der Konklaven zu machen, der die Schlüssel des Hl. Petrus einholt und diese verdorbenen Leute, die die Kirche Gottes so gering achten, freundlicherweise mit Feuer bis zum Himmel schießt.
Aus:
Hartmut Köhler ( Hrsg.), Poesie der Welt: Italien. Edition Stichnote im Propyläen Verlag, 1985, S. 106f.
Die Auswahl der italienischen Lyrik aus acht Jahrhunderten und ihrer Übertragung traf Hartmut Köhler. Er besorgte die Prosa-Auflösungen und schrieb das Nachwort „Die italienische Lyrik und ihre deutschen Übersetzer“.
Mehr über Aretino im Lyrikwiki.
wissenschaft des schreibens
Heute vor 75 Jahren wurde Norbert C. Kaser geboren. Er wurde nur 31 Jahre alt.
Norbert C. Kaser
(* 19. April 1947 in Brixen, Südtirol; † 21. August 1978 in Bruneck)
wissenschaft des schreibens weißt du maridl die ungeborenen gedichte sind immer die besten die die man selber geboren und verdaut hat die
Aus: norbert c. kaser, Gedichte. Hrsg. Sigurd Paul Scheichl. (Gesammelte Werke Band 1). Innsbruck: Haymon, 1991 (2. Aufl.), S. 198
Froher Morgen
Georg Maurer
Geboren 11. März 1907 in Reghin (Sächsisch Regen), Siebenbürgen, Königreich Ungarn; † 4. August 1971 in Potsdam
Froher Morgen Streckt euch, Zweige, erwacht! Ich habe ein Ei gegessen und weißes Brot. Mein ganzer Leib lacht. Die Nachtsorgen sind tot. Ich bin aus den Nachtsorgen gekrochen wie ein Vogel aus dem Ei. Ich habe die Schale durchbrochen und spaziere jetzt frei. Ich weiß jetzt, was die Hühner wissen, wenn sie picken. Ich weiß, wen die Raben grüßen, wenn sie mit dem Kopfe nicken.
Aus: Georg Maurer, Werke in zwei Bänden. Band 1. Hrsg. Walfried Hartinger, Christel Hartinger und Eva Maurer. Halle-Leipzig: Mitteldeutscher Verlag, 1987, S. 254


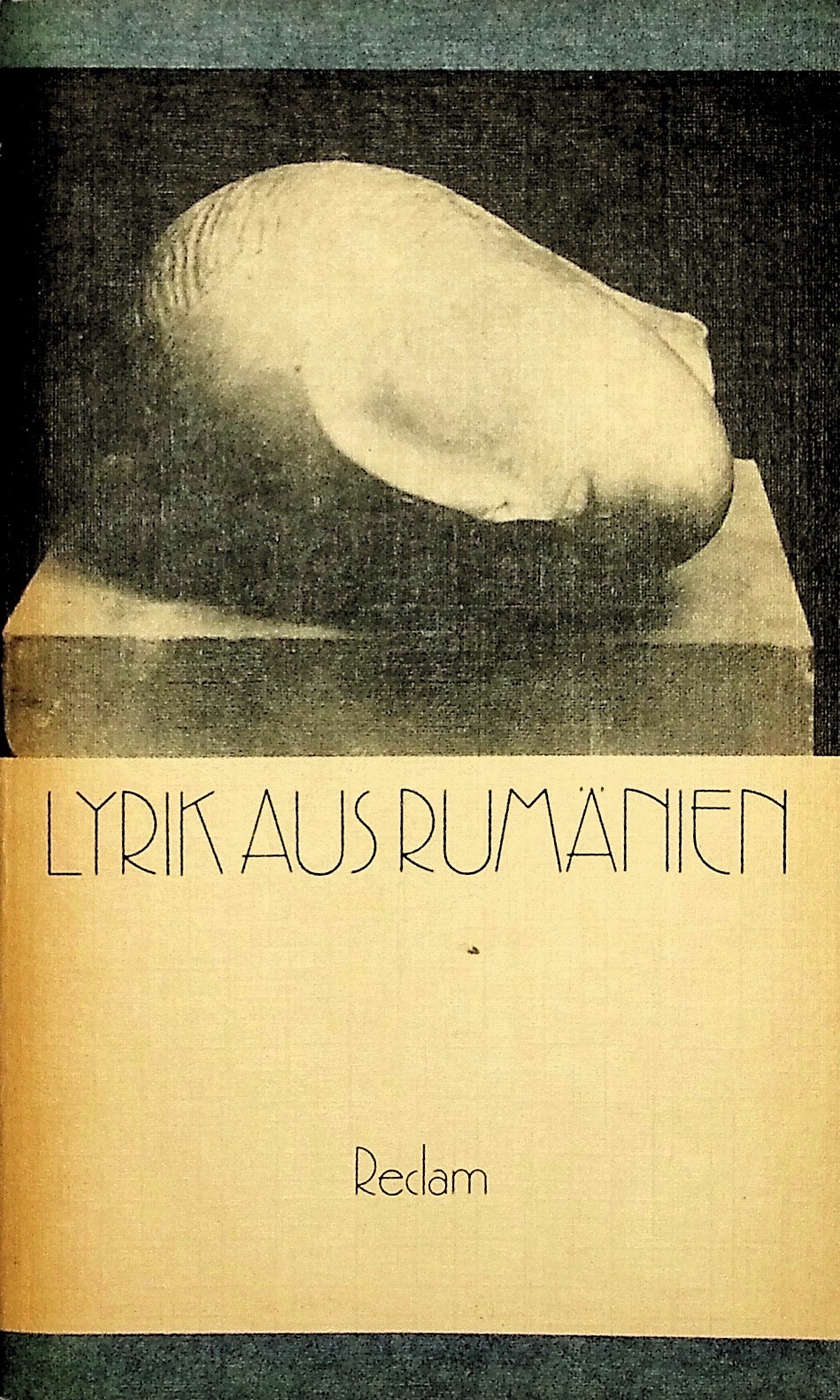
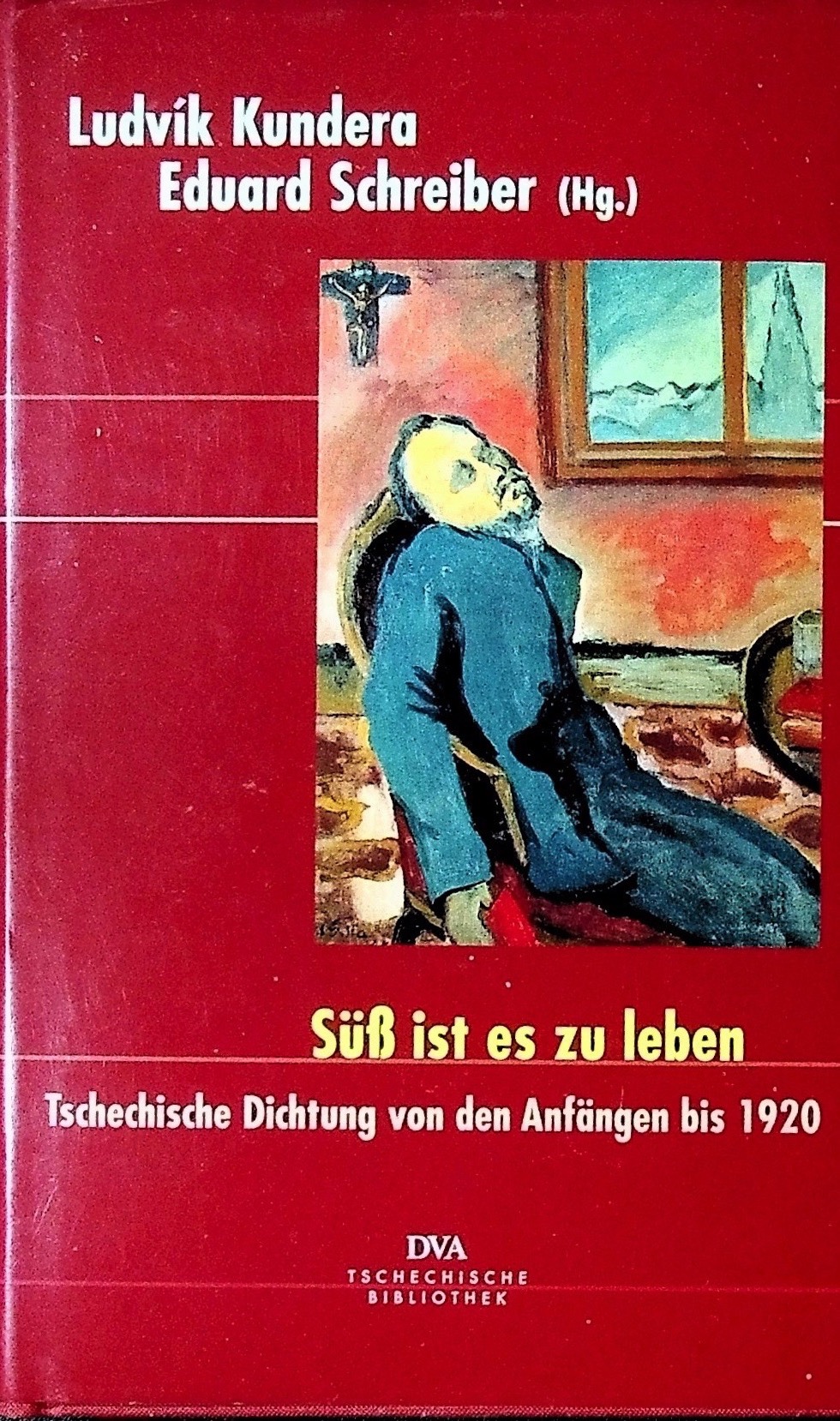




Neueste Kommentare