Lyrikzeitung & Poetry News
Das Archiv der Lyriknachrichten | Seit 2001 | News that stays news
MeeresRose
Heute was mit Blumen. Vielleicht nicht Rosen – Seerosen. Sea Rose heißt das erste Gedicht aus dem ersten Gedichtband der amerikanischen Autorin H. D. (eigentlich Hilda Doolittle). Das Buch erschien 1916 und trägt den Titel Sea Garden, Meeresgarten. 95 bzw. 100 Jahre danach erschien es auf Deutsch. 2011 übersetzt von Annette Kühn bei Luxbooks und 2016 als roughbook in der Übersetzung von Günter Plessow.
Zu ihrem 131. Geburstag das Gedicht Sea Rose im Original und die ersten zwei Strophen in den Übersetzungen von Kühn und Plessow. Von der ersten Zeile an macht das Gedicht deutlich, daß keine Blümchenpoesie zu erwarten ist. H.D. gehörte mit Ezra Pound und Richard Aldington zur Avantgarde der englischsprachigen Lyrik, die drei nannten sich die „drei Original-Imagisten“, original imagists.
Sea Rose
By H. D.
Rose, harsh rose,
marred and with stint of petals,
meagre flower, thin,
sparse of leaf,
more precious
than a wet rose
single on a stem—
you are caught in the drift.
Stunted, with small leaf,
you are flung on the sand,
you are lifted
in the crisp sand
that drives in the wind.
Can the spice-rose
drip such acrid fragrance
hardened in a leaf?
Annette Kühn
MeeresRose
Rose, rauhe Rose
gebrochen und geizig an Blüten,
spärliche Blume, dünn,
karg an Blättern,
kostbarer
als eine nasse Rose
einzeln auf einem Stengel —
bist du gefangen in der Strömung.
(…)
Günter Plessow
See Rose
Rose, harsche Rose,
entstellt und karg in der Blüte,
magre Blume, dürr,
blattlos fast,
kostbarer
als eine betaute Rose
einzeln am Stengel—
du bist erfaßt von der Drift.
(…)
- MeeresGarten (Sea Garden). Gedichte. Übersetzt von Annette Kühn. Zweisprachig. luxbooks, Wiesbaden 2011, ISBN 978-3-939557-27-2
- Sea Garden, aus dem amerikanischen Englisch übersetzt u. hrsg. v. Günther Plessow. Berlin, Badenweiler, Schupfart: roughbook, 2016 (roughbook 038)
Septembermorgen
Eduard Mörike (8. September 1804 Ludwigsburg – 4. Juni 1875 Stuttgart)
Septembermorgen
Im Nebel ruhet noch die Welt,
Noch träumen Wald und Wiesen:
Bald siehst du, wenn der Schleier fällt,
Den blauen Himmel unverstellt,
Herbstkräftig die gedämpfte Welt
In warmem Golde fließen.
Ein Lied von der Erbsünde
Text von Lazarus Spengler (1524), vertont u.a. durch Johann Sebastian Bach und Dietrich Buxtehude. Lazarus Spengler (* 13. März 1479 in Nürnberg; † 7. September 1534 ebenda) war ein früher Förderer der Reformation in Nürnberg und wurde 1520 zusammen mit Luther mit päpstlichem Bann belegt.
Durch Adams Fall ist ganz verderbt
Menschlich Natur und Wesen,
Dasselb Gift ist auf uns ererbt,
Daß wir nicht mocht’n genesen
Ohn‘ Gottes Trost, der uns erlost
Hat von dem großen Schaden,
Darein die Schlang Eva bezwang,
Gotts Zorn auf sich zu laden.
Weil denn die Schlang Eva hat bracht,
Daß sie ist abgefallen
Von Gottes Wort, welchs sie veracht,
Dadurch sie in uns allen
Bracht hat den Tod, so war je Not,
Daß uns auch Gott sollt geben
Sein lieben Sohn, der Gnaden Thron,
In dem wir möchten leben.
Wie uns nun hat ein fremde Schuld
In Adam all verhöhnet,
Also hat uns ein fremde Huld
In Christo all versöhnet;
Und wie mir all durch Adams Fall
Sind ewigs Tods gestorben,
Also hat Gott durch Christi Tod
Verneut, was war verdorben.
So er uns denn sein Sohn geschenkt,
Da wir sein Feind noch waren,
Der für uns ist ans Kreuz gehenkt,
Getöt, gen Himmel g’fahren,
Dadurch wir sein von Tod und Pein
Erlöst, so wir vertrauen
In diesen Hort, des Vaters Wort,
Wem wollt vor Sterben grauen?
Er ist der Weg, das Licht, die Pfort,
Die Wahrheit und das Leben,
Des Vaters Rat und ewigs Wort,
Den er uns hat gegeben
Zu einem Schutz, daß wir mit Trutz
An ihn fest sollen glauben,
Darum uns bald kein Macht noch G’walt
Aus seiner Hand wird rauben.
Der Mensch ist gottlos und verflucht,
Sein Heil ist auch noch ferne,
Der Trost bei einem Menschen sucht
Und nicht bei Gott dem Herren;
Denn wer ihm will ein ander Ziel
Ohn‘ diesen Tröster stecken,
Den mag gar bald des Teufels G’walt
Mit seiner List erschrecken.
Wer hofft in Gott und dem vertraut,
Wird nimmermehr zu Schanden;
Denn wer auf diesen Felsen baut,
Ob ihm gleich geht zuhanden
Wie Unfalls hie, hab ich doch nie
Den Menschen sehen fallen,
Der sich verloßt auf Gottes Trost,
Er hilft sein Gläub’gen allen.
Ich bitt o Herr, aus Herzensgrund,
Du wollst nicht von mir nehmen
Dein heilges Wort aus meinem Mund,
So wird mich nicht beschämen
Mein Sünd und Schuld, denn in dein Huld,
Setz ich all mein Vertrauen;
Wer sich nur fest darauf verläßt,
Der wird den Tod nicht schauen.
Mein Füßen ist dein heilges Wort
Ein brennende Laterne,
Ein Licht, das mir den Weg weist fort;
So dieser Morgensterne
In uns aufgeht, so bald versteht
Der Mensch die hohen Gaben,
Die Gottes Geist den g’wiß verheißt,
Die Hoffnung darein haben.
Krampf im Geisterkampf
Ende der Geschichte. Im 21. Jahrhundert diskutiert man über Gedichte, als könnte oder dürfte man nicht zwischen objektiver und subjektiver, manieristischer oder Kasuallyrik, galanter und empfindsamer, klassischer Erlebnis- oder Gedankenlyrik, artistischer, symbolistischer, engagierter oder Nonsenselyrik, rhetorischer oder Ausdruckslyrik unterscheiden und Dinggedicht, Aleatorik, Konstellation, konkrete, visuelle oder Gebrauchslyrik wären alles eins und mit einem Maß zu messen. Das Maß scheint Gesinnung zu sein: ist es für uns oder gegen uns? Wort ist Wort und muß Rechenschaft ablegen. Es gab schon eine Zeit in meinem Leben, wo es sich ähnlich verhielt, unter marxistischer Ägide. Unterscheiden galt da als bürgerlicher „Objektivismus“ („Krampf im Klassenkampf“). –
Bitte nicht mißverstehen, ich meine NICHT den AStA von Hellersdorf. Ich weiß nicht, welcher Fachrichtung die engagierten Studenten dieser Hochschule angehören. Wer nicht vom Fach ist, muß überhaupt nichts und darf alles. Meine Überlegungen kommen von der wilden und öfter hitzigen Debatte, die sich in den letzten Tagen unter meinen Facebookfreunden entspann, pro und contra Gomringer. Es sind alles Leute vom Fach, Dichter, Vermittler, die nach meinen altmodischen Vorstellungen aus dem vorigen Jahrtausend a) unterschiedliche Meinungen haben dürfen und müssen und b) gelernt haben, Kriterien anzuwenden und auszutauschen. Aus, vorbei, von vorgestern. Unterscheiden ist nur Krampf im Geisterkampf. Was nicht paßt, wird entfernt. Ich bitte mich zu entfernen.
Zum Nachlesen über den Anlaß:
Offener Brief: Stellungnahme zum Gedicht Eugen Gomringers vom 12.4. 2016
Gedicht: Umgestaltung Südfassade Aufruf vom 15.7. 2017
PEN-Zentrum Deutschland für Erhalt des Gedichts „Avenidas“ des Lyrikers Eugen Gomringer an Südfassade der Alice-Salomon-Hochschule, Berlin vom 5.9. 2017
Sagt, sagt es ihr für mich
Ein Sonett des französischen Dichters Pierre de Ronsard (* 6. September 1524 im Château de la Possonnière bei Couture-sur-Loire; † 27. Dezember 1585 im Priorat Saint-Cosme bei La Riche, Touraine) in der Nachdichtung von Martin Opitz und im Original.
Sonnet. (...)
Welches zum theil von dem Ronsardt entlehnet ist:
Ihr / Himmel / lufft vnnd wind, jhr hügel voll von schatten /
Ihr hainen / jhr gepüsch' / vnd du / du edler Wein /
Ihr frischen brunnen / jhr / so reich am wasser sein /
Ihr wüsten die jhr stets mußt an der Sonnen braten /
Ihr durch den weissen taw bereifften schönen saaten /
Ihr hölen voller moß / jhr auffgeritzten stein' /
Ihr felder welche ziehrt der zarten blumen schein /
Ihr felsen wo die reim' am besten mir gerhaten /
Weil ich ja Flavien / das ich noch nie thun können /
Muß geben guete nacht / und gleichwol mundt vnnd sinnen
Sich fürchten allezeit / und weichen hinter sich /
So bitt' ich Himmel / Lufft / Wind / Hügel / hainen / Wälder /
Wein / brunnen / wüsteney / saat' / hölen / steine / felder /
Vnd felsen sagt es jhr / sagt / sagt es jhr vor mich.
Ciel, air et vents, plains et monts découverts, Tertres vineux et forêts verdoyantes, Rivages torts et sources ondoyantes, Taillis rasés et vous bocages verts, Antres moussus à demi-front ouverts, Prés, boutons, fleurs et herbes roussoyantes, Vallons bossus et plages blondoyantes, Et vous rochers, les hôtes de mes vers, Puis qu'au partir, rongé de soin et d'ire, A ce bel oeil Adieu je n'ai su dire, Qui près et loin me détient en émoi, Je vous supplie, Ciel, air, vents, monts et plaines, Taillis, forêts, rivages et fontaines, Antres, prés, fleurs, dites-le-lui pour moi.
Ein Briefgedicht von Caspar David Friedrich
Caspar David Friedrich (5. September 1774 Greifswald – 7. Mai 1840 Dresden)
Aus Caspar David Friedrichs Nachlaß. Mitgeteilt von Friedrich Aubert.
(…)
Einfachheit, Einheitlichkeit — so ist Friedrichs Kunst, so ist Friedrichs Persönlichkeit, so ist auch sein Leben.
Es ist mit ihm so wie mit Millet und mit Constable: hat man seine Kunst erst liebgewonnen, will man gern ihn selbst persönlich kennen lernen. Daher wird vielleicht ein Stück Lebensbild, das ich hier aus seinen hinterlassenen Papieren mitteilen kann — ein Tag aus seinem schlichten Leben — schon vielen willkommen sein. Es ist ein Brief in Versen, etwa in der Art von Runges Briefe aus seiner Seelandsreise, nur unbeholfener, von einem viel naiveren und einfach gebildeten Menschen. Aber hat man Friedrich lieb, hat es gerade so seinen eigentümlichen Reiz. Jedenfalls hat es, wo es einem so bedeutenden, bahnbrechenden Künstler gilt, seinen kulturgeschichtlichen Wert als document humain. Es findet sich in zwei Redaktionen, doch in keiner als fertige Reinschrift. Dem Papier nach zu urteilen, noch besser nach den naiv unbeholfenen Randzeichnungen, die sich da finden, muss es einer sehr frühen Zeit angehören, kurz nach seiner Ansiedelung in Dresden 1798. Wohl schon vor 1805, da wir ihn den Sommer über in Loschwitz ansässig finden. Wir treffen vielleicht das Richtige, wenn wir das Gedicht um das Jahr 1800 datieren.
Ein Brief in Versen.
Es war die fünfte Stunde früh,
So meldete des Kirchturms Klocke,
Und matt erhellte der junge Tag
Durchs kleine Fenster meine Kammer.
Da lüftete ich das deckende Bett,
Vom weichen Lager mich hebend,
Lobpreisend den Herrn, der Ruh mir verlieh,
Beschirmt vor allen Gefahren.
Kühl war der Morgen, doch deckte ich rasch
Den Leib mit reinem wollenen Zeug.
Dann wurde gewaschen der Mund,
Gewaschen das Antlitz, die Hände.
Denn die Reinlichkeit behagt gar wohl,
Erhält gesund und warm den Körper.
Da fiel mirs ein, nach Tarant zu gehen,
Den kleinen, niedlichen Städtchen.
Drei Stunden nur liegt’s von Dresden entfernt
Im schönen anmuthigen Thale
Von Bergen umschlossen, mit Buchen bekränzt
Die strebende Höhe derselben.
Gleich säuberte ich die Stiefel mir,
Zog anders mich an vom Haupt bis zu Füssen,
Versehen mit Bleistift und Papier,
Des Gummi-Elastikums nicht vergessend.
Doch wartete ich noch aufs dienende Mädchen,
Die bringen würde die warme Milch, die Semmel.
Sie kam diesmal wie gewünscht sehr früh,
Und brachte das Begehrte.
Ich schlürfte behaglich aus Meissner Tasse
Die warme Milch hinunter,
Ass dann das braun geback’ne Brot,
Sechs Pfennige war es im Werte.
Indes das Mädchen das Bett gemacht,
Zur kommenden Nacht bereitet,
Die Kammer gekehrt, wie gewohnt,
Sie weiss, ich hab’s gern reinlich,
Schnell eilte ich die Strassen durch,
Auf grüne Fluhr zu kommen,
Wo freier die Luft uns reiner umgiebt,
Und fröhlich der Mensch sich fühlet.
Es perlte der Tauh in duftender Saat,
Vom Sonnenglanz erleuchtet,
Es trillerte die Lerche ihr Morgenlied,
In hoher Luft sich erhebend.
Es rauschte die wilde Weisseritz,
Kühl flüsterten durch Erlen die Winde.
Aus nahem Dorfe, Plauen genannt,
War hörbar schon des Wasserfalls Getöse.
Gleich hinter dem Dorfe erheben sich
Die Felsen zur Rechten und Linken,
Mit Bäumen und Büschen mancherlei Art
Und schwellendem Moose bewachsen.
Schön ist’s vor quaderner Brücke zu stehen,
Umgeben ringsum von Felsen,
Wo durch der Brücke Bogen man sieht
Die weisse Buschmühle liegen.
Das tosende Wasser stürzt schäumend sich
An rauer Granitwand hinunter.
Man höret sein eigenes Wort kaum noch,
Auch nicht der Mühle Geklapper.
Und weiter ging ich im Grunde fort,
Bewundernd die schöne Umgebung
Von Felsen und Bäumen, von Gärten und Wiesen,
Mich freute die Klarheit des Spiegels im Wasser,
Das Läuten der Kühe, die weidenden Schafe,
Die hüpfende Ziege im Grase,
Das Krachen der schwerbeladenen Wagen,
Das Wiehern der muthigen Hengste.
Gott Grüss euch, nickten freundlich mir zu
die Männer, Weiber und Mädchen.
Schön Dank, erwidert ich, rOckte den Hut
Und lachte hin zu den Mädchen.
Die grosse Hälfte des Weges
War bereits zurück schon gelegt,
Da setzt ich mich hin, zu zeichnen
Den Windberg, den höchsten der Gegend.
Es rollte ein Wagen vorbei
Voll geputzter Herren und Damen,
Recht fröhlich schienen sie alle,
Laut schäckernd rief einer mir zu:
Nehmen Sie uns doch mit ab!
Nehmen Sie mich lieber mit auf!
Erwidert ich schnell und geschwinde
Rasch rollte der Wagen vorbei.
Drauf gieng es weiter im Grunde fort,
Die Felsen wurden höher und schöner,
Es krachten die Tannen auf luftiger Höhe,
Im Thale lispelten die Birken.
Hoch über der Berge Gipfel schwebte
Die Weihe in stolzen Zügen,
Auf blumiger Wiese an kühlender Quelle
Erthönten der Nachtigall Lieder.
Ich hörte halb — es war auf elf —
Die Klocke im Thurme schon schlagen,
Drauf sah ich auch bald die alte Burg
Am felsigen Abhange liegen,
Die Kirche nachher, den spitzigen Thurm
Mit blinkendem Kreuze und Fahne,
Sehr fest gebauet, auf felsigem Grund,
Wohl deutend auf die Religion so sie lehrt.
Ich kam ins Städtchen, doch weilte ich nicht,
Gieng gleich hinauf zur Ruine,
Der schmale Fusspfad den Felsen hinan
Führt mich an der Kirche vorüber.
Ich trat ins offene Gotteshaus
Voll Rührung und Andacht im Herzen,
Blieb vor des Altars Stufen stehn
Zum Gebet die Hände gefaltet
Nun ging ich weiter der Burg zu,
Die stolz in Trümmern noch pranget
Mit Pfeiler und Bogen und hohem Gemäuer
In grauer Zeit noch erbauet — —
Schön ist von dieser Höh zu schauen
Des Schöpfers Werke umher.
Das Thal in drei Arme teilet sich
Nach Norden, Osten und Westen.
Die waldigen Höhen, die schroffen Felsen,
Die fruchtbaren Äcker und Wiesen,
Und unten das Städtchen, sehr reinlich und nett,
Wer kann die Schönheit beschreiben?
Im Innern der Ruine war einfach und edel
Ein kleiner Altar errichtet,
Der Dankbarkeit war er geweiht,
Wie seine Inschrift lehret.
Wenn Wanderer du die Pracht der Auen
Von hier mit Freuden schauest,
So zoll auch hier dein Dankgefühl
Dem Schöpfer der Natur.
Spend‘ was dir ward, wenn wenig nur
Den Armen, deinen Brüdern,
Und preise Gott, der diese Freude
Dir heute hat verliehen.
Ich zollte, auch wenn wenig nur,
Mit frohem Herzen ihm,
Sah dann umher noch einmal hin
In Gottes schöne Werke.
Und dacht an Dich, Du guter Heinrich,*
An Dich, Du lieber Preef, **
Und wünschte still im Herzen noch einmal
Diese Freud mit Euch, ihr guten, zu geniessen.
Nun ging ich links das Feld hinab,
Die Klocke hat zwölf geschlagen,
Zum Gasthof, der braune Hirsch genannt,
Der Mahlzeit mich erfreuend.
Wollt Ihr auch wissen, was ich ass
So will ich ’s auch erzählen:
Erst Supp, dann Rindfleisch mit Kohl,
Kottlet und Brot und Bier.
Ich trat nunmehr den Rückweg an,
Damit ich ’s kurz erzähle,
Und nahe an der Königsmühle,
Die vorher nicht erwähnet,
Hört ich der Hörner muntern Ton,
Das Echo von den Felsen,
Drei Männer waren ’s, die sich zur Freud
Und vielen andern bliesen.
Vier Mahler traf ich auch noch an
Und grüsste sie und brachte dem einen
Viele Grüsse von seinem Freund aus Rom
Er hat an mich geschrieben.
Die Stadt hatt‘ ich bereits erreicht,
Durcheilte schnell die Gassen
Nach Crämers hin, mich hungerte,
Das Abendbrod zu essen.
Es schlug halb zehn, wie ich wieder
Zu Hause mich verfügte
Ins Bett mich legt und ruhig schlief.
Ob ich geschnarcht? Das weiss ich nicht.
Ihr wollt’s wohl auch nicht wissen ?
- Einer der Brüder Caspar Friedrichs in Greifswald.
** Kaufmann Prafke [eigtl. Praefke], entfernter Verwandter.
Aus: Kunst und Künstler; illustrierte Monatsschrift für bildende Kunst und Kunstgewerbe Jg. IV, Heft VII, April 1906, S. 298-303
Von Hamann über Bobrowski zu Meister und zurück
- Johann Georg Hamann (27. August 1730 Königsberg – 21. Juni 1788 Münster)
- Ernst Meister (3. September 1911 Haspe – 15. Juni 1979 Hagen)
- Johannes Bobrowski (9. April 1917 Tilsit – 2. September 1965 Berlin)
Ernst Meister, Zwei Gedichte aus „Wandloser Raum“
Über dem ersten der zwei aufeinanderfolgenden, überschriftslosen Gedichte steht:
(In den beiden folgenden Gedichten wird aus Bobrowskis »Epilog auf
Hamann« zitiert.)
Zum Leben
verhält sich
Leben, nichts
außerdem. Das
Andere
ist »dort, wo man
nichts
nichts
nichts gedenkt«,
auf ewig.
(S. 65)
Der Erde Eigenes
sind die Früchte,
und die Luft ist es
in den Höhlen.
Honig aß ich,
»taumelnd vom Geruch
meiner eigenen
Verwesung«.
(S. 66)
Aus: Ernst Meister, Wandloser Raum. Gedichte. Darmstadt u. Neuwied: Luchterhand, 1979, S. 65f
Johannes Bobrowski
EPILOG AUF HAMANN
Taumeln hat mich gemacht der Geruch meiner eignen Verwesung,
ohnmächtig für eine Zeit, dem Esrahiten hab ich
nachgegirrt von der Schwachheit der Elenden, ich hab gelebt im
Land, das ich nenne nicht: dort, wo man nichts nichts nichts gedenkt.
Aus: Literarisches Klima. Ganz neue Xenien, doppelte Ausführung. In: Johannes Bobrowski: Gesammelte Werke in sechs Bänden. 1. Bd.: Die Gedichte. Berlin: Union, 1987, S. 232
Bobrowskis Epigramm wurde am 10.9.1965 in der „Zeit“ erstmals gedruckt. Meister las es dort und zitiert es in den zwei Gedichten.
Bobrowski seinerseits zitiert aus Hamanns Schriften und aus der Bibel (aus der Hamann natürlich auch zitiert). Er besaß den Band Hamann’s Schriften. 8 Bände in 9 Teilen. Hrsg. von Friedrich Roth. Berlin Reimer, 1821–1843.
Bd. 2: Sokratische Denkwürdigkeiten, Wolken, Aesthetica in nuce, Kreuzzüge des Philologen, Essais à la Mosaique, Schriftsteller und Kunstrichter, Hirtenbriefe (1821)
Darin heißt es S. 416: »Das Gleichniß wäre richtiger, wenn Sie [J.G. Lindner]
gesagt hätten: >Lazarus, unser Freund, schläft<. Der Geruch meiner eigenen Verwesung hat mich eine Zeitlang ohnmächtig gemacht. Ich habe mit Heman, dem Esrahiten, >von der Schwachheit der Elenden< girren müssen; ich habe gelebt, wie im Lande, >da man nichts gedenkt<«
Heman der Esrahit kommt in Psalm 88 vor. Die weiteren biografischen Anspielungen und Bibelstellen lasse ich hier aus. Für einen ersten Lesegang mag es genügen, den versammelten Textbeziehungen zu folgen.
Die Gedichte dieses Mannes
Ernst Jandl
urteil
die gedichte dieses mannes sind unbrauchbar.
zunächst
rieb ich eines in meine glatze.
vergeblich. es förderte nicht meinen haarwuchs.
daraufhin
betupfte ich mit einem meine pickel. diese
erreichten binnen zwei tagen die größe mittlerer kartoffeln.
die ärzte staunten.
daraufhin
schlug ich zwei in die pfanne.
etwas mißtrauisch, aß ich nicht selber.
daran starb mein hund.
daraufhin
benützte ich eines als schutzmittel.
dafür zahlte ich die abtreibung.
daraufhin
klemmte ich eines ins auge
und betrat einen besseren klub.
der portier
stellte mir ein bein, daß ich hinschlug.
daraufhin
fällte ich obiges urteil.
Aus: Dingfest (1973)
Gelernt
Eigentlich wollte ich heute Bobrowski posten, Todestag 1965. Aber mir ist grad nach Inge Müller. Ein kurzes Stück, den kurzen Titel laß ich mal weg. Ach was, heute nur die erste Strophe.
Inge Müller (13. März 1925 Berlin – 1. Juni 1966 Berlin)
Gelernt hab ich
Was hab ich gelernt
Was nicht paßt wird entfernt
Was entfernt wird paßt.
Ich bitte mich zu entfernen.
Der Ritt
August Stramm (29. Juli 1874 Münster – 1. September 1915 gefallen bei Horodec östlich Kobryn, heute Weißrussland)
Der Ritt
Die Äste greifen nach meinen Augen
Im Einglas wirbelt weiß und lila schwarz und gelb
Blutroter Dunst betastet zach die Sehnen
Kriecht schleimend hoch und krampft in die Gelenke!
Vom Wege vor mir reißt der Himmel Stücke!
Ein Kindschrei gellt!
Die Erde tobt, zerstampft in Flüche sich
Mich und mein Tier
Mein Tier und mich
Tier mich!
Pariser Landschaft
Heute vor 150 Jahren, am 31. August 1867, starb der Dichter Charles Baudelaire in Paris. Hier ein Gedicht in der Übersetzung von Stefan George und Walter Benjamin, unten das Original. Es sind Gedichte von George und Benjamin nach Motiven von Baudelaire. Zum Vergleich und zur Warnung setze ich für die erste Zeile und für die fünfte und sechste von unten die Prosaübersetzung von Friedhelm Kemp voran:
Je veux, pour composer chastement mes églogues,
G: Ich will um keusch meine verse zu pflegen
B: Ich will um meinen Strophenbau zu läutern
K: Ich will, um meine Hirtenlieder keusch zu schreiben
L’Emeute, tempêtant vainement à ma vitre,
Ne fera pas lever mon front de mon pupitre;
G:Machtlos die Scheiben bestürmendes toben
Lenkt mein geneigtes haupt nicht nach oben,
B: Mag gegen’s Fensterglas sich ein Orkan verschwenden
Ich werde nicht die Stirn von meinem Pulte wenden;
K: Vergeblich wird der Aufruhr an meine Scheiben tosen:
Ich hebe nicht die Stirn von meinem Pult.
Besonders auffällig vielleicht, daß beide Nach-Dichter den Aufstand (emeute heißt Aufruhr, Aufstand, Erhebung, Tumult) aus dem Gedicht tilgen und durch Bilder vom Wetter (Benjamins Orkan) oder allgemeine Umwelteinwirkungen (Georges die Scheiben bestürmendes Toben) ersetzen. – Das Gedicht hieß zuerst Pariser Landschaft. Baudelaire war beobachtender Zeitgenosse der Aufstände und Empörungen in Paris und schreibt sie in sein Gedicht hinein. Seine Umdichter tilgen die Spuren.
Stefan George
LANDSCHAFT
Ich will um keusch meine verse zu pflegen
Wie Sterngucker nah an den himmel mich legen •
Will hören neben dem glockenturm
Die feierklänge getragen vom sturm.
Hoch in der kammer das kinn auf dem arme
Seh ich die Werkstatt mit lärmendem schwarme •
Den rauchfang den turm und die wolken weit •
Die mahnenden bilder der ewigkeit.
Süss ist es • bricht durch die nebel ein Schimmer •
Droben ein stern und die lampe im zimmer •
Rauchende säule zum himmel schiesst •
Frühling seh ich und sommer verschwinden
Und kommt der winter mit eis und winden
Schliess ich die thüren und laden zugleich •
Baue im dunkel mein feeenreich.
Träumen werd ich von bläulichen dünsten
Gärten und weinenden Wasserkünsten
Küssen und blumen bei nacht und bei licht
Unschuldig wie ein schäfergedicht.
Machtlos die Scheiben bestürmendes toben
Lenkt mein geneigtes haupt nicht nach oben,
Tief versunken in Schwärmerei
Ruf ich nach willen den frühling herbei •
Zieh aus der brust eine sonne und spinne
Laue luft mit dem glühenden sinne.
Walter Benjamin
LANDSCHAFT
Ich will um meinen Strophenbau zu läutern
Dicht unterm Himmel ruhn gleich Sternedeutern
Daß meine Türme ans verträumte Ohr
Mit dem Winde mir senden den Glockenchor.
Dann werd ich vom Sims meiner luftigen Kammer
Überm Werkvolk wie’s schwätzet und singet beim Hammer
Auf Turm und Schlot, die Masten von Paris
Und die Himmel hinaussehn, mein Traumparadies.
Wie schön ist das Erglühn aus Nebelschwaden
Des Sterns im späten Blau, des Lichts in den Fassaden
Der Kohlenströme Flössen übers Firmament
Und wie das Land im Mondlicht fahl entbrennt.
Mir wird der Lenz der Sommer und das Spätjahr hier sich zeigen
Doch vor dem weissen winterlichen Reigen
Zieh ich den Vorhang zu und schließe den Verschlag
Und baue in der Nacht an meinem Feenhag.
Dann werden blaue Horizonte sich erschließen
Und weinend im Boskett Fontänen überfließen
Dann wird in Küssen und im Vogellied
Der Geist der Kindheit sein der durch Idyllen zieht.
Mag gegen’s Fensterglas sich ein Orkan verschwenden
Ich werde nicht die Stirn von meinem Pulte wenden;
Denn höchst gebannt in meine Leidenschaft
Ruf ich den Lenz herauf aus eigner Kraft
Und kann mein Herz zu Strahlen werden sehen
Und meines Denkens Glut zu lindem Wehen.
PAYSAGE
Je veux, pour composer chastement mes églogues,
Coucher auprès du ciel, comme les astrologues,
Et, voisin des clochers, écouter en rêvant
Leurs hymnes solennels emportés par le vent.
Les deux mains au menton, du haut de ma mansarde,
Je verrai l’atelier qui chante et qui bavarde;
Les tuyaux, les clochers, ces mâts de la cité,
Et les grands ciels qui font rêver d’éternité.
Il est doux, à travers les brames, de voir naître
L’étoil dans l’azur, la lampe à la fenêtre,
Les fleuves de charbon monter au firmament
Et la lune verser son pâle enchantement.
Je verrai les printemps, les étés, les automnes,
Et quand viendra l’hiver aux neiges monotones,
Je fermerai partout portières et volets
Pour bâtir dans la nuit mes féeriques palais.
Alors je rêverai des horizons bleuâtres,
Des jardins, des jets d’eau pleurant dans les albâtres,
Des baisers, des oiseaux chantant soir et matin,
Et tout ce que l’Idylle a de plus enfantin.
L’Emeute, tempêtant vainement à ma vitre,
Ne fera pas lever mon front de mon pupitre;
Car je serai plongé dans cette volupté
D’évoquer le Printemps avec ma volonté,
De tirer un soleil de mon coeur, et de faire
De mes pensers brûlants une tiède atmosphère.
Nacht im August
Heute ein Augustgedicht des katalanischen Lyrikers Màrius Torres, ausgewählt und übersetzt von Àxel Sanjosé
Màrius Torres
NIT D’AGOST Ara, la nit s’acosta tant, al fons del meu cor, que el seu somriure sembla una resposta —una resposta que digués: Estem d’acord—. Però la ment ignora a què em respon així... —Oh, calla, dolça nit enganyadora; no és cert que ara de tot em diries que sí?—
Nacht im August Jetzt kommt die Nacht meinem Herzensgrund so nah, dass ihr Lächeln eine Antwort scheint – eine Antwort die etwa lautet: Abgemacht –. Aber der Kopf weiß nicht, worauf sie Antwort gibt … – Ach schweig, süße Nacht, so trügerisch; du würdest doch jetzt zu allem ja sagen, nicht? –
Màrius Torres (30.8.1910–29.12.1942) war ein katalanischer Lyriker.
Er stammte aus einer bürgerlichen Familie in der Bezirkshauptstadt Lleida; der Vater war Abgeordneter im katalanischen Parlament. Nach seinem Schulabschluss studierte Torres Medizin in Barcelona. Er interessierte sich schon früh für Literatur und schrieb in der Schul- und Studienzeit erste Stücke.
1935 erkrankte er an Tuberkulose und kam in das Puigdolena bei Sant Quirze de Safaja (Provinz Barcelona), das er bis zu seinem Tod nicht mehr verlassen sollte. Hier vertiefte er seine Beschäftigung mit Literatur und schrieb den größten Teil seines poetischen Œuvres. Er lernte Mercè Figueres kennen, eine Mitpatientin, der er die Gedichtfolge „Cançons a Mahalta“ widmete, die zu seinen berühmtesten Werken gehören. Über sie begegnete er dem Schriftsteller Joan Sales, zu dem eine enge Freundschaft entstand; Sales besorgte posthum die erste (und lange Zeit einzige) Ausgabe seiner Gedichte.
Màrius Torres wird als Postsymbolist bezeichnet, was meiner Ansicht nach, jenseits des Etikettierungszwangs, recht treffend ist. Er ist kein Treiber der Moderne, sondern ein eher kontemplativer Betrachter des Werdens und Vergehens, der seine eigene Vergänglichkeit deutlich spürte und thematisierte. Zugleich setzte er mit seiner Lyrik einen Kontrapunkt zur trostlosen, schäbigen Wirklichkeit der Bürgerkriegszeit und des beginnenden Franquismus. Ende der 1960er Jahre wurde Màrius Torres von einer breiteren Leserschaft im katalanischsprachigen Raum entdeckt.
Übungen in Bescheidung

Vor Gericht
Johann Wolfgang Goethe
Kein Opfer, keine elende, bemitleidenswerte Existenz, sondern eine selbstbewußte junge Frau, das ist selten auch in der Literatur des Sturm und Drang. Dieses Gedicht wagte Goethe erst 1815 zu veröffentlichen, versteckt in einer Werkausgabe zwischen zwei scherzhaften erotischen Gedichten.
VOR GERICHT
Von wem ich es habe, das sag‘ ich euch nicht,
Das Kind in meinem Leib. –
Pfui, speyt ihr aus: die Hure da! –
Bin doch ein ehrlich Weib.
Mit wem ich mich traute, das sag‘ ich euch nicht,
Mein Schatz ist lieb und gut,
Trägt er eine goldene Kett‘ am Hals,
Trägt er einen strohernen Hut.
Soll Spott und Hohn getragen seyn,
Trag‘ ich allein den Hohn.
Ich kenn‘ ihn wohl, er kennt mich wohl,
Und Gott weiß auch davon.
Herr Pfarrer und Herr Amtmann ihr,
Ich bitte, laßt mich in Ruh!
Es ist mein Kind, es bleibt mein Kind,
Ihr gebt mir ja nichts dazu.
Bemerkenswert die Wendung „mit wem ich mich traute“. Üblicherweise kann man sich nicht selber trauen (aktiv), sondern man wird getraut, vom Pfarrer oder einer Amtsperson (passiv). Hier wird die Selbstermächtigung der jungen Frau in Sprache gesetzt.
Johann Wolfgang Goethe wurde am 28. August 1749 in Frankfurt/Main geboren.
Erstausgabe: Goethe, Johann Wolfgang von: Werke : [in 20 Bänden]. 1, Lieder. Gesellige Lieder. [u.a.] Stuttgart [u.a.] : Cotta, 1815

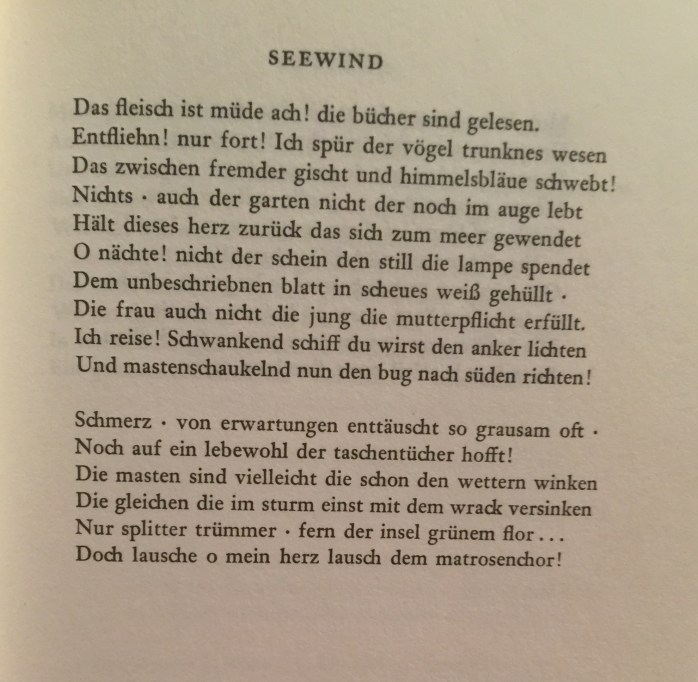
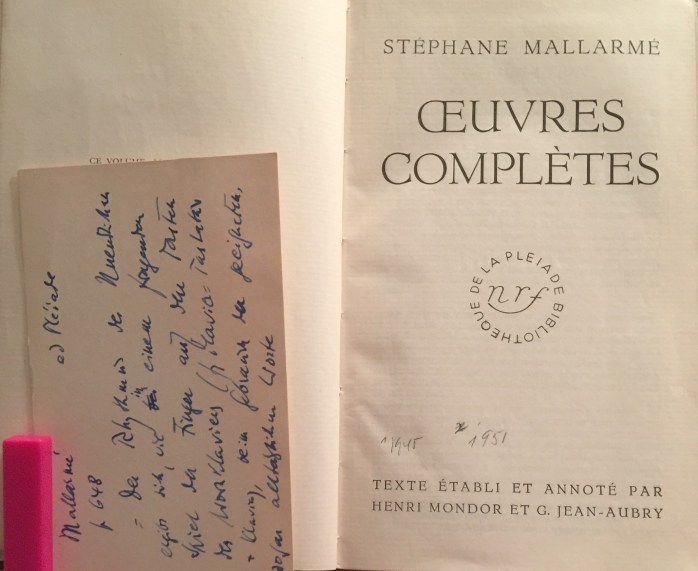
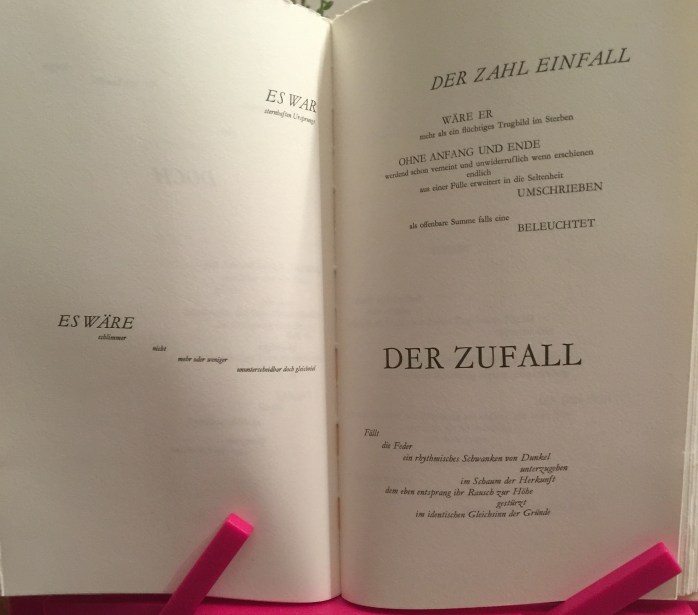
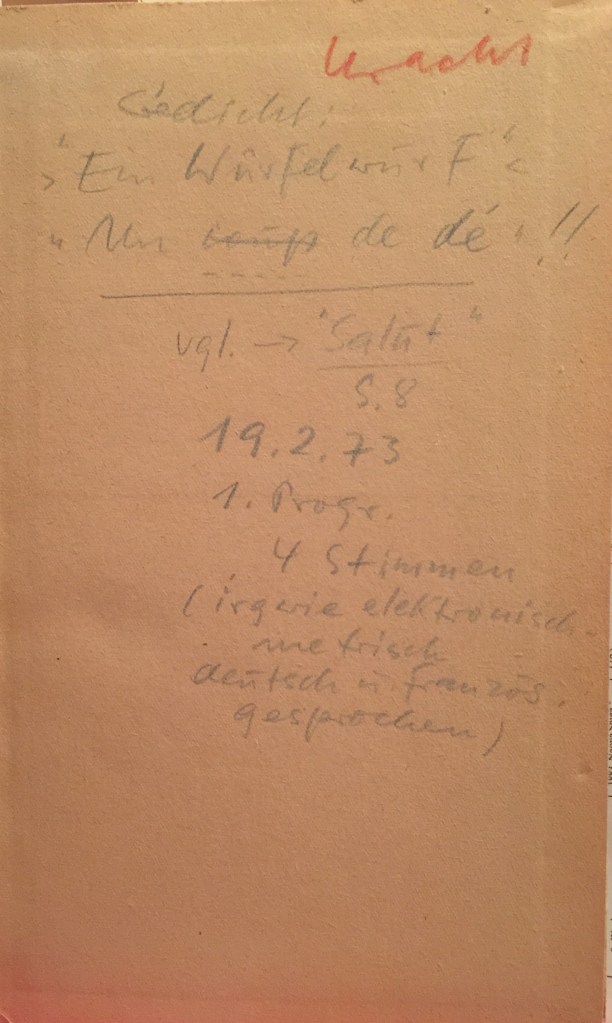






Neueste Kommentare