Lyrikzeitung & Poetry News
Das Archiv der Lyriknachrichten | Seit 2001 | News that stays news
Demut
Max Herrmann
(* 23. Mai 1886 in Neiße, Schlesien; † 8. April 1941 in London)
Ich muß die Demut ganz zu Ende denken
Ich muß die Demut ganz zu Ende denken
Und in Bereitschaft sein zu jeder Scham.
Nichts darf die Langmut der Legende schenken
Dem Prahler, der mit Band und Feder kam.
Doch Band und Feder war gewiß gestohlen
Der bängsten Armut als ihr letztes Gut;
So schritt er als Tyrann und riß mit hohlen
Verheißungen in ihr verblühtes Blut.
So sah ihn meine Schüchternheit im Glase
Und wandte sich wie von dem Widerpart:
Du tiefster Gegner, der mich dennoch trieb.
‚
Daß ich mit selbstentstürmender Ekstase
Und gegen meine eignen Lieder hart
Mich übertraf und bis zum Selbstmord blieb.
Aus: Die Dichtung. Hrsg. von Wolf Przygode. Erste Folge/Zweites Buch Roland-Verlag München 1918, S. 25
Kalt
Martin Gumpert
(* 13. November 1897 in Berlin; † 18. April 1955 in New York)
Kalt
Im Mondwasser schwimmen
Auf bleicher Schneefläche
Die Höhlen erregen
Den Glanz aufküssen —
Schärfe wälzt sich
Zwischen die Lippen
Schwarz des Himmels
Kahle Zeugung
Loht das Licht
Der eisigen Städte.
Zwischen Händen
Irrer Führung
In die nackten
Wälder laufen
Wo die Stämme
Sich anheulen
Hingeworfen
Gellend Schlag
Fluchen vergangenem
Rufen kommenden Tag!
Aus: Die Dichtung. Hrsg. von Wolf Przygode. Erste Folge. Roland-Verlag München 1918/19, S. 71
Abendliche Vision
Hellmuth Pattenhausen
(* 5. September 1896 Dresden, † 6. Februar 1979 Wien)
Abendliche Vision
Leere die wandelt lange im Tag
Schwere Gestalten sinken nach Westen hin in den Abend
Aber die Nacht brennt feurig auf
Und die Stimmen der Sterne durchwittern das glühende Blau
Ach und die Träume traben in hurtigen Zügen
Rot umhaucht an den Stirnen der toten Helden vorbei
Die vom Sonnengrund aufschaun
In die ewige Glut ihrer Zukunft
Sie sitzen in reiner Versammlung
Hockend am Rande der Nacht
Sie sitzen wie Blinde aufgereckt in der Wüste
Und spielen mit Sonnen
Wie jene mit glühendem Sand
Und tragen tief in der Brust der ewigen Rätsel
Seltenen Anhauch
Und sehen die Abende an
Das Spiegelbild ihrer Seelen.
Aus: Schrei in die Welt. Expressionismus in Dresden. Hrsg. Peter Ludewig. Berlin: Der Morgen, 1988, S. 32
Sumpf
Artur Kraft
(* 21.9.1897 Dornești † 1944 vermutlich Auschwitz)
Der dumpfe Sumpf
Den Nebel hat die Stadt aus sich geboren;
Die Menschen hauchten ihn aus ihren Lungen
Und täglich tanzt er auf von ihren Zungen.
Sie haben stündlich ihn aus sich verloren.
Ach! hier lebt alles; hat sein klein Genügen
Und keiner, keiner will sich höher schwingen.
Wie soll ich diesen dumpfen Sumpf durchdringen?
Ich stürze mich verzweifelt ins Vergnügen …
Auch dies wird hier verteilt in matten Mengen?
Oh, alles greint zum Hohn ein halbes Leben!
Enttäuschung fühl ich fahl im Blute beben,
Dieweil die stärkern Wünsche mich versengen.
Aus: Michael Markl (Hg.): „In Dornbüschen hat Zeit sich schwer verfangen“. Expressionismus in den deutschsprachigen Literaturen Rumäniens. Eine Anthologie. Regensburg: Pustet, 2015, S. 20
Frühfahrt im Schnellzuge
Alfred Margul-Sperber
(geboren 23. September 1898 in Storozynetz, Österreich-Ungarn; gestorben 3. Januar 1967 in Bukarest)
Frühfahrt im Schnellzuge
Ringsum nur kreisende, brausende Fläche,
pfeilschnell entstürzen im Fluge uns Bäche,
bleigrauer Himmel, vom Morgen zerfressen,
lastet auf Städten mit Häusern und Essen …
Wenn sich zwei Züge jetzt kreuzen müssen,
sind es zwei Bestien, fauchen verbissen.
Höher und tiefer steigen die Drähte,
endloser Landschaft unendliche Nähte.
Aber ich, brausend ergossen in Weiten,
fühl jede Schwere des Seins jäh vergleiten,
fern blaut der Berg schon mit Höhen und Schlünden,
rasendes Leben, in dich will ich münden!
Aus: Michael Markl (Hg.): „In Dornbüschen hat Zeit sich schwer verfangen“. Expressionismus in den deutschsprachigen Literaturen Rumäniens. Eine Anthologie. Regensburg: Pustet, 2015, S. 23
Der Wald
PAUL ZECH
DER WALD
Reißt mir die Zunge aus: so habe ich noch Hände,
zu loben dieses inselhafte Sein.
Es wird ganz Ich und geht in mich hinein,
als wüchsen ihm aus meiner Stirn die Wände,
wo klar die Berge zu den Wolken steigen.
Ich will mit dem gerafften Licht
ins Blaue malen das noch nie geschriebene Gedicht
und es in alle Himmel klar verzweigen.
Denn hier ist Eingang zu dem Grenzenlosen;
hier ward die Welt zum zweiten Male Kind
aus den gezognen weißen und den schwarzen Losen.
Tritt ein, der du verwandert bist und blind!
Wenn einst in Träumen laut war hohes Rufen
um Gott –: Die Bäume sind zu ihm die Stufen.
Aus: Menschheitsdämmerung. Symphonie jüngster Dichtung. Hrsg. Kurt Pinthus. Berlin: Rowohlt, 1920, S. 111
Chimäre Chimäre
Christoph Meckel
(* 12. Juni 1935 in Berlin; † 29. Januar 2020 in Freiburg im Breisgau)
WIDMUNG AN FRANCISCO GOYA
Chimäre Chimäre
alternd
im Gebüsch hinter den Palästen
sitzt sie, raunzt, flickt Stöckelschuhe, laust
ihr sprechendes Äffchen
krault ihren weißen Kater,
ihr blindes Kind jagt mit dem Stecken
kreischend
einen lahmen Esel durch die Höfe.
Meine Schwestern reiten auf schwarzen Hähnen
singt sie
der große Wegewanderer nachts
trägt den Chimärenfürst zu den Dienerinnen,
sein Schritt versengt die Teppiche, sein Hauch
erstickt die Pferde in den Ställen des Königs.
Fünf große Fürsten hab ich mir heute verwandelt
singt sie,
fünf weiße Kater hab ich mir gemacht
im Gebüsch hinter den Palästen
viel Knöchlein für euch, meine süßen Papageien.
Singt sie. Ein Wind
wirbelt Lumpen und Goldstücke rings
durch die Höfe des Königs,
streichelt dein Ochsgesicht, mein Kind,
du sollst einen König zum Spielen haben
wenn du die Eselshaut bringst, mein Kind
ins Gebüsch hinter die Paläste.
Singt sie. Es kichert
das Äffchen im Dunkeln, stürzend
saugt der Mond sein Licht ein, fliegt verfinstert
tiefer über die Königsgärten,
ihm folgen, bebellt
von den Doggen des Königs
wilde Papageien durch den Morgen.
Chimäre Chimäre —
dein Esel ist tot
du bekommst einen König zum Spielen, mein Kind,
singt sie, Ohrgehänge
klirrt im Dunkeln, Schellen, Scherengeklapper
Schreie Schreie!
Lautlos tollen, kämpfend,
Katzen und Papageien durch die Höfe.
Chimäre Chimäre
Ohrgehänge klirrt im Dunkeln;
in der Frühe
sammeln die Diener des Königs
Knochen und blutige Pelze in silberne Eimer.
CHRISTOPH MECKEL 1960
Aus: Johannes Bobrowski: Meine liebsten Gedichte. Eine Auswahl deutscher Lyrik von Martin Luther bis Christoph Meckel. Hrsg. Eberhard Haufe. Berlin: Union, 1985, S. 370f
Spießer-Expressionismus
Man spricht vom „expressionistischen Jahrzehnt“, bequemerweise meist von 1910 bis 1920 (was 11 Jahre sind). Aber wie alle solche Schubläden ist der Begriff zu eng (Sind die in den 20er Jahren „Nachgeborenen“ wie Georg Kulka oder Erich Arendt wirklich nur Epigonen?) und zu weit. Dass der Expressionismus tot sei, hörte man schon wenige Jahre nach dem ersten Aufkommen des Wortes (ich spreche von Expressionismus in der Literatur, nicht von bildender Kunst, Tanz oder Film…). 1919 ist da schon sehr spät, aber selbstverständlich schossen die Dadaisten (von denen einige kurz vorher selber Expressionisten, andere kurz danach oder zugleich Surrealisten waren) gegen die humorlose, spießige, bürgerliche Kunstübung der Expressionisten. Hier der Berliner Dadaist Raoul Hausmann mit einem Pamphlet von 1919 („Die absolute Unfähigkeit, etwas zu sagen, ein Ding zu fassen, mit ihm zu spielen — dies ist der Expressionismus…“) und einer Karte an Tristan Tzara in Paris.
Raoul Hausmann
(* 12. Juli 1886 in Wien; † 1. Februar 1971 in Limoges)

Vorortballade
René Schickele
(* 4. August 1883 in Oberehnheim im Elsass; † 31. Januar 1940 in Vence, Alpes-Maritimes)
Vorortballade
Um seine Villa beneidet der eine den andern, um das Leuchten des Wannsees,
um seine Terrasse mit geflochtenen Stühlen, um das Segelboot „Ramses“.
Um seinen Hühnerhof auch und den schattigen Garten,
wo er in vielen Nächten verdammt war zu warten,
bis eine Dame kam mit hellem Haar und dem Schlüssel zum Auslug.
Ihr Haar fiel, und sie lachte leis, bis die erste Lerche im Tau schlug.
Nun aber möchte er Starkästen bauen, mit kleinen Hunden spielen,
dem Wetter vertrauen und im Schatten nach glitzernden Möwen zielen,
das Boot „Ramses“ besteigen, in Himmel und Wolken baden!
Vor allem wünschte er sehr, seine Freunde zum Essen zu laden.
Wogegen der andre mit Schnaken kämpfte im schattigen Garten,
verdammt, in vielen Nächten zu stehn und lange zu warten,
bis eine Dame käme, mit hellem Haar und dem Schlüssel zum Auslug.
Ihr Haar fiel, und sie lachte leis, bis die erste Lerche im Tau schlug.
(1910)
Aus: Vom jüngsten Tag. Ein Almanach neuer Dichtung. Leipzig: Kurt Wolff, 1916, S. 64f
Ehmals und jezt
Ich taste mich an das Hölderlinjahr heran. Eine Kurzode aus dem Jahr 1798.
Friedrich Hölderlin
(1770-1843)
Ehmals und jezt. In jüngern Tagen war ich des Morgens froh, Des Abends weint’ ich; jezt, da ich älter bin, Beginn ich zweifelnd meinen Tag, doch Heilig und heiter ist mir sein Ende.
Aus: Friedrich Hölderlin: Sämtliche Werke, Briefe und Dokumente in zeitlicher Folge (Bremer Ausgabe). Hrsg. D.E. Sattler. Bd. 6, München: Luchterhand, 2004, S. 60
Kamerad
Albert Maurüber
(* 1896 Czernowitz, † 1951 Bukarest)
Mein Kamerad II
Mein Kamerad! Ich rufe Dich, wie es der Schmerz der Tat mir entpresst und die Wollust: Täter zu sein, aufquellen lässt aus meines Menschtums Tiefen …
Nicht darfst Du kreisen, ein unendlich ferner Fixstern, der zu Bettlern oder Fürsten ausschickt krankes Licht …
Denn es ist auferlegt Verantwortung: zu zeugen für das Leben!
Ob wir uns in den Sielen mühen, die der Tag umspannt, ob bettelnd an den tausend Quellen schmachten,
ob unser Mund verstummt vor Gier nach einer Bruderhand,
ob er in vielen Stunden weint und schreit vor schwarzer Wand,
ob wir in Brunst die Glieder ketten, oder auf Totenbetten verröcheln …
es ist uns auferlegt Verantwortung: zu zeugen für das Leben, mein Kamerad.
Aus: Michael Markl (Hg.): „In Dornbüschen hat Zeit sich schwer verfangen“. Expressionismus in den deutschsprachigen Literaturen Rumäniens. Eine Anthologie. Regensburg: Pustet, 2015, S. 21f
Hölderlinjahr
2020 ist nicht nur Expressionismusjahr (100 Jahre Menschheitsdämmerung), sondern Hölderlinjahr. Vor 250 Jahren, 1770 wurden geboren: Friedrich Hölderlin, Ludwig van Beethoven, Georg Wilhelm Friedrich Hegel (ein starker Jahrgang), auch sonst noch z.B. Sophie Mereau oder William Wordsworth. L&Poe bringt neben einer großen Expressionismusanthologie eine kleinere Hölderlinanthologie. Sie beginnt heute mit einem Schülergedicht des 15jährigen.
DER UNZUFRIEDNE
Horat. Deformis aegrimonia.
»Schiksaal! unglüksvolle Leiden
»Heist du Sterblichen die Freuden,
»Die die steile Laufbahn hat,
»Grausam rauben. Bange Thränen
»Die sich nach der Bahre sehnen,
»Zu erzwingen ist dein Rath.
Dieses Gedicht entstand nach Sattler (Frankfurter Ausgabe) „Vmtl. in der zweiten Novemberhälfte“, neben dem Titel steht in Hölderlins Handschrift: „Im Nov. 85.“ Sattler kommentiert: „Die Fortsetzung ist mit dem äußeren Doppelblatt der Sammelreinschrift vom Dezember verloren. Das Horaz-Motto steht am Schluß von Epode XIII.“ Zuerst gedruckt wurde es am 18. Juni 1893 in Neues Tagblatt, Stuttgart.
Beissner (Stuttgarter Ausgabe) erläutert das Motto: „Motto: Horaz, epod. 13 v. 17—18: illic omne malum vino cantuque levato, deformis aegrimoniae dulcibus adloquiis. »Dort (vor Troja),« sagt der Centaur Chiron zu seinem Zögling Achill, »sollst du dir alles Übel erleichtern durch Wein und Gesang: die bedeuten für den entstellenden Kummer süßen Trost (Zuspruch).«“
Die kursiven Wörter sind der von Hölderlin zitierte Teil: deformis aegrimoniae, unglüksvolle Leiden (Hölderlin), entstellenden Kummer (Beissner), „verzehrenden Schmerz“ (Bernhard Kytzler, Reclam 2006), „häßlichen Gram“ (Adolf Bacmeister 1871) (bei ihm trägt das Gedicht die Überschrift „13. Trost im Alter“), „abgehärmter Grämlichkeit“ (Voss bei Reclam Leipzig, o.J., während oder vor 1. Weltkrieg), „Gram und Herzeleid“ (Voss, „13. An die Freunde“, Reclam 1928, 3. berichtigte Auflage, besorgt von Otto Güthling), „häßlich Trauer“ (Google).
Das Gedicht: der 15jährige (der Horaz im Original las) antizipiert die „steile Laufbahn“ und den Absturz.
Es ist mein Leben
Endre Ady
(* 22. November 1877 in Érmindszent, Komitat Sathmar, Österreich-Ungarn; † 27. Januar 1919 in Budapest)
DAS FLIEHENDE LEBEN
Ei, schau, wie er da flieht,
der hohe Herr, das Leben,
verfolgt wie ein entlaufener Knecht
vom größeren Herrn, der ihn gerecht
am Kragen faßt.
(Und mit ihm rennen, fliehen andere,
der Enkel Millionen,
geringe Lebenssprosse.
Darunter seh ich eben,
einen, der da verzweifelt trippelt,
es ist mein Leben.)
Da stapft es durch den weißen,
noch unberührten Schnee.
Flieh, Leben, flieh, o weh,
schon sind sie da, die Spuren
von närrisch blutigroten Beinen,
die sich zum schrecklichen Verfolger
im Schnee vereinen.
Ei, wie das große Leben rennt,
und hinter ihm her laufen
durchs Eis- und Schneegeländ
die winzigen Lebenshaufen
vorm Tod, der kommt, und
er kommt in Stücken.
Ich will mir selbst entrücken
und schau mir an den Strich
wie Rembrandt seinen Stich:
Die Flächen hell und dunkel,
die lässig seine Hand gemacht —
sind heute höchste Pracht.
(Ich weiß, ich tauge was,
nur habe ich mich eben
mit gutem Grund und ohne
zuviel schon abgegeben
mit dem Tode.
Der Tod ist aber nicht der Schluß,
nur einer, der auch selber fliehen muß.
Denn Tod und Leben, beide
sind arme kleine Knirpse,
die tun uns nichts zuleide.)
Sie waten durch den wunderbaren Schnee,
um meinem Los zu folgen,
dem Leidensweg von Leib und Seele.
Wie Jäger suchen sie im Dickicht nur
vom Großen Wild die Spur.
Die blutige Fährte, es ist die seine,
des allergrößten Verfolgers,
er kommt, er droht,
und ist ein tausendmal größerer Herr
als der Tod.
Der Tod ist nur ein Blutfleck,
eine verrückte Uhr,
sie hat wohl tausend Zeiger,
und alle zeigen stur
tausendmal falsche Zeiten.
Ein Winternarr, ein Clown,
alles in allem — nichts.
Das Leben kann er schlagen
und hat trotzdem nicht mehr zu sagen
als eine Visitenkarte.
Und dennoch und immer wieder,
auf allen Lebenswegen,
rennt man nur seinetwegen.
(auch mir gilt sein Gebot,)
uns kommandiert der kleine Groom,
der Kerl, das Nichts:
Der Tod.
Mag sein, daß ohne Tod
das Leben auch nicht wär.
Doch hinter beiden steht
der rätselhafte Herr,
ein urzeitlich wildes Muß,
die regelwidrige Regel,
der Erzverfolger: Er.
Der Tod verfolgt — wie Wanzen
die ßlutspur im Zickzack —
das Leben nach dem Gebot des höchsten Herrn,
des Kommandeurs vom Ganzen.
Der Tod ist Farbe nur,
ist auf dem Schneeweiß feigen Lebens
die Glasur
(so auch auf meinem Lebensbrocken).
Die Röte aber schwindet leicht
wie bei dem Fieberkranken,
den man ein Pulver reicht.
O Tod, ich liebe dich
(wie oft hab ich’s gestanden !),
und doch bist du nichts anderes
als blutiger Begleiter,
als Spiegelbild, zersplittert,
als schuldloser Begleiter
des Lebens, das flieht und zittert.
(Auch meines armen Lebens,
das weiß, erfroren mitflieht,
gejagt wie jedes Leben.)
Und hinter allen kommt daher
der größere Verfolger:
der Unbekannte Herr.
Deutsch von Géza Engl, in: Endre Ady: Gedichte. Auswahl zum 100. Geburtstag des Dichters. Budapest: Corvina, 1977, S. 107-109
War Endre Ady, der große ungarische Dichter, der vielleicht zu den Großen der modernen Weltliteratur gezählt würde, hätte er in einer Weltsprache geschrieben, Expressionist? Wen kümmerts? In Paris las und übersetzte er Baudelaire und Verlaine. Man nennt ihn oft einen Symbolisten. Er schrieb: „Jedes Kunstdogma ist mir verhaßt, und ich verabscheue das Dogma des l’art pour l’art mit all der Milde und all den tödlichen Wunden, die ich vom Leben erhielt…“ (zitiert nach dem Vorwort des Bandes, aus dem das Gedicht entnommen ist).
Vom Schlachtfeld
John Förste
(* 26. Januar 1889 Mainz, † 21. März 1941 Berlin-Buch)
Nacht
Der Erde Leib erzittert wie ein Tier.
Nacht kauert fremd und Einer stöhnt im Schlaf.
Rötlich umrändert schwanken der Gestirne Zeichen,
Die gelben Tode: Heulender Granaten
Heißblaue Zungen, flammend in die Weite. –
Ein totes Pferd schwimmt quellend im Getreide.
Maisfelder dunkeln jäh: Aus trüben Labyrinthen
Brechen der Tode düstere Schattenspuren.
Aus: John Förste, Versensporn 23. Jena: Edition Poesie schmeckt gut, 2016, S. 4 – Zuerst in Die Aktion 4. September 1915, Sp. 446 (Unter der Überschrift „Dichtungen vom Schlachtfeld“)
Die Nacht fällt scherbenlos ins Unbewußte
Walter Hasenclever
(* 8. Juli 1890 in Aachen; † 21. Juni 1940 in Les Milles bei Aix-en-Provence)
Die Nacht fällt scherbenlos ins Unbewußte;
Erlebnis bröckelt von dir ab wie Kruste,
Schon schirrt der Tag mit Faß, Laterne, Karren
Einäugige Pferde, die auf Futter harren.
Geliebte Fraun! Wo mögt ihr heute träumen!
In was für Betten dunkel euch verschäumen.
Lösch aus, du letzte Kerze, die noch brennt!
Mit froher Güte will ich mich umsäumen.
Wer treu ist, kehrt zurück aus Zwischenräumen
Zu einem gleichen Schicksal, das er kennt.
Ihn wird der eitle Schmerz nicht mehr betören
Dessen, der nichts verliert und nichts behält.
Wer treu ist, wird dem Menschlichsten gehören –
Und so erfüllt er sich in ewiger Welt.
Aus: Vom jüngsten Tag. Ein Almanach neuer Dichtung. Leipzig: Kurt Wolff, 1916, S. 41




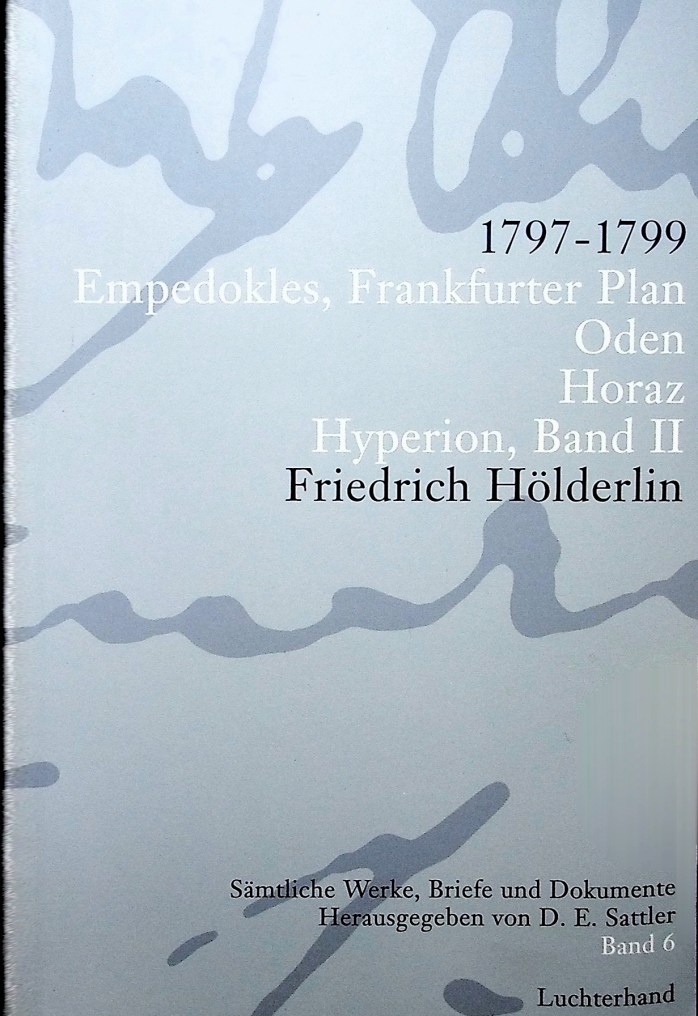




Neueste Kommentare