Lyrikzeitung & Poetry News
Das Archiv der Lyriknachrichten | Seit 2001 | News that stays news
81. Istanbul
Der türkische Dichter Orhan Veli Kanık hat sich in einem Gedicht mit der türkischen Metropole Istanbul befasst: „İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı“ – Ich höre Istanbul zu, meine Augen sind geschlossen, schrieb er.
Und genau diese Sichtweise durften einige Schüler des Ludwig-Meyn-Gymnasiums kürzlich erleben. / Uetersener Nachrichten
(Das Gedicht steht Türkisch und Deutsch in. Orhan Veli Kanık: Fremdartig / Garip. Gedichte in zwei Sprachen. Frankfurt: Dağyeli 1985)
80. Nachtschicht Schattenzone
Ein Jahr nach Erika Burkarts Tod am 14. April 2010 ist ein dichterisches Vermächtnis einzusehen: ihre Gedichte aus den Jahren 2008 und 2009 mit dem Titel «Nachtschicht», manche als Reinschrift, andere im Entwurfstadium hinterlassen. Dazu fügen sich als Entsprechung die Verse ihres Ehemanns Ernst Halter, der in «Schattenzone» Abschied nimmt. Auf dem Umschlag des Gedichtbandes stehen die gleich lautenden Majuskeln der Vornamen, die beiden E, einander gegenüber – in sanfter Berührung und zugleich in Distanz. Wer zu sehen versteht, erfasst darin wesentliche Züge des lyrischen Duetts. / Beatrice Eichmann-Leutenegger , NZZ
Erika Burkart: Nachtschicht. Ernst Halter: Schattenzone. Gedichte. Weissbooks-Verlag, Frankfurt am Main 2011. 160 S., Fr. 34.90.
79. Eher Beatles als Stones
Lyrik war und ist kein Massenprodukt. Wird auch keines mehr werden. Insofern war die Entscheidung, die Lesung drei junger Dichterinnen in das Beltz-Zimmer des Literaturhauses zu verlegen, kein Risiko – dort herrschte eine Art von Salon-Atmosphäre. Nora Bossong und Judith Zander, die eine in Bremen, die andere in Anklam (unterhalb von Usedom) geboren, sind auch als Romanautorinnen in Erscheinung getreten, beide hoch gelobt, Judith Zander für ihr Debüt im vergangenen Jahr sogar für den Deutschen Buchpreis nominiert.
… deutlich wurde allerdings die Genauigkeit, mit der Zander an Rhythmus, Motiven und Formen arbeitet, wie sie ganze fremde Gedichte in Form von Palimpsesten überschreibt und variiert (Rolf Dieter Brinkmanns „Westwärts“ ist eines davon); wie Zitate aus Popmusik und Literaturgeschichte wie in einen Flickenteppich in ihr Werk eingewoben sind. Bei aller Verschiedenheit sind Zander und Bossong sich in einem einig – in ihrer Nähe zu den „Beatles“. Vielleicht, sagt Bossong, sei das eine Generationenfrage: „Wir sind eben eher Beatles als Stones.“ / Christoph Schröder, FR 19.5.
78. Verstehen noch einmal
Von Bertram Reinecke
Der folgende Text entstand im Zusammenhang mit meiner Auseinandersetzung mit den vergangenen beiden Jahrbüchern der Lyrik. Da ich hoffte, dass das neue Jahrbuch zu der hitzig geführten Debatte, die sich besonders an Ulf Stolterfohts Satz „Das Verstehen in der Lyrik hat der Teufel gesehen“ entzündete, noch etwas beitragen würde, habe ich ihn zunächst noch zurückgehalten, um auch auf den Fortgang noch einzugehen. Da dort aber diese eigentlich noch unabgeschlossene (vielleicht aber auch unabschließbare) Debatte nicht fortgesetzt wurde, trage ich diesen späten Reflex auf den Streit nun hier unverändert nach. (Er setzt die Kenntnis der poetologischen Kommentare der zwei letzten Jahrbücher voraus.)
Ich bin verwundert, dass das vorsichtige Anreißen der Verstehensproblematik im Lyrikjahrbuch 08 so heftige Reaktionen im darauffolgenden Jahrgang ebenso wie anderswo hervorrief. Lag es daran, dass auch ein Geist von so andersartigem Temperament wie Christoph Buchwald sich den provokantesten Teil von Stolterfohts Bemerkungen zu eigen machte, oder hat man die Debatte auch als einen Stellvertreterkrieg um den Fachsprachenansatz zu verstehen?
Nicht zuletzt handelt es sich auch um eine Debatte unter renommierten Lyrikherausgebern. Ich möchte aber vermeiden hier allzu misstrauisch Motive zu unterschieben, sondern versuche in kritischer Diskussion eine eigene Position zwischen allen Stühlen einzubringen.
Axel Kutsch zieht sich zunächst die Proletenjacke über und gießt Stolterfohts Argumentation in das Entweder-oder-Schema eines Boxkampfes. Und kommt zu dem Schluss „Verstehen oder nicht verstehen – das ist doch nicht die Frage.“ Aber hatte Stolterfoht überhaupt so eine zugespitzte Frage gestellt? Er sprach u.A. nicht zuletzt von „Rat- und Hilflosigkeit“.
Diese Strategie ermöglicht Kutsch mit der Aussage „Die Frage kann nur lauten: Gelungen oder nicht gelungen?“ das Problem mit großzügiger Geste vom Tisch zu wischen und implizit mit zu bestreiten, dass es sich überhaupt lohnen könnte, wie tastend auch immer, zu erklären, was ein gelungenes Gedicht ausmachen könnte. Natürlich möchte jeder auf poetologisches Winkeladvokatentum verzichten, aber mit diesem Argument könnte man auch, weil es Gerechtigkeit ohnehin nicht herstellt, ein schriftlich kodifiziertes Recht ablehnen. Wie jedoch die Schriftlichkeit des Rechts denjenigen schützt, dessen Rede nicht durch Stand und allgemeine Achtung gesichert ist, so fällt der generöse Verzicht auf explizite Poetologie demjenigen leichter, der seinen Stand im literarischen Leben gesichert glaubt.
Axel Kutsch kann seine reduktionistische Lektüre, er weiß das selbst, nur deswegen etablieren, weil er genau das tut, was Stolterfoht ratlos zurückließe: Er weiß von vornherein, was Stolterfoht über das Verstehen sagen wollte und unterstellt, dass dies nur heimlichtuerisch verborgen wurde. Er geht sofort pointiert von der Frage: „Was steht da?“ zu einer anderen über: „Was bedeutet es ‚eigentlich‘, was für Konsequenzen hat das?“.
Hans Thill geht da verständnisvoller mit Stolterfohts Position um und legt Hintergründe dar, die Stolterfohts Position stützen: Verstehen ist nicht das Einzige, was wir mit Gedichten vorhaben, das Spektrum der möglichen Sprachhandlungen ist größer. (Verbieten, Witze machen, Konfabulieren …, Auswendiglernen, Rumreichen wird Gisela Trahms später hinzusetzen) Und: Verstehen ist problematisch. Thill verweist darauf, dass einander Verstehen damit zu tun hat, eine Lebensform zu teilen. Zugespitzt: Zunächst verstehe ich mich selbst und dann allenfalls die, die dieselben Bücher gelesen haben. Thill bringt weiterhin in Anschlag, dass unsere Verstehensbegriffe durch die Abrichtung der Schulbildung kontaminiert sind. Und er teilt Stolterfohts Ansicht, dass Pointen oft kurz greifen wie mancher Schülerwitz. Aber dann passiert etwas Merkwürdiges: Alles versöhnt sich, so deutet Thill an, im Schoße einer avancierten Hermeneutik. Da leuchtet das alte interesselose Wohlgefallen. Ein Teufel, wem das nichts gilt, wer nach dem Erfolg seiner Sprachstrategien schaut, wer gar listig ist! Also Thill selbst gar? Denn Thill traut Ulf Stolterfoht wahrscheinlich zu, dass dieser die Position der klassischen Hermeneutik gut genug kennt, sie selbst vertreten zu können, wenn es ihm darum denn gegangen wäre.
Den Anspruch der Interessenlosigkeit teilt das abrichtende Schulverstehen, vor dem alle Schüler nach gleichen Maßstäben benotet sein sollen, mit der Germanistik samt ihren Interpretationsritualen, denn sie rechtfertigt sich über ihre Objektivität als Wissenschaft.
Verstehen heißt in beiden Fällen immer zunächst, unter Rekurs auf nachprüfbare Fakten und Kenntnisse sagen, was man gesehen hat. Immer ist ein Experte zugegen, der bewerten muss, ob das Gesagte stichhaltig ist. Der Satz: „Natürlich verstehe ich Celan, aber ich kann Ihnen nicht sagen, was es bedeutet“ ist an Schule und Uni gleichermaßen unmöglich. Schule und Hermeneutik problematisieren das Verstehen unzulässig, indem sie immer am möglichen Missverständnis ansetzen. Was Thill als Pennälerwitz abkanzelt, würden Rühmkorf, und vermutlich mit ihm Kutsch, eher als sprachliche Notwehr gegen solche Problematisierungen charakterisieren und zum Urgund der Poesie erklären. (Und man muss hier nicht gleich nur an Spottverse oder Politlyrik denken, auch Czernin sieht in der Poesie zunächst einen Mitvollzug von sprachlichen Wertungen und nicht ein interesseloses Wohlgefallen.)
Wer sieht, wie ideologisch Lehramtsstudenten auf poetische Sprachspiele reagieren („Was soll der Scheiß!“), während Viertklässler solche Übungen als beglückend sinnhaft erleben, wer sieht, wie Referendare, die mit solch „neumodischen Flausen“ in der Fachkonferenz baden gehen („Das haben wir immer so gemacht“), wer erlebt, wie schnell gerade Leute mit gutem Deutschunterricht bei einer Besprechung von Ingeborg Bachmann vom Gedicht ab und zu den „wichtigen“ Dingen wie Auschwitz kommen, der mag nicht recht glauben, dass verbesserte Interpretationsstrategien ein „Mehr von dem Selben“ in irgend einer Weise zu verbesserter Gedichtlektüre führen. Man darf Thill in Frage stellen: Ist dem Kind wirklich schon mit Erlernen der Schrift die Phantasie abhanden gekommen? Wohl kaum, es wird der Literaturunterricht gewesen sein. (Ausnahmen von dieser Regel sind um so bewundernswerter! Ich möchte auch nicht in den Doppelbindungsstrukturen der Schule jeden Tag arbeiten müssen!) Hat der Schüler die Phantasie einfach so zu Hause gelassen? Nein, er musste seine Prüfungen bestehen. Wer sich hier verweigert, wird nicht Mitglied im (Literatur)club. Verstehen von vornherein als überwundenes Mißverstehen zu denken, problematisiert Gesprächspartner zu Delinquenten. Dabei verstehen wir doch ganz gut auf unsere Weise („Es zieht“). Die Toleranz in Bezug auf Deutungen, die, wie Gisela Trahms bemerkt, ohnehin nicht so ganz durchgehalten wird, riecht da wie das Angebot eines Stillhalteabkommens einer kranken Praxis, welches jedoch nicht jedem gewährt wird: Sage Du nichts gegen mich, dann lass ich Dich auch in Ruhe. Die Engerlinge sitzen aber an der Wurzel. Stolterfohts „Hineingeheimnissen“ würde so als ein Symptom, eine Art Sekundärinfektion an dieser schon angegriffenen Pflanze verstanden, welche(s) diese falsche Toleranz ausnutzt. (Das schließt eine Hochachtung für den erstaunlich rüstigen hermeneutischen Verdauungstrakt eines Hans Thill natürlich nicht aus, es gibt ja auch echte Toleranz!)
77. Besser gereimt
Neues aus der Provinz:
Sein Markenzeichen sind die Gegengedichte: Schiller, Goethe und Grass greift er mit Worten an und erschafft nach eigenen Aussagen damit ein neues Genre der Lyrik. Der 69-jährige Günter B. Merkel aus Wilhelmsfeld im Odenwald wird als gnadenloser Dichter bezeichnet. „Vor mir hat sich niemand getraut, den bekannten und geachteten Größen der Lyrik zu widersprechen“, sagt Merkel. Seiner Meinung nach hätten viele Dichter schlecht gereimt.
Damit kann man in der Provinz Eindruck schinden. Was die sich trauen! Schiller, Goethe, Grass! SGG-Schmäh heißt die neue Gattung.
Günter B. Merkel will zeigen, wie es wirklich geht. Er legt viel Wert auf einen richtigen Reim. So verurteilt er Heinrich Heine, der in seinem Gedicht „Entartung“ das Wort „singt“ auf „dünkt“ reimte. In Merkels Gegengedicht heißt es: „Dass er zum Beispiel dünkt und singt im gleichen Vers zusammendichtet, was bestenfalls nur ähnlich klingt?“
Aber es geht um höhere Ziele. Merkel ist Sprachwahrer:
Für ihn ist die Sprache das wertvollste Kulturgut: „Wir gehen viel zu schlampig damit um.“ Besonders verwerflich findet Merkel Anglizismen: „Bei mir heißen Kinder noch Kinder und nicht Kids.“ Er sammelte Zeitungsausschnitte, um auf die weite Verbreitung aufmerksam zu machen. Sein „Best of“-Buch hat er bewusst „Glanz-Lichter“ genannt.
Aufgrund seines Engagements für die deutsche Sprache nominierte ihn die Zeitschrift „Deutsche Sprachwelt“ für die Wahl des Deutschen Sprachwahrers 2010. Merkel ist stolz, als doch eher unbekannter Dichter bei der Wahl den dritten Platz belegt zu haben.
Nicht Sprachwahrer sondern: Deutscher Sprachwahrer. Der stolze Einlauf 2010 sah neben dem eher noch unbekannten Dichter solche bekannten Dichter wie Ramsauer, Gauck und Hahne vorn:
Zum „Sprachwahrer des Jahres“ zeichnet heute die DEUTSCHE SPRACHWELT Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer aus. … Mit 25,3 Prozent der Stimmen kam Ramsauer aufgrund seiner „Deutsch-Initiative“ auf den ersten Platz, gefolgt von dem ehemaligen Bürgerrechtler Joachim Gauck (18,2 Prozent). Der ZDF-Moderator Peter Hahne und der Dichter Günter B. Merkel teilen sich mit jeweils 16,7 Prozent den dritten Platz.
Und 2009:
Karl-Theodor zu Guttenberg(Platz 1), Ulrich Wickert (Platz 2),Louis van Gaal (Platz 3)
„Deutsche Sprachwelt“ gibt es auch bei Wikipedia – wahrscheinlich ganz unabhängig:
Die Deutsche Sprachwelt (DSW) ist eine unabhängige, überregionale Zeitschrift für Sprachpflege. Herausgeber ist der Verein für Sprachpflege e. V. (VfS). … Die Deutsche Sprachwelt wird kostenlos abgegeben und finanziert sich vor allem aus Spenden.
Und überhaupt, eine Sprache, die solche Freunde hat, was braucht die Feinde?
76. Gereimt
„Diese Aussage war mehr als nur ein sexistischer Ausrutscher. Sie zeigt, dass manche eine mutmaßliche Vergewaltigung scheinbar als Kavaliersdelikt sehen.“
Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek (SPÖ) findet den Sager des ÖVP-Abgeordneten Wolfgang Großruck „unfassbar“. Der Mandatar aus Oberösterreich, der seine Parlamentsreden stets mit einem Reim beendet, hatte Dienstagabend gedichtet: „Obwohl er schon ein reif’rer Mann, zeigt Dominique Strauss, was er noch „Kahn“. Im Parlamentsprotokoll ist angemerkt:„Heiterkeit und Beifall bei Abgeordneten von ÖVP und FPÖ“. / Kurier
75. Ist das nicht eine schöne Welt?
Heute vor hundert Jahren starb Gustav Mahler.
Ging heut morgen übers Feld,
Tau noch auf den Gräsern hing;
Sprach zu mir der lustge Fink:
„Ei, du! Gelt? Guten Morgen! Ei gelt? Du!
Wird’s nicht eine schöne Welt? schöne Welt!?
Zink! Zink! schön und flink!
Wie mir doch die Welt gefällt!“
Auch die Glockenblum am Feld
Hat mir lustig, guter Ding
Mit den Glöckchen klinge, kling,
Ihren Morgengruss geschellt:
„Wird’s nicht eine schöne Welt? schöne Welt!?
Kling! Kling! Schönes Ding!
Wie mir doch die Welt gefällt! Hei-a!“
Und da fing im Sonnenschein
Gleich die Welt zu funkeln an;
Alles, alles, Ton und Farbe gewann im Sonnenschein!
Blum und Vogel, gross und klein!
Guten Tag, guten Tag! Ist’s nicht eine schöne Welt?
Ei du! Gelt? Schöne Welt!?
Nun fängt auch mein Glück wohl an?!
Nein! Nein! Das ich mein‘, mir nimmer blühen kann!
(Lieder eines fahrenden Gesellen, Nr. 2;
Musik und Text von G. M.)
Man muss es natürlich hören.
74. Meine Anthologie: Wer bist du?
Fuad Rifka
Wer bist du?
– Wer bist du?
„Ich weiß nicht.“
–Wie verbringst du
ooo die Jahreszeiten des Lebens?
„Im Herbst
auf der Erde unter dem Laub.
Im Winter
auf der Erde unter dem Schnee.
Im Frühjahr
auf der Erde unter dem Gras.
Im Sommer
auf der Erde unter den Bächen.“
– Seltsam!
Immer unter Schleiern!
Fuad Rifka: Gedichte eines Indianers. Arabisch und deutsch. Übertragen von Ursula und Simon Yussuf Assaf. Eisingen: Heiderhoff 1994, S. 11
73. Glücklich
Ist ein Volk nicht glücklich zu nennen, in dem die einfachen Leute dichten und die Studienräte sich entsetzen?/ Paul-Josef Raue / 18.05.11 / Thüringer Allgemeine
72. Fuad Rifka gestorben
Im Alter von 80 Jahren ist am vergangenen Samstag der bekannte libanesische Dichter Fuad Rifka gestorben. Zusammen mit Adonis und Mahmud Darwish zählte er zu den großen Erneuerern der arabischen Lyrik, hatte in seiner Generation jedoch bis zuletzt eine Sonderstellung inne.
Seine literarische Prägung verdankt Rifka nicht der englisch- oder französischsprachigen Literatur, sondern der deutschen. Ende der fünfziger Jahre war er zum Studium der Philosophie nach Tübingen gegangen und promovierte dort 1965 über die Ästhetik von Heidegger.
Seine zahlreichen Übersetzungen machten die Araber erstmals mit der Lyrik von Hölderlin, Rilke und Trakl bekannt, die auch seine eigene Dichtung prägten.
[…]
Seit den neunziger Jahren wurde er mit seinen Texten auch hierzulande bekannt, war häufig auf Lesungen zu Gast und korrespondierendes Mitglied der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung. Für seine Verdienste um die Vermittlung der deutschen Literatur im Ausland erhielt er, von der Krankheit bereits gezeichnet, im vergangenen Jahr in Weimar die Goethe-Medaille.
In der arabischen Welt tragen die zahlreichen Nachrufe seiner außergewöhnlichen Stellung Rechnung: In seiner Generation ein Außenseiter, prägte er die um eine neue, unprätentiöse Sprache bemühten jüngeren Lyriker umso stärker. […]
/Stefan Weidner, qantara.de
71. Les Murray in Deutschland
Gestern wurde das neue Buch von Les Murray geliefert, „Größer im Liegen“. Es enthält eine von der Verlegerin und Übersetzerin Margitt Lehbert gemeinsam mit dem Dichter getroffene Auswahl Gedichte aus den letzten zwei Bänden („Taller When Prone“ und „Biplane Houses“) und zwei neue Texte. Zum Erscheinen des Buches unternimmt der Dichter eine Lesereise durch Deutschland:
- 24.5. München – Lyrik-Kabinett, Amalienstr. 83 a (U 3 / U 6: Universität)
- 25.5. Dresden – Literaturforum Dresden mit dem Deutschen Hygiene-Museum, Deutsches Hygiene-Museum, Lingnerplatz 1, 01069 Dresden
- 26.5. Leipzig – Edit: Café Kafic, Karl-Tauchnitz-Straße 9-11 , 04107 Leipzig.
- 27.5. Frankfurt – mit Christian Lehnert im Literaturhaus Frankfurt, Schöne Aussicht 2, 60311 Frankfurt a.M. (19 Uhr!)
- 30.5. Berlin – LCB, Am Sandwerder 5, D-14109 Berlin
alle Lesungen beginnen um 20 Uhr, nur in Frankfurt schon um 19 Uhr
»In Australien ist er eine Institution; in der angelsächsischen Dichtung bildet er mit Derek Walcott und Seamus Heaney eine Klasse für sich.« (Thomas Poiss)
70. Lyrikjahrbuch-Buchpremiere
Die Deutsche Verlags-Anstalt meldet: Buchpremiere des Jahrbuchs der Lyrik 2011 am 20. Mai. Es lesen Kathrin Schmidt, Sünje Lewejohann und Ulf Stolterfoht.
Moderation: Christoph Buchwald.
Ort: Berlin, Lettrétage
69. Die Welt spiegelt sich in Büchern
Warum Dresden ein Literaturhaus braucht und das alte Kraftwerk Mitte ein guter Standort ist. Plädoyer eines der Initiatoren
von Volker Sielaff
Ein Kraftwerk ist ein Ort der Wandlung und Verwandlung. Was dort Wandlungen durchläuft, nennen wir, ein wenig unbestimmt, Energie. Der moderne Zeitgenosse denkt jetzt womöglich an energy-drinks. Und nicht selten, zumindest im umgangssprachlichen Gebrauch, wird Energie mit Kraft gleichgesetzt: „Ich habe keine Energie mehr.“ Dann muss man „auftanken“, irgendwoher neue Energie beziehen. Ein Kraftwerk, das gern unterschätzt wird, weil seine Leistung sich nicht konkret in Zahlen ausdrücken läßt, ist die Kunst. Auch dieses Kraftwerk braucht ein Netz, in welches die vom Künstler verwandelte Energie eingespeist werden kann. Dieses Netz muß sichtbar und weit verästelt sein, damit es sinnvoll arbeiten kann, aber vor allem, damit die Energie dort ankommt, wo sie hin soll.
Was fällt einem nicht alles ein bei dem Wort Kraftwerk. In den Siebzigern gab es ein Elektropopband, die so hieß. Uns heute fällt wohl zuerst Fukushima und Tschernobyl ein. Wir sind ziemlich schnell beim Thema Energiepolitik. Bei Einstieg und Ausstieg, oder Ausstieg aus dem Einstieg aus dem Ausstieg, oder Ausstieg aus dem Ausstieg in den Einstieg.
Man darf bei soviel Sprachblüten an eine Energieform erinnern, die fast ganz ohne schädliche Nebenwirkungen für unser Wohlergehen ist: die Verfertigung und Verwandlung von Worten zu Sinn. Oder sinnvollem Unsinn. Die Literatur.
Um diese, die Literatur, ist in der Stadt nun eine wie ich finde belebende Debatte entbrannt. Zwei assoziationsstarke Begriffe haben in dieser Debatte zusammen gefunden: Kraftwerk und Literatur. Literatur kommt von littera, lateinisch, Buchstabe bzw. litterae für: Geschriebenes, Dokument, Brief usw. Im 18. Jahrhundert war noch von den „schönen Wissenschaften“ die Rede, erst im 19. Jahrhundert wurde der Begriff Literatur salontauglich. Auch die ersten Kraftwerke wurden im 19. Jahrhundert errichtet, damals noch von Dampf angetrieben.
Im Kraftwerk Literatur geht ist im Grund um die Verwandlung von Lebens- in Wortenergie: das Gedicht, der Roman, der Essay sind Kraftwerke des Geistes, vor deren Nebenwirkungen ausdrücklich gewarnt werden muß: Herzensbildung, emotionale sowie praktische Intelligenz und die Fähigkeit, sich dem anderen gegenüber deutlich ausdrücken zu können.
Was wäre also gegen ein Kraftwerk der Literatur im Kraftwerk Mitte einzuwenden? Es gäbe in der Stadt genügend Orte, an denen Lesungen stattfinden, wird von den Verteidigern des Bestehenden gesagt. Dem ist nicht zu widersprechen. Es gibt in Dresden hervorragende Leseveranstaltungen an den unterschiedlichsten Orten. Und es gehen die Lesereisen bedeutender Autoren regelmäßig an dieser Stadt vorbei. Man fährt nach Leipzig oder Berlin, seltener nach Dresden.
Um nur ein Beispiel zu nennen: an dem wunderbaren „Preis der Literaturhäuser“, an den sich eine Lesetour des Preisträgers durch mehrere Städte anschliesst, war Dresden nicht beteiligt. Und wenn, sagen wir, Michel Houellebecq oder Haruki Murakami, unzweifelhaft Autoren von Weltrang, nach Deutschland kommen – kommen sie dann nach Dresden?
Ein Kraftwerk der Literatur würde der Stadt noch aus einem anderen Grund guttun. Es wäre nämlich ein Ort, den jeder sofort mit Literatur verbinden würde. Außerdem ist ein Literaturhaus nicht ausschließlich ein Ort, an dem gelesen wird. Es ist auch nicht nur ein Ort, an dem sich ein versprengtes Häuflein Literaten trifft. Nein, ein Literaturhaus ist ein Labor für geistige Entwicklungen, ein Interaktionsraum für alles, was in Worten verhandelt werden kann, ein Ort der Bildung.
Ein Literaturhaus ist ein Ort, an dem die Geschicke des Gemeinwesens, unter ausdrücklicher Einbeziehung der klügsten Köpfe desselben, verhandelt werden können. Und es sollte sich mit den anderen Künsten, der Musik, der Bildenden Kunst, dem Theater, zum Nutzen aller Beteiligten, in gemeinsamen Projekten vernetzen.
Ein Literaturhaus ist nicht zuletzt ein Ort für die Bürger unserer Stadt, eine Art lebendiger Universität, an welcher der Künstler Bürger und auch schon mal der Bürger Künstler sein darf.
Ein Literaturhaus ist ein Energiesystem, ein Ort des Austausches, der Debatte und des Diskurses. Denn Bücher sind eben nicht zu ihrem Selbstzweck da. In Büchern wird der Zeitgeist verhandelt, wird geprießen oder abgewatscht.
Bücher gehen uns an, weil die Welt sich in ihnen spiegelt. Weil wir uns in ihnen erkennen: in Zustimmung oder Ablehung, nur hoffentlich nicht in Gleichgültigkeit.
Ein Literaturhaus in Dresden wäre demnach nicht einfach ein weiterer Ort, an dem Buchlesungen stattfinden. Es wäre Labor für neue Ideen, inclusive Cafe, Ausstellungsräumen, Gästezimmern, Räume für Initiativen und Vereine. Ein Literaturhaus besteht nicht nur aus einem Lesesaal mit knapp hundert Plätzen. Es ist mehr, viel mehr.
(Sächsische Zeitung v. 17. Mai 2011)
68. Kehrseite
Ob es einem gefällt oder nicht, das Englische war über Jahrhunderte das Hauptmedium der irischen Kultur und die Iren hatten das Glück, von einem Volk mit einer verdammt guten Sprache kolonisiert worden zu sein.
Um auf Heaney zurückzukommen, so lag seine Inspiration wohl teilweise bei [den Iren] WB Yeats und Patrick Kavanagh, aber er erkannte auch stets an, wieviel er Shakespeare, Wordsworth und Gerard Manley Hopkins verdankt. Sein Geschenk einer Übersetzung des Beowulf (das Gegenstück zur Übersetzung des Táin durch einen englischen Dichter) ist das Eingeständnis seiner Schuldigkeit dem Englischen [Englishness] gegenüber. / gleiche Quelle wir #67
67. Grüner Paß
Vieles vom besten Britischen ist irisch, ob in Literatur, Kunst oder Popmusik. Andersherum auch.
1983 veröffentlichte Seamus Heaney ein Gedicht in Form eines politischen Pamphlets namens Ein offener Brief. Er reagierte darauf, daß er unfreiwillig in das Penguin Book of Contemporary British Poetry aufgenommen wurde: „laßt euch sagen / Mein Paß ist grün. / Nie hoben wir ein Glas / auf die Queen.“
Heaney bekannte später, daß er einmal für kurze Zeit im Britischen Paßamt in London arbeitete und daß er zur Zeit der Abfassung des Gedichts erst seit 10 Jahren einen grünen Paß hatte. / Irish Times
Don’t be surprised if I demur, for, be advised
My passport’s green.
No glass of ours was ever raised
To toast The Queen.
- An Open Letter (1983), p. 9.
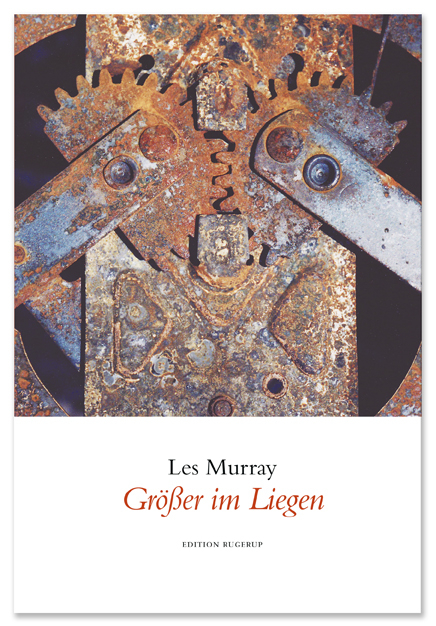


Neueste Kommentare