Lyrikzeitung & Poetry News
Das Archiv der Lyriknachrichten | Seit 2001 | News that stays news
67. Diaspora
Immer wieder finde ich Leute mit ghanaischen Wurzeln, die in der Diaspora Großes leisten. So Naki Akarobettoe, eine ausgewiesene Künstlerin, die in ihrem Stammland Ghana kaum bekannt ist. Enkelin aus der Verbindung einer Frau ghanaisch königlicher Herkunft mit einem amerikanischen Bergarbeiter, wurde sie in Columbus, Ohio geboren und aufgezogen, wo sie mit 12 ins Reich der Dichtung aufbrach.
Fasziniert vom natürlichen Strömen der Ausdruckskunst begann sie historische Autoren wie Phyllis Wheatley, Langston Hughes, Toi Derricote zu studieren. 2004 wurde sie Mitgründerin der Studentenorganisation D.E.E.P. (Developing Empowering Enhancing Poets through Poetry, etwa: Dichter durch Dichtung Entwickeln Befähigen Fördern). Ihr nächstes Projekt heißt “D.O.P.E”*. / Ameyaw Debrah, ghanaweb
*) die Abkürzung wird nicht aufgelöst
66. Agonie der ivoirischen Lyrik
„Wenn wir nicht aufpassen, könnte der Tod der ivoirischen Lyrik nah sein“, sagt ein Wissenschaftler, „der sich auch an lyrischen Schreiben versucht“, bei einer Präsentation von 8 Büchern. Unter den 8 Büchern ist nur ein Gedichtband, „Rayons dans la nuit“ von Dakaud Anibié Nestor. Im Zeitraum von mehr als 12 Jahren seien gerade einmal 10 Gedichtbände erschienen. Es gebe viele Gründe für den Rückgang dieses Genres, das seine Wurzeln in Wiegenliedern, Mondscheingesängen und Begräbnisliedern habe, an denen Afrika reich sei. Einer liege im Desinteresse der Verleger, die lieber einen Roman veröffentlichten als einen schwer verkäuflichen Gedichtband. Die alte Debatte vom „Hermetismus der Poesie“ sei wieder entbrannt. Die Leser meinten, Lyrik sei für ein breites Publikum schwer zugänglich, sagt ein Verleger, der anonym bleiben will. Ein anderer Grund sei, daß weder Kritiker noch Lehrer die Fähigkeit zum Lyrikgenießen weitergäben. Dabei sei die Lyrik unter allen Formen diejenige, die durch das spielerische Heraustreten aller sprachlichen Möglichkeiten gekennzeichnet sei, lexikalische, syntaktische ebenso wie Klang und Rhythmus. Das Gedicht erlaube Einblicke in das Innenleben eines Autors in einer gegebenen sozialen Sitiuation. Man erinnert sich, daß im Befreiungskampf des schwarzen Kontinents und in der Diaspora die Bewegung der Négritude sich auch auf die Poesie stützte. Gedichtbücher wie „Chants d’ombres“ von Léopold S. Senghor oder „Cahier d’un retour au pays natal“ von Aimé Césaire haben zum Freiheitskampf beigetragen.
Es sei dringend, der Poesie wieder Raum zu geben. Erlaube sie doch auszudrücken, was man fühlt. Die Poesie wecke das Gefühl, das uns erlaube, sensibel zu sein. Deshalb müsse der Ivoirische Staat die Freude am lyrischen Schaffen an die Jugend weitergeben. Seit der Generation von Boté Zady Zaourou, Niangoran Porquet und anderen sei die Lyrik in Agonie verfallen. Man müsse etwas tun. / Jean- Antoine Doudou, Le Patriote
65. Weltliteratin
Längst hat sich Friederike Mayröcker den Ruf einer „Weltliteratin“ erschrieben, ihre eigene Gattung geschaffen, die keine Grenzen kennt und alle Dimensionen sprengt: Identität, Zeit, Raum – was andere nötig haben für Halt und Orientierung, darüber setzt sie sich so selbstverständlich wie folgerichtig hinweg, um sich und ihrem Schreiben neue Freiräume zu schaffen. / ORF
63. Drums Between The Bells
Mit „Drums Between The Bells“ unternimmt Brian Eno nun den Versuch, Gedichte des modernen Lyrikers Rick Holland so in Klang zu betten, dass eine Einheit entsteht – obwohl die Gedichte als gesprochenes Wort erhalten bleiben. Ein fast unmögliches Unterfangen, ziehen Gedichte doch eigentlich alle Aufmerksamkeit auf sich, weil jede Betonung, jede Pause wichtig wird. / Gerd Dehnel, Märkische Allgemeine
Mehr: Rolling Stone
62. Liao Yiwus langer Weg
In seinem neuen Buch „Für ein Lied und hundert Lieder“ sind endlich auch einige seiner Gedichte abgedruckt. Wir beginnen zu ahnen, dass der Autor einen langen, schmerzhaften Weg gegangen ist von der Sprache zu den Sachen. / Arno Widmann, FR
61. Roussels Textzwiebel
Der französische Schriftsteller Raymond Roussel schrieb zwischen 1915 und 1928 an einem ca. 50 Seiten langen Text, der zu den komplexesten Texten der Literatur gehört. Es handelt sich um ein in vier Teile unterteiltes Gedicht, das meist nur Insidern bekannt ist und in bestimmten literarischen Kreisen hoch geschätzt wird. Das besondere an diesem Text sind jedoch nicht die lyrischen Qualitäten im herkömmlichen Sinn, sondern der völlig neuartige Umgang mit Parenthesen, d.h. Texteinschüben. Grob könnte man die Form etwa folgendermaßen zusammenfassen: Im ersten Teil der Nouvelles Impressions d’Afrique kommen sechs ineinander verschachtelte Klammerparenthesen vor – und zwar so, dass eine Art eigenartige Textzwiebel entsteht. / Andreas Klumpp, Notebook
Grössel, H. (Hg.): Raymond Roussel. Eine Dokumentation. München. 1977.
60. Freilassung
In Bahrein sind rund zweihundert politische Gefangene freigelassen worden. Unter ihnen ist eine bekannte junge Dichterin, Ajat Al-Kurmisi – vor kurzem verurteilt für ein Jahr, weil sie bei einer Kundgebung ein Gedicht vorgetragen hatte. / euronews
59. Fast alles über Sibylla Schwarz
(zumindest aus dem ersten Vierteljahrtausend nach ihrem Tod) werde ich peu à peu auf den Seiten von pomlit.wordpress.com zugänglich machen. Die ersten 4 Einträge zwischen 1728 und 1891 sind online. Mit Vorsicht zu genießen: wie heute so auch früher war nicht alles richtig, was schwarz auf weiß gedruckt steht. Nicht nur Romanautoren erfinden, sondern auch Literaturgelehrte. Einer schreibt vom andern ab, Richtiges und Falsches zirkuliert fröhlich so früher wie heute. Auch darüber läßt sich Nützliches aus der Geschichte lernen.
58. «Die nachzustotternde Welt»
«Nur das Flüstern des Windes» kombiniert Sachtext, Lyrik und Malerei. Ein Schwarz-Weiß-Foto des jüdischen Dichters eröffnet die Ausstellung. Mit jedem der folgenden Bilder wird eine Aussage Celans zitiert. Unter der «Mauer» steht: «Die nachzustotternde Welt, bei der ich zu Gast gewesen sein werde, ein Name, herabgeschwitzt von der Mauer, an der eine Wunde hochleckt.» Diese bitteren Zeilen schrieb der Dichter kurz bevor er seinem Leben ein Ende setzte.
… «Meine Bildarbeiten verfolgen das Ziel, mit Hilfe einer Mischtechnik auf Papier und Holz, den jeweiligen Sachtext und die hierbei einfließende Lyrik zu Sprache und zum Bild zu machen», erklärt der Baesweiler Künstler Hans-Werner Kiefer. / Aachener Zeitung
57. Jury sucht den Superautor
Wie die Zeitung heißt, erfährt man nicht, nur den Namen der Website, „westen.de“. Merkwürdig eigentlich, ist das geheim? Aber sie müssens selber wissen. Ein Artikel von Daniel Hadrys stellt die Jurymitglieder vom Bachmannpreis einzeln vor, seiner Meinung nach
lässt sich die Jury in bestimmte Typen einteilen, die wir auch aus gängigen Formaten wie „Popstars“ oder „DSDS“ kennen: Die Nette, der Fiesling, der leicht Bekloppte – in solche Schubladen kann der Beobachter auch die Personen auf den Klagenfurter Jury-Stühlen stecken.
Interessant – er sagt uns dann aber nicht, wer zB der „leicht Bekloppte“ ist. ABer sonst so einiges, zB über Alain Claude Sulzer:
Der Schweizer Übersetzer und Schriftsteller Alain Claude Sulzer ist dagegen eher der statische Typ. Und, so raunt sich so mancher Zuschauer böswillig zu, auch in Sachen Kritik-Kompetenz wenig beweglich. So verweigerte er die Beurteilung des späteren Zweitplatzierten Steffen Popp mit der Begründung, dass Popp Lyriker sei und er, Sulzer, nichts mit Lyrik anfangen könne. Er stiehlt sich damit aus der Verantwortung, einen sehr kryptischen und schwierigen Text sezieren zu müssen – nur dummerweise ist genau das sein Job. Popps Text ist keine reine Prosa, sondern eine Mischform und ein erzählerisches Experiment, das sich den üblichen narrativen und dramatischen Mustern entzieht. Doch scheinbar hat Sulzer Angst davor. Er ist der Konservative in der Jury.
56. Frankfurt-Stipendium
Das Kulturamt der Stadt Frankfurt vergibt wieder ein Arbeitsstipendium für in Frankfurt ansässige Autorinnen und Autoren. Gefördert wird die Arbeit an einem literarischen Werk im Bereich Prosa oder Lyrik von hoher künstlerischer Qualität.
Das Arbeitsstipendium ist mit monatlich 2000 Euro dotiert und hat eine Laufzeit von sechs Monaten. Es ist mit keinerlei Auflagen verbunden. Die Bewerbungsfrist ist der 15. August (Poststempel). Nähere Informationen zur Ausschreibung und das Antragsformular sind unter www.kultur.frankfurt/literatur.de ersichtlich.
55. Lyrische Bruderschaft
Von Felix Philipp Ingold
Ein Leben Shakespeares, nachgedichtet von Armin Senser
„William Shakespeare“, so kann man es in Wikipedia und auch anderswo lesen, „war ein englischer Dramatiker, Lyriker und Schauspieler (1564-1616). Er gehört zu den bedeutendsten und am meisten aufgeführten und verfilmten Dramatikern der Weltliteratur, schrieb etwa 38 Dramen und Versdichtungen, darunter eine Sammlung von Sonetten.“ Das Werk dieses Autors ist in beliebig viele Sprachen übersetzt, nach immer wieder andern hermeneutischen Ansätzen gedeutet und anhand von unterschiedlichsten Kriterien als globaler Klassiker kanonisiert worden.
Zu der nach wie vor ungebrochenen Präsenz und Wirkungsmacht dieses Werks bildet die verschattete Persönlichkeit des Autors einen geradezu provokanten Kontrast. Nur ein paar wenige Koordinaten seines vermutlich recht unspektakulären Lebenswegs sind zweifelsfrei nachzuweisen, und selbst die Urheberschaft an seinen Stücken und Gedichten bleibt in letzter Instanz bis heute ungeklärt.
Bis heute hat denn auch das Interesse – oder wenigstens die Neugier – in Bezug auf Shakespeares Künstler-, Geschäfts-, Geschlechts-, Familien- und Glaubensleben stetig zugenommen, und die Tatsache, dass gegenwärtig, angeregt durch Kurt Kreilers diesbezügliche Forschungsergebnisse, erneut eine weltweite Debatte über die „wahre“ Identität des Verfassers geführt wird, macht deutlich, wie gross das Faszinosum dieser fortbestehenden literaturgeschichtlichen Leerstelle noch immer ist. Bestätigt wird das Faszinosum auch durch zahlreiche andere (wissenschaftliche, essayistische, erzählerische) Publikationen der vergangenen Jahre, vorab jene von Peter Ackroyd und Walter Klier, von Stephen Greenblatt oder Harold Bloom.
Wenn nun der Dichter Armin Senser unter dem ebenso lapidaren wie anspruchsvollen Titel „Shakespeare“ einen Versroman vorlegt, der auf mehr als 300 Druckseiten ein weiteres „Leben“ des kaum fassbaren, von zahllosen Mutmassungen und Spekulationen zusätzlich verschatteten Autors entfaltet, mag dies vorab trendbedingt sein, verdient aber gleichwohl Beachtung schon deshalb, weil hier auf attraktive biographische Konjekturen verzichtet wird zu Gunsten eines dichterischen Grossprojekts, das als solches – Tausende von „Versen“ sollen sich zu einem „Roman“ fügen – Aufmerksamkeit erzwingt und gewürdigt werden will.
Senser arbeitet sich am Modell des Blankverses ab, gestattet sich dabei allerdings mancherlei Freiheiten, mitunter auch die, den Endreim einzusetzen. Weshalb und wozu der vorliegende Roman jedoch überhaupt versifiziert werden musste, ist nicht ohne Weiteres einzusehen. Der umfängliche Text besteht zur Hauptsache aus direkter, auf verschiedene Sprecher verteilter Rede, die sich nicht so sehr durch poetische Qualität auszeichnet als vielmehr durch betonte Schnodderigkeit, durch allerlei Jargonismen, zahlreiche Wiederholungen und Pleonasmen, die nur vereinzelt ‒ dann freilich machtvoll genug – mit lyrischen oder aphoristischen Versatzstücken kontrastiert werden. Offenkundig hat sich Senser eine dichterische Sprechweise angeeignet, wie man sie, formal sehr viel strenger gefasst, von Joseph Brodsky oder Durs Grünbein kennt, die ihrerseits bei der Poetik der altrömischen Epistel (etwa bei Horaz, bei Ovid) anknüpfen und dabei ebenfalls aktuelle umgangssprachliche Elemente einsetzen.
*
Zu Armin Sensers Versroman liefert William Shakespeare ‒ vom Blankvers einmal abgesehen ‒ weniger den Stoff als den Vorwand oder die Folie, die auf eigene, eigenwillige Weise überschrieben wird, ohne dass dabei neue Fakten, Daten, Dokumente beigebracht werden (was auch gar nicht zu erwarten ist bei dieser Textsorte). Statt wie die meisten Shakespeare-Biographen den Stückeschreiber und Theaterintendanten aus Stratford als eine Art Schöpfergott hochleben zu lassen, der nicht nur seine Bühnenfiguren, sondern auch uns Nachgeborene überhaupt erst zu „wahren Menschen“ gemacht habe, nähert sich Senser seinem Protagonisten völlig ungeniert an, begegnet ihm auf virtueller Augenhöhe, behandelt und kommentiert ihn wie einen vertrauten Kumpel vom Stammtisch, vom Spielautomaten oder von der Fanmeile. Naturgemäss wird er durch diese „Erniedrigung“ des Kulturhelden seinerseits „erhöht“, er wird zu dessen Alter ego, er darf ihn umstandslos duzen, nennt ihn beiläufig „Will“, befragt und berät ihn unbefangen, und ebenso unbefangen lässt er die Menschen aus Shakespeares nächster Umgebung in direkter Rede zu Wort kommen.
Allzu gross ist seine diesbezügliche Auswahl nicht – das Personal beschränkt sich auf die Familie, auf Berufskollegen und Mätressen des erfolgreichen, geschäftstüchtigen, lebensfreudigen, dabei wenig verlässlichen, eher wankelmütigen und verantwortungsscheuen Theatermanns, dessen Genialität nichts daran ändert, dass er sich als ein „Mensch wie du und ich“ durch seine kurvenreiche Vita manövriert, bald hochgemut und aufbrausend, bald zaudernd, zweifelnd und schwindelnd ‒ immer jedoch der unbestechliche Beobachter seiner Umwelt und seiner selbst, ein Mann, dem so profane Dinge wie die Untreue seiner Ehefrau, der Tod eines Sohns, Querelen mit Konkurrenten und Gläubigern gleichermassen zu schaffen machen und der sich bloss nebenbei für das zu engagieren scheint, was wir als seine Meisterwerke kennen. Senser versucht diesem Shakespeare klarzumachen, nein – einzureden, was Sache ist:
Was ist das für eine Welt. Was für Menschen.
Beide werden nun erforscht. Als müsste man sehen,
um zu verstehn, und verstehen, um einzusehen.
Dich überzeugt das nicht: es lässt dich nur schreiben.
Es schreibt sich von selbst, als ob sich die Sprache des Ärgers
bedienen würde. Als wäre die Anspannung dein Metrum.
Die Verachtung dein Wortschatz, der Ekel dein Vers.
Und du ein blosser Betrachter, ein Neutrum.
Es dämmert. Dein Rücken schmerzt, die Schulter brennt.
Den Fingernagel abgekaut, öffnest du ein Fenster …
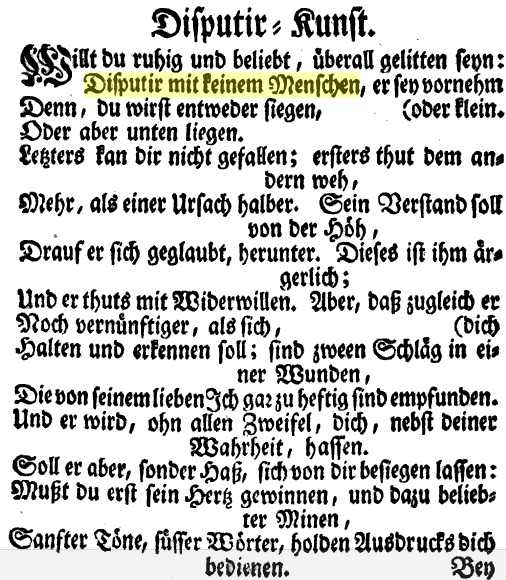



Neueste Kommentare