Lyrikzeitung & Poetry News
Das Archiv der Lyriknachrichten | Seit 2001 | News that stays news
wahnwitz
Ulrike Draesner
was das wort ist
Samuel Beckett, comment dire / what is the word
wahnwitz
wahnwitz wie
wie
was das wort ist
wahnwitz weil
weil dies
wahnwitz weil all dies
angesichts
wahnwitz angesichts all dieses
sehens
wahnwitz all dies zu sehen
dies
was das wort ist
dies dies
dies dies hier
all dies dies hier
wahnwitz angesichts all dieses
sehens
wahnwitz all dies dies hier zu sehen
wie
was das wort ist
sehen
flüchtig sehen
flüchtig zu sehen glauben
flüchtig zu sehen glauben wollen
wahnwitz wie flüchtig zu sehen glauben zu wollen
was
was das wort ist
und wo
wahnwitz wie flüchtig zu sehen glauben zu wollen was wo
wo
was das wort ist
dort
dort drüben
weg dort drüben
weit
weit weg dort drüben
wankend
wankend weit weg dort drüben was
was
was das wort ist
angesichts all dessen
all dies dies
all dies dies hier
wahnwitz wie was zu sehen
flüchtig zu sehen
flüchtig zu sehen glauben
flüchtig zu sehen glauben zu wollen
wankend weit weg dort drüben was
wahnwitz wie flüchtig zu sehen glauben zu wollen wankend
weit weg dort drüben was –
was –
was das wort ist
was das wort ist
Aus: Poesiealbum 387. Ulrike Draesner. Auswahl Axel Helbig. Wilhelmshorst: Märkischer Verlag, 2024, S. 18f
Manfred Peter Hein (1931-2025)
Manfred Peter Hein, der am 10. Mai 2025 im Alter von 93 Jahren verstarb, war eine markante Stimme der deutschen Gegenwartslyrik. Als Übersetzer öffnete er auch den Blick für die finnische Literatur und andere osteuropäische Literaturen und trug Wesentliches zur literarischen Verständigung zwischen Kulturen bei. Sein Werk bleibt ein leises, aber dauerhaftes Echo im Gedächtnis der deutschsprachigen Poesie.
Manfred Peter Hein
(* 25. Mai 1931 in Darkehmen / Ostpreußen; † 10. Mai 2025 in Espoo / Finnland)
BUCH DER UNRUHE
Aufgelassener Ölmühle Schilfdach
Schatten der fällt wo ich lese
im Buch der Unruhe während
langstreift am Strandgemäuer
wie gestern das Maultier
sich scheuernd am Ölbaum
Stimme des Schattens schürft
im Schatten
zu gleicher Stunde
Wo
mögen die wahrhaft
in Wahrheit lebendig
Lebenden sein
Aus: Manfred Peter Hein, Über die dunkle Fläche. Gedichte 1986-1993. Zürich: Ammann, 1993, S. 37
Hören Sie bei lyrikline den Autor das Gedicht lesen
Hier ein kurzer Film, in dem der Autor ein Gedicht liest und eine Übersetzung ins Arabische vorgestellt wird
Nachruf des Wallstein Verlags | Andreas F. Kelletat zum Tod Heins beim Deutschlandfunk
Neue Himmel für alte
Zum 100. Todestag erinnern wir an Amy Lowell – eine der bedeutendsten Stimmen des amerikanischen Imagismus. Ihre Gedichte verbinden präzise Bilder mit leidenschaftlicher Formsuche und einer oft übersehenen queeren Perspektive.
Aber stimmt das im einzelnen Gedicht, das man vor sich hat? Ich habe ein Gedicht herausgesucht, das Claire Goll für ihre Sammlung „Die neue Welt. Eine Anthologie jüngster amerikanischer Lyrik“ von 1921 übersetzt hat.
NEUE HIMMEL FÜR ALTE
Ich bin überflüssig,
Mein Tun unnütz.
Was ich denke, ist ohne Duft.
Es hängt ein Almanach zwischen den Fenstern
Aus dem Jahr meiner Geburt.
Die Kameraden rufen mich,
Sie schrein nach mir,
Wenn sie am Haus im großen Wind roter Fahnen vorüberziehn.
Frisch sind sie, sprühend.
Sie sind unanständig und brüsten sich damit;
Sie lachen und fluchen und lärmen
Und schmettern ihr: »Wer kommt mit?«
Gegen die eiserne Häuserfront an beiden Straßenecken.
Junge Männer mit nackten Herzen spotten zwischen den
eisernen Häusern,
Junge Männer mit nackten Körpern unter den Kleidern,
Leidenschaftlich bewußt ihrer selbst,
Bereit, ihre Kleider fortzuschleudern,
Bereit, ihre Sitten und täglichen Gewohnheiten fortzuschleudern,
Schrein nach der Roheit des Lebens
Voll Gier nach Liebe,
Die sie als Glaube proklamieren.
Anbeter der Jugend,
Anbeter ihrer selbst.
Sie rufen nach Frauen, und die Frauen kommen.
Sie entblößen ihre weiße Wollust
Vor der erstarrten toten Häuserfront.
Gleich Flammen brausen sie die Straße herunter;
Sie explodieren wie wildes Feuerwerk
Über den Häuserleichen.
Und ich –
Ich ordne drei Rosen in einer chinesischen Vase:
Eine rosa,
Eine rote,
Eine gelbe.
Ich nehme dies Arrangement sehr wichtig.
Dann sitz ich in einem Südfenster,
Nippe von bleichem Wein mit etwas Schierling,
Denke über Winternächte nach,
Und Feldmäuse kreuzen den Fleck,
Der bald mein Grab sein wird.
Aus: Die neue Welt. Eine Anthologie jüngster amerikanischer Lyrik. Hrsg. u. übersetzt von Claire Goll. Berlin: S. Fischer, 1921. 1.-3. Aufl., S. 44f
NEW HEAVENS FOR OLD
I am useless.
What I do is nothing,
What I think has no savour.
There is an almanac between the windows:
It is of the year when I was born.
My fellows call to me to join them,
They shout for me,
Passing the house in a great wind of vermilion banners.
They are fresh and fulminant,
They are indecent and strut with the thought of it,
They laugh, and curse, and brawl,
And cheer a holocaust of "Who comes firsts!"
at the iron fronts of the houses at the
two edges of the street.
Young men with naked hearts jeering
between iron house-fronts,
Young men with naked bodies beneath their clothes
Passionately censcious of them,
Ready to strip off their clothes,
Ready to strip off their customs, their
usual routine,
Clamouring for the rawness of life,
In love with appetite,
Proclaiming it as a creed,
Worshipping youth,
Worshipping themselves.
They call for women and the women come,
They bare the whiteness of their lusts
to the dead gaze of the old house-fronts,
They roar down the street like fame,
They explode upon the dead houses like
new, sharp fire.
But I –
I arrange three roses in a Chinese vase:
A pink one.
A red one,
A yellow one.
I fuss over their arrangement.
Then I sit in a South window
And sip pale wine with a touch of hemlock in it,
And think of Winter nights,
And field-mice crossing and re-crossing
The spot which will be my grave.
Aus: The Complete Poetical Works of Amy Lowell. With an introduction by Louis Untermeyer. Boston: Houghton Mifflin Company. The Riverside Press Cambridge. O.J. (1955) S. 574
Ist das die melancholisch-erhabene Selbstbehauptung einer Außenseiterin – oder eher sarkastisch gebrochene Selbstdemontage einer Figur, die sich mit kultivierter Bedeutungsschwere vor dem pulsierenden Leben rettet? Melancholische Gegenwelt zur entfesselten Energie einer ekstatischen Jugend oder Abrechnung mit der eigenen Unfähigkeit? Kontemplative Würde oder feine Selbstironie? Verleugnung ihrer imagistischen Jugend oder ein feiner Nachhall?
Liste weiterer Möglichkeiten
Chen Chen
Selbstportrait als enormes Potential
Träumen, von einem Tag, einem Sein, so furchtlos wie eine Mango.
So freundlich wie eine Tomate. Gnadenlos bis Kinnchen & Shirtbrust.
Merken, ich hasse das Wort »nippen«.
Aber das ist alles, was ich tue.
Ich trinke. So langsam.
& sage Ich koste es. Wenn ich bloß schlecht darin bin, Flüssigkeit einzunehmen.
Ich bin weder Mango noch Tomate. Ich bin ein rostiges Gähnen im gemunkelten Jahr.
Ich bin eine arktische Attika.
Komme schlendernd & und an sich im rutschigen polaren Durcheinander.
Ich bin nicht der analfixierte Hetero, zu dem meine Mutter mich erzog.
Ich bin ein schwuler Nipper, & meine Mutter setzte was von ihrer Hoffnung übrigblieb
in meine Brüder.
Sie will, dass sie die Welt herunterschlucken, stabile Abschlüsse herausspucken &
verantwortungsvolle Enkelkinder, bereit zu schlingen.
Sie werden besser sein als Mangos, meine Brüder.
Obwohl, ich habe Schwierigkeiten, mir vorzustellen, was das sein könnte.
Fliegende Mangos, vielleicht. Fliegende Mango-Tomaten-Hybride. Wunderbare Söhne.
Übersetzt von Devin Yu & Mari Molle. Auszug aus Chen Chen, When I Grow Up I Want to Be a List of Further Possibilities, BOA Editions, Ltd. 2017. In: Edit Nr. 91 (2024), S. 45
Nr. 357
Ein Gedicht des salvadorianischen Dichters Roque Dalton, der heute vor 50 Jahren ermordet und am 14. Mai vor 90 Jahren geboren wurde.
Roque Dalton
(* 14. Mai 1935 in San Salvador; † 10. Mai 1975 in Quezaltepeque)
NR. 357
Die Aufseher lassen sich in verschiedene Gruppen einteilen. Zum Beispiel, die mit Steinen nach Kaninchen schmeißen, sobald welche mit Margeriten im Maul aus dem Garten gerannt kommen. Und jene, die vor meiner Zelle herumhumpeln, dabei starke Worte brüllen und zusehen, wie sich in ihren Uhren der Geifer des Regens sammelt. Dann noch, die mich frühmorgens mit einem Pissestrahl wecken (wobei sie mir mit der Taschenlampe das Gesicht lecken) und mißmutig erzählen, daß es noch kälter geworden ist. Zu keiner dieser Gruppen gehört Nr. 357, früher Hirte und Musikant und jetzt aus Rache Polizist, wegen irgendeiner undurchsichtigen Geschichte, allerdings nur noch bis Entlassung (das heißt der von Nr. 357) Ende des Monats. Weil er sich nachts davongestohlen hatte und bis neun Uhr neun Uhr morgens bei seiner Frau schlief, dem Dienstreglement zum Hohn. Vor ein paar Tagen hat mir Nr. 357 eine Zigarette geschenkt. Als er mich gestern ein großes Blatt Anis kauen sah (mit der Hakenrute, die ich mir gebastelt hatte, war mir gelungen, die Pflanze in die Nähe des Gitters zu ziehen), fragte er mich nach Kuba. Und heute hat er mir vorgeschlagen, ich könnte ihm doch ein kleines Gedicht schreiben – etwas über die Berge von Chalatenango –, damit er ein Andenken von mir hat, wenn sie mich umgebracht haben.
Übertragen von Klaus Laabs, aus: Poesiealbum 236. Roque Dalton. Berlin: Neues Leben, 1987, S. 30
Im Jahr 1959 wurde er verhaftet und zum Tode verurteilt. Am Tag vor seiner Hinrichtung wurde Präsident José María Lemus López gestürzt; dies rettete Dalton vor der Exekution. Nach seiner Freilassung ging er nach Mexiko ins Exil. In seinen im Exil verfassten Büchern El turno del ofendido und La ventana en el rostro berichtet er über diese Geschehnisse.
https://de.wikipedia.org/wiki/Roque_Dalton
1961 reiste Dalton nach Kuba, wo er bis 1965 blieb. In diesem Jahr kehrte Dalton nach El Salvador zurück, wurde dort aber bald wieder verhaftet und zum Tode verurteilt. Wieder entging er der Exekution: Ein Erdbeben ließ die Mauern seines Gefängnisses einstürzen, und ihm gelang die Flucht nach Kuba. (…) In kubanischen Militärcamps ließ er sich als Guerillero ausbilden. 1973 bot er sich den Fuerzas Populares de Liberación (FPL) als Kämpfer an. Deren Führer Salvador Cayetano Carpio wies ihn jedoch zurück mit dem Hinweis, seine Rolle in der Revolution sei die eines Dichters, nicht die eines Soldaten. Daraufhin schloss Dalton sich dem Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) an. In dieser „Revolutionären Volksarmee“ geriet der undogmatische Dalton bald mit der marxistischen Führung aneinander. Man unterstellte ihm, die Organisation spalten zu wollen. Nachdem ein „Revolutionäres Tribunal“ ihn zum Tode verurteilt hatte, exekutierten seine Genossen Roque Dalton am 10. Mai 1975.
Das Strafverfahren wegen Mordes gegen zwei ehemalige Kommandanten der Guerilla, Joaquín Villalobos und Jorge Meléndez, wurde durch ein Gericht in San Salvador am 9. Januar 2012 aufgrund von Verjährung eingestellt.
Die DDR-Version:
1961 wegen „staatsfeindlicher Aktivitäten“ zum Tode verurteilt, Urteil wird nach einem Machtwechsel vier Tage vor dem Exekutionstermin ausgesetzt; Exil in Mexiko, dort Ethnologiestudium; 1963 in Kuba, Rückkehr nach El Salvador, Verschleppung und Versuch, ihn in der Gefangenschaft durch Nahrungsentzug umzubringen; 1964 Flucht während eines Erdbebens; (…) 1974 Rückkehr nach El Salvador, schließt sich dem Revolutionären Volksheer (ERP) an, wird am 10. Mai 1975 von einer maoistischen Fraktion dieser Guerilla-Organisation ermordet
Quelle: Poesiealbum 236
Dunstvergötterte Silberschrift
Anne Duden
(* 1. Januar 1942 in Oldenburg)
KAMMERHERZ
Herzaufgänge
als stünde die Welt
nur einmal im Laub
pro Leben.
Dunstvergötterte
Silberschrift
englisch
über alle Anzeichen
hinweggeschmiegt
grasige Weite.
Mitten im Totschlag
betritt Geißblatt das Haus
säugt die Zimmer
flurwärts
Schädel und Nebenhöhlen
ankert in der Schwebe
ausrißbereit.
Mundgewölbe und Ohrmuschel
geborsten
zerschallt
von Pennergebissen.
Hinter Vorhängen
jetzt noch das Kammerherz.
Genickfänger
fest im Griff.
Auf der Suche nach Schmauchspuren
und immer fündig
säumen
Faustpfandleiher
Lager und Betten
überwachen die Praktiken
schneiden
klar umrissen
das Wort ab
jedem
der nicht
außerdem
zusticht und köpft
oder genauso gut
erdrosselt und abwürgt.
Es hütet noch gerade
das Haus
Verstummung
am Rand.
Aus: Anne Duden: Herzgegend. Gedichte. Lüneburg: Zu Klampen!, 2001 (Lyrik Edition), S. 7f
das hatte ich nie glauben wollen wie so vieles nicht
Evelyn Schlag
SCHWARZE TRÄNEN
Auf einem wilden Kletterpfad lief
eine Frau quer über Panzerteile
ihr Gesicht war durchgestrichen
kann sein sie lebte gar nicht mehr
nur laufen war geblieben – das hatte
ich nie glauben wollen wie so vieles
nicht: achtgeben daß man sich
nichts eintritt gestern hatte ich das
Pech und stieg auf eine blaue Nuß
ich wollte schnell über einen Berg
von Abfall und fing an zu galoppieren
etwas sang in meinen Ohren – keine
Sprache Befehle keine Ausrufzeichen
es war fast wie zu Ostern damals als
ich neu war und allen Namen nachlief
der Rost steigt in die Nase ist nicht
zu vermeiden bei so viel Schrott
ich kannte das nicht – hatte immer
einen guten Platz mit zweimal Essen
ich möchte wissen wo die jetzt alle
sind – aufgelöst in Wetter? ich heule
schwarze Töne schwarze Tränen –
kommt her!
Aus: Sinn und Form 3/2025, S. 340
Evelyn Schlag, geb. 1952 in Waidhofen/Ybbs (Niederösterreich), wo sie auch lebt.
Docupoetry
Yan Jun
(*1973 Lanzhou, China, Dichter, Musiker, Kritiker und Betreiber des Independent-Labels KwanYin)
5. JUNI
I
wenn es keine worte gibt
wie soll ich dann dieses jahr das massaker beginnen
unter der brutheißen klimaanlage sitzen einhundert studenten
in einem zug, der beijing verlässt
II
wenn ich die bücher anderer leute umschreibe
fliegen kleine schwarze dinge von ihren seiten auf
sämtliche mücken in shenzhen haben denselben nachnamen
eine bibliothek des blutverlusts:
viel glück für euren flug und tod
(2011, shenzhen)
Aus dem Chinesischen von Lea Schneider, aus: Uljana Wolf, Günter Blamberger und Michaela Predeick (Hrsg.), poetica7. Sounding Archives – Poesie zwischen Experiment und Dokument. Tübingen: Konkursbuch Verlag Claudia Gehrke, 2022, S. 97
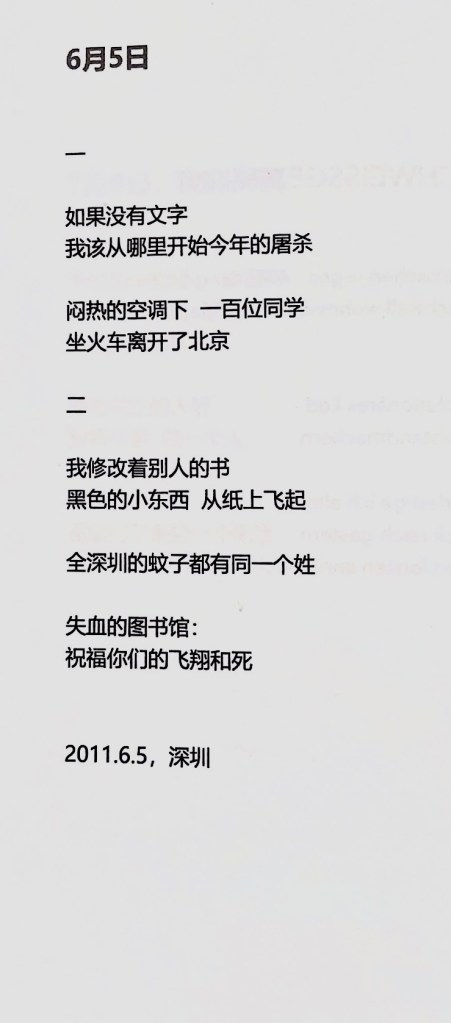
Dokumentarische Lyrik muss ihre Themen nicht erfinden, sie findet sie vor. Sie ist Counter-History, schafft Gegen-Wissen in ihren offenen Archiven. Ein Gegen-Wissen, das wie das Wissen der Wissenschaften ein Wissen im Werden ist und vorläufig bleibt, korrigierbar, amplifizierbar, dezentralisiert.
Günter Blamberger, Über Docupoetry, a.a.O. S. 142
Himmel oder Hölle?
Die soeben erschienene Ausgabe 3/2025 der Zeitschrift Sinn und Form bringt „Nachdichtungen hebräischer Gedichte“ von Jan Wagner (erst in den Anmerkungen am Schluss der Ausgabe erfährt man genauer, dass die Gedichte aus dem Englischen des zweisprachigen Penguin Book of Hebrew Verse nachgedichtet sind).
Daraus eins von zwei Gedichten des Dichters Immanuel von Rom (um 1261-um 1335). Der italienische Dichter schrieb Hebräisch und Italienisch und wurde stark von Dante beeinflusst.
Immanuel ben Schlomo ha-Romi, italienisch Manouello Romano oder Manoello Giudeo (geboren um 1261 in Rom; gestorben um 1335), war ein italienischer Schriftsteller. Er gilt als der bekannteste Dichter in hebräischer Sprache aus Italien.
https://de.wikipedia.org/wiki/Immanuel_ha-Romi
PARADIES UND HÖLLE
Mein Herz hat sich entschieden: Keinen Hektar
Vom Paradies und alle meine Gunst
Der Hölle: Dort tropft Honig, dort sind Nektar
Und zarte Ricken, Damen in der Brunst.
Was gibt's im Paradies? Wohl kaum Affären,
Nur Frauen, schwärzer noch als Pech und Ruß,
Nur Greisinnen, von denen Flechten zehren.
Dem Geist bleibt, so umringt, nichts als Verdruß.
Was, Paradies, du bietest? Ein Habtacht
Von Stummelweibern, Gaunern, Hungerleidern.
Bedenk ich's recht, so scheinst du nichts zu taugen.
Nichts übertrifft denn, Hölle, deine Pracht,
Dein sind die Mädchen in den Seidenkleidern.
Nur du führst alle Wonnen uns vor Auge
Aus dem Englischen von Jan Wagner, aus: Sinn und Form 3/2025, S. 387.
(Die hebräische Fassung liefere ich im Lauf des Tages nach).
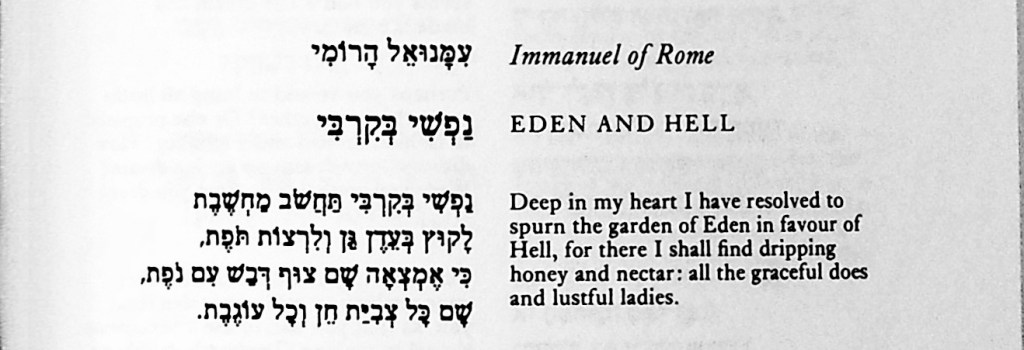

Antiidyll
Tytus Czyżewski
(* 28. Dezember 1880 in Przyszowa in Galizien; † 5. Mai 1945 in Krakau) war ein polnischer Maler, Dichter und Kunstkritiker. Er war einer der Begründer der Polnischen Formisten. https://de.wikipedia.org/wiki/Tytus_Czyżewski
Stadt am Herbstabend
antiidyll
zieh an die warme hose
es falln die thermograde
aus kneipen dringt getose
die mißklangserenade
die kirchenglocken bimmeln
und jemand holt sich beulen
im trog aus nebelhimmeln
dem hund vergeht das heulen
die sonne möchte gähnen
und rauch umhüllt die heime
zur frühschicht krähn die hähne
vom friedhof tropfen reime
im auto flitzt die dirne
die straßenbahnen schleichen
gepudertes gewürme
pantoffeln blasser leichen
die erde dampft libido
und alte möbel rossen
re mi fa sol la si do
die weißen leitersprossen
es plärrt aus kindergärten
und wolken ziehen neben
dem abendrotverklärten
dem fetzenrest vom leben
Deutsch von Karl Dedecius, aus: Auf der Karte Europas ein Fleck. Gedichte der osteuropäischen Avantgarde. Hrsg. Manfred Peter Hein. Zürich: Ammann, 1991, S. 173

Miasto w jesienny wieczór
(niesielanka):
wdziej ciepłe astrachany
termometr wciąż opada
od knajpy śpiew pijany
dysonans serenada
w kościele dzwonią dzwony
ktoś kogoś kopnął nogą
w kanale z mgieł opony
i psy już wyć nie mogą
ni słońce się nie śmieje
nad miastem płyną dymy
kogut na zmianę pieje
z cmentarza kapią rymy
mknie autem nierządnica
tramwaj w aleje znika
wyblanszowane lica
pantofle nieboszczyka
czuć zapach świeżej ziemi
i trzepią stare meble
fa so la si do re mi
drabiny białe szczeble
w ochronce płaczą dzieci
i chmury mkną powoli
purpura zorzy świeci
łachmanom ludzkiej doli
Aus: Ebd. S. 172
O. T.
Im Dezember 2017 erschien in der Reihe roughbooks ein Buch ohne Verfassernamen, ohne Titel und Herausgeber. Im Impressum steht lediglich:
Dieses Buch trägt diesen Titel. Herausgegeben von sich selbst. roughbook 044. Wuppertal, Berlin, Schupfart, Dezember 2017. ISBN 978-3-906050-39-3. © bei sich selbst 2017.
Hier eins dieser Nowhere-Nongedichte.
Als es klein war, wollte dieses Gedicht ein Liebesgedicht werden, dann ein politisches, dann ein experimentelles. Es radikalisierte sich selbst, bis es überhaupt kein Gedicht mehr sein wollte und einen Hass auf alles hatte, was nur von weitem wie ein Gedicht aussah. Aber auch das ging vorüber.
A.a.O. S. 16.
PS: Der Rezensent des Signaturen-Magazins, Jan Kuhlbrodt, behauptet, er kenne „den Namen des Autors, den es nicht gibt, und der sich bester Gesundheit erfreut.“ https://signaturen-magazin.de/-anonym—dieses-gedicht-traegt-diesen-titel.html
Kein Sein soll entzwei
Heute ein Gedicht von Paul Bowles, dem amerikanischen Schriftsteller und Komponisten, der einen großen Teil seines Lebens in Tanger (Marokko) verbrachte und durch radikale Modernität und existenzielle Kühle auffiel. Das Gedicht erschien in der zweisprachigen Ausgabe „Fast nichts“ (2020), herausgegeben und übersetzt von Jonis Hartmann.
Formal fällt das Gedicht durch seine sparsame, abgebrochene Sprache auf, die durch Wiederholungen, Verneinungen und reduzierte Bilder eine tranceartige Atmosphäre erzeugt. Eine eindringliche Sehnsucht nach Unversehrtheit und Stillstand: Kein Ding, kein Baum, kein Halm soll zerstört oder bewegt werden, nichts soll das „Sein“ oder die „Ideen“ entzwei reißen.
Paul Bowles
(* 30. Dezember 1910 in Jamaica, Long Island, New York; † 18. November 1999 in Tanger, Marokko)
Gedicht
Die Dinge werden so weitergehn für
Immer. Nein
Kein Ding soll entzwei. Nein
Kein Baum. Nein
Kein Grashalm sei
Dort. Nein
Kein Ding nur
Blaue Felsen sollen
Das Tal füllen, wo ich
Schlafe.
Die Dinge sollen so weitergehn für
Immer.
Die Dinge seien un
Gebrochen.
Kein Akt soll entzwei. Nein
Kein Ding soll fliehn und kein
Körper soll Ideen entzwein und kein
Sein soll entzwei. Nein
Kein Baum. Nein
Kein Grashalm sei
Dabei, den
Vorfall zu
Bezeugen.
* * * * * * * *
Jedes Ding soll stets entsprechend sein. Nein
Kein Ding soll gewendet oder bewegt sein.
Berührt.
Alles soll für immer so.
Aus dem Englischen von Jonis Hartmann, aus: Paul Bowles: Fast nichts. Hrsg. von Jonis Hartmann. Hamburg, Berlin, Schupfart: Urs Engeler, 2020 (roughbook 053), S. 49/51
Poem
Things will go on like this for
Ever. No
Thing shall shatter. No
Tree. No
Blade of glass shall be
There. No
Thing but
Blue rocks shall
Fill the valley where I
Sleep.
Things shall go on like this for
Ever.
Things shall be un
Broken.
No action shall shatter. No
Thing shall escape and no
Body shall shatter ideas and no
Being shall shatter. No
Tree. No
Blade of grass shall
Be present to
Witness the
Incident.
* * * * * * * *
Everything shall be always thus. No
Thing shall be turned or moved.
Touched.
All shall be forever so.
Ebd. S. 48/50
Das glas schimmert im gras
Ein interessantes Gedicht des ungarischen Lyrikers Attila József
(* 11. April 1905 in Budapest; † 3. Dezember 1937 in Balatonszárszó).
Glas
Das glas schimmert im gras. Das glas ist
an das die tau-tropfen dringen.
Wenn ein klein kind gläser anschaut,
so fangen sie an
um still zu klingen.
Ein glas wächst am herzen der quellen
das weiss kein glaser selbst kein lieber leser.
Die mädchen und die jungen männer
verwechseln immer ihre gläser.
Die vielen gläser hinterm himmel
bemerkte einst ein vogel
durstig und ohne lied
Ich möchte dir, ich möchte nur so leuchten,
wie das glas,
das auf meinem tische allein blieb.
Interessant ist an diesem Gedicht zunächst, dass es auf Deutsch verfasst ist. Ich kann nicht Ungarisch – aber ich habe gelesen oder gehört, dass die Sprache des Autors in seinen ungarischen Gedichten oft sehr komplex und rhythmisch verdichtet ist und einen starken musikalischen Fluss aufweist. Die deutsche Sprache in „Glas“ ist – bewusst? – schlicht, fast naiv. Einige grammatische Eigenheiten („das glas ist / an das die tau-tropfen dringen“, „ein klein kind“, „so fangen sie an / um still zu klingen.“) deuten darauf hin, dass József möglicherweise Deutsch nicht muttersprachlich beherrschte, oder dass er einen besonders reduzierten, fast kindlichen Stil wählte. Aber unterstreicht das nicht gerade den kindlichen Blick und die Einsamkeit und Orientierungslosigkeit oder Sehnsucht nach Orientierung, die aus dem Gedicht sprechen?
Aus: Attila József, Liste freier Ideen. Hrsg. u. übersetzt von Christian Filips und Orsolya Kalász. Berlin und Schupfart: Roughbooks, 2017 (Roughbook 43), S. 79.
Musikgeschichte in Todesarten
Chris Bezzel
Spiel mir das Lied vom Tod
monteverdi schlummerte nach neuntägigem krankenlager im spätherbst 1643 in das reich jenseitiger harmonien hinüber.
an seinem sterbetag machte henry purcell sein testament.
als der fünfundzwanzigjährige pergolesi abgeschieden war, wurde er in der kathedrale pozzuoli beigesetzt.
vivaldi ist in wien völlig verarmt als 66jähriger heimgegangen.
bach schloß die augen, die schon bei sehenden zeiten so viel überirdisches geschaut hatten.
händel legte sich still zum sterben.
schließlich tat der einundachtzigjährige rameau seinen feinden den gefallen, mit tod abzugehen.
der tod hielt das herz des zweiundsiebzigjährigen scarlatti an.
im 87. jahr schwand der rastlose telemann dahin.
als christoph willibald gluck ein ihm verbotenes glas weinbrand hinuntergestürzt hatte, trug ihn kurz darauf ein zweiter schlaganfall sanft hinweg
carl philipp emanuel bach ging vierunsiebzigjährig dahin.
an einem wintermorgen hauchte mozart seine seele aus.
karl ditters von dittersdorf wurde siebzigjährig von seinem leiden erlöst.
beethovens ende erfüllte sich unter blitz und donner eines schweren gewitters.
schubert mußte 1828 dahin.
mendelssohn-bartholdy zählte erst 38 jahre, als der tod ihn, seinen zahllosen verehrern völlig unerwartet, aus reichem schaffen und wirken abberief.
chópin starb in den armen seines schülers gutmann.
der kranke robert schumann begriff allmählich das hoffnungslose seines zustands, verweigerte die nahrungsaufnahme und starb so, 46 jahre alt, an entkräftung.
rossini schloß sechsundsiebzigjährig die augen.
richard wagner erlag im venezianischen palast vendramin seinem herzleiden.
franz liszt hat in wahnfried seine augen für immer geschlossen.
verdi ging mit 88 jahren bei voller klarheit heim.
der 23. märz 1918 wurde debussys todestag.
nach vier jahren zunehmenden verfalls legte sich der seit je wortkarge ravel auf den operationstisch. er sollte nicht mehr zu bewußtsein kommen.
17 takte vor schluß des dritten klavierkonzerts entsank bartók die feder.
dann kam, nachdem der zweiundsiebzigjährige schönberg 1946 schon einmal fast gestorben und zuletzt beinah erblindet war, der tod.
quelle: hans joachim moser: musikgeschichte in hundert lebensbildern. klagenfurt 1958
Aus: Chris Bezzel: isolde und tristan. Hrsg. von Florian Neuner und Christian Steinbacher. Berlin, Hannover, Linz und Solothurn: Roughbooks, 2012 (Roughbook 22), S. 65-67
Gertrud Kolmar
Zum 80. Geburtstag von Ulla Hahn ihr Gedicht auf Gertrud Kolmar.
Ulla Hahn
(* 30. April 1945 in Brachthausen / Sauerland)
Gertrud Kolmar
Auf meinen Knien das Häufchen
Fotokopien wird leichter
Langsamer lesen
Mit jedem Blatt lege ich Lebenszeit ab
von einer die schrieb im vorletzten Brief:
Ganz ohne Freude bin ich freilich nicht
Sie meinte ihre Erinnerungen
Weinte mit keinem Wort
Lebte vom Leben schon sehr weit entfernt
Legte an alles Geschehen längst
den Maßstab der Ewigkeit
Trat freiwillig unter ihr Schicksal
Hatte es schon »im voraus bejaht, sich ihm
im voraus gestellt« schrieb sie
Langsamer lesen
Wir wissen nicht wo sie starb
Wir wissen nicht wann sie starb
Ihre Mörder sind bekannt
Im letzten Brief fiel ihr »eben etwas
Ulkiges ein«. Versprechen und Pläne. Herzliche Grüße
Langsamer lesen
Immer wieder von vorn.
Aus: Ulla Hahn, Klima für Engel. Gedichte. München: dtv, 1993, S. 60


Neueste Kommentare